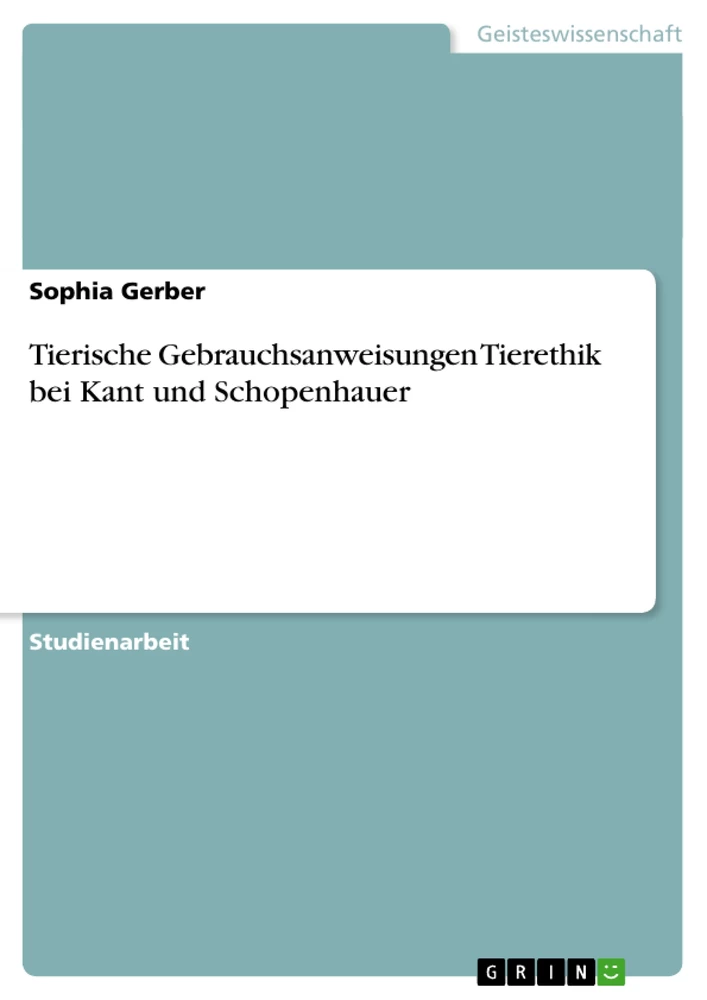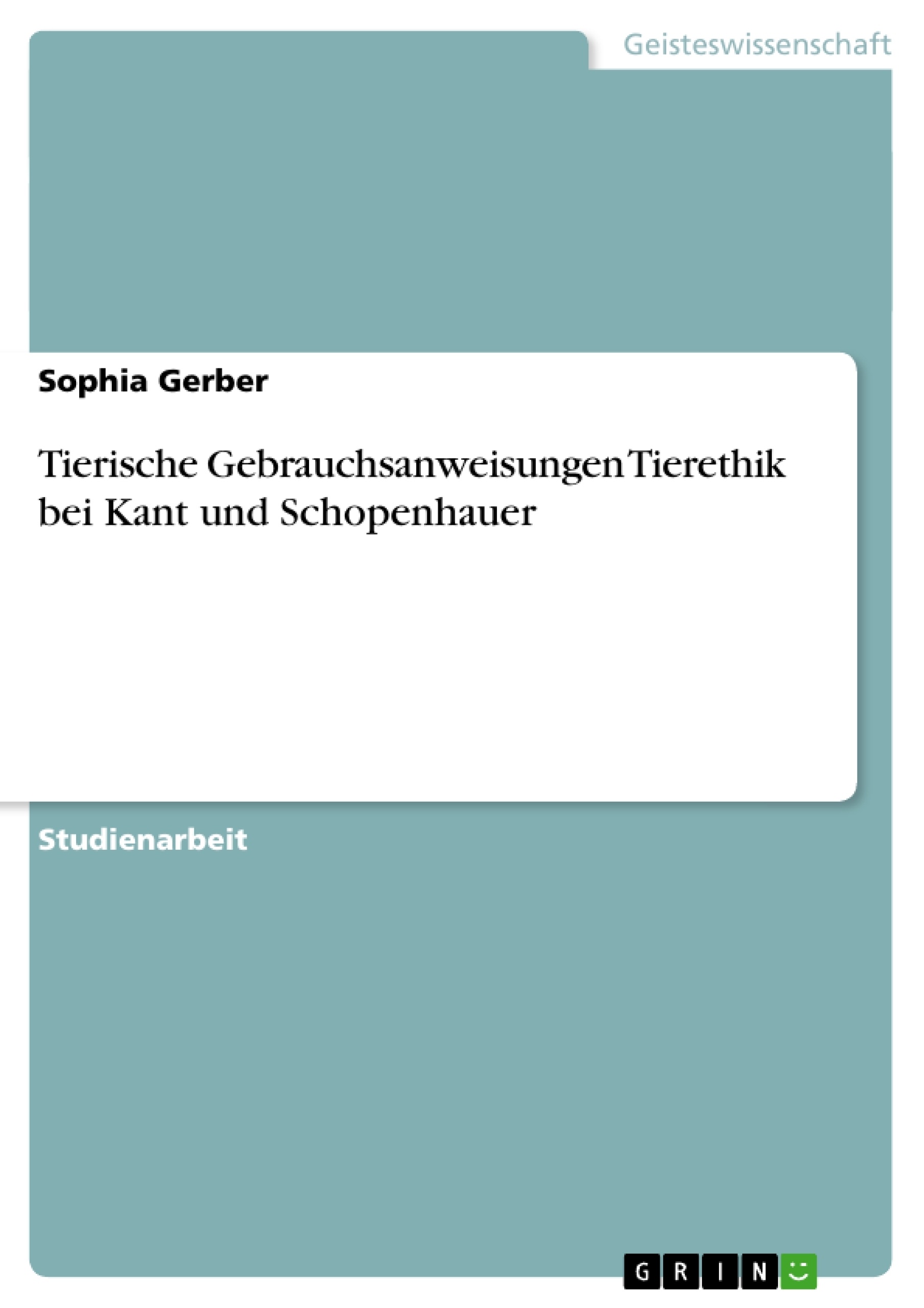[...] Die Folgen sind nicht selten Epidemien wie BSE, die Schweinepest oder Vogelgrippe, für die vor allem die Politik, Wirtschaft und Industrie in die Verantwortung gezogen werden. Doch wo bleibt hier die Philosophie, das heißt der Diskurs über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier? Sollen Tiere in den Bereich moralischer Rücksichtnahme fallen? Gibt es menschliche Interessen, die es moralisch erlauben, Tieren Leid zuzufügen? Wie ist die Massentierhaltung zu beurteilen? Ist das Töten von Tieren vertretbar? Diese Fragen zu untersuchen, ist Aufgabe der Tierethik. Im Folgenden sollen exemplarisch die tierethischen Modelle Immanuel Kants und Arthur Schopenhauers dargestellt, miteinander verglichen sowie kritisch bewertet werden. Die zu analysierenden Schlüsselbegriffe der philosophischen Positionen sind dabei das jeweilige Menschenbild, das Tierbild und die daraus abgeleitete normativ-ethische Theorie. Zudem werden die Folgen für die Praxis der entsprechenden Ethik am Beispiel der Nutztierhaltung sowie den damit verbundenen Tiertransporten und Schlachtmethoden aufgezeigt. Anschließend sollen die Standpunkte Kants und Schopenhauers anhand der untersuchten Schlüsselbegriffe gegenüber gestellt werden, wobei die Schwerpunktsetzung beim jeweiligen Menschen- und Tierbild eher differiert, die normativen ethischen Theorien hingegen beide zu einem rücksichtsvollen Verhalten gegenüber Tieren tendieren, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Als primäre Literaturgrundlagen dienen dieser Arbeit wichtige ethische Schriften Kants wie die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, die Kritik der praktischen Vernunft, die Metaphysik der Sitten und eine Vorlesung über Ethik sowie Teile der Kritik der Urteilskraft, Schopenhauers Preisschrift über die Grundlage der Moral, einer Kritik an der kantischen Ethik, sowie Ausschnitte aus dessen Werken Die Welt als Wille und Vorstellung und Parerga und Paralipomena. Sekundär werden Autoren wie Ursula Wolf, Johann Ach, Dieter Birnbacher und Hans-Peter Breßler berücksichtigt, die sich nicht nur mit der Tierethik Kants und Schopenhauers auseinandergesetzt, sondern diese auch zum Teil weitergeführt und aktuelle Forschungsergebnisse aus der Praxis einbezogen haben. Schließlich sollen die Ergebnisse resümiert, offene Probleme thematisiert sowie ein Ausblick auf die aktuelle Tierschutzdebatte gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die anthropozentrische Tierethik Immanuel Kants
- 1.1 Der Mensch als vernünftiges Wesen
- 1.2 Das unvernünftige Tier
- 1.3 Die Pflichtenethik
- 1.4 Folgen für die Praxis am Beispiel der Nutztierhaltung
- 2. Die pathozentrische Tierethik Arthur Schopenhauers
- 2.1 Der Mensch als leidendes Wesen
- 2.2 Das leidende Tier
- 2.3 Die Mitleidsethik
- 2.4 Folgen für die Praxis am Beispiel der Nutztierhaltung
- 3. Vergleich der tierethischen Positionen Kants und Schopenhauers
- 3.1 Menschenbild
- 3.2 Tierbild
- 3.3 Normativ-ethische Theorie
- 3.4 Folgen für die Praxis am Beispiel der Nutztierhaltung
- 4. Diskussion der tierethischen Modelle Kants und Schopenhauers
- 4.1 Chancen und Probleme der Tierethik Kants
- 4.2 Chancen und Probleme der Tierethik Schopenhauers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die tierethischen Positionen Immanuel Kants und Arthur Schopenhauers darzustellen, zu vergleichen und kritisch zu bewerten. Dabei wird der Fokus auf die jeweiligen Menschen- und Tierbilder, die normativ-ethischen Theorien und die daraus resultierenden Folgen für die Praxis, insbesondere die Nutztierhaltung, gelegt.
- Die Anthropozentrik Kants und die Rolle der Vernunft
- Die Pathozentrik Schopenhauers und die Bedeutung des Leids
- Der Vergleich der Menschenbilder und Tierbilder
- Die Auswirkungen auf die ethische Beurteilung der Nutztierhaltung
- Die Chancen und Probleme beider tierethischen Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die aktuelle Debatte um die Nutztierhaltung und die Bedeutung der Tierethik. Kapitel 1 beleuchtet die anthropozentrische Tierethik Kants, die den Menschen aufgrund seiner Vernunft als moralisch autonom und den Tieren diese Eigenschaft abspricht. In Kapitel 2 wird Schopenhauers pathozentrische Tierethik vorgestellt, die das Leid als Grundlage für eine moralische Verpflichtung gegenüber Tieren sieht. Kapitel 3 vergleicht die beiden Positionen anhand ihrer Menschenbilder, Tierbilder, normativ-ethischen Theorien und praktischen Konsequenzen für die Nutztierhaltung. Schließlich werden in Kapitel 4 die Chancen und Probleme der jeweiligen Tierethik diskutiert.
Schlüsselwörter
Tierethik, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Anthropozentrik, Pathozentrik, Vernunft, Leid, Nutztierhaltung, Mitleid, Pflichtenethik, Menschenbild, Tierbild, Moral, Praxis.
- Arbeit zitieren
- Sophia Gerber (Autor:in), 2004, Tierische Gebrauchsanweisungen Tierethik bei Kant und Schopenhauer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36832