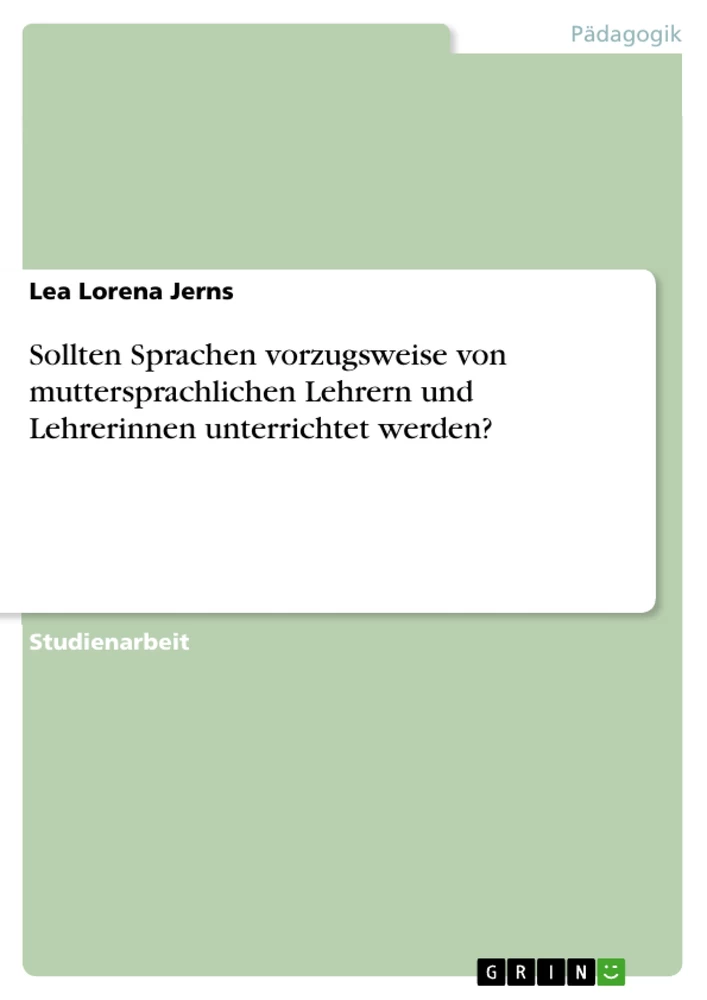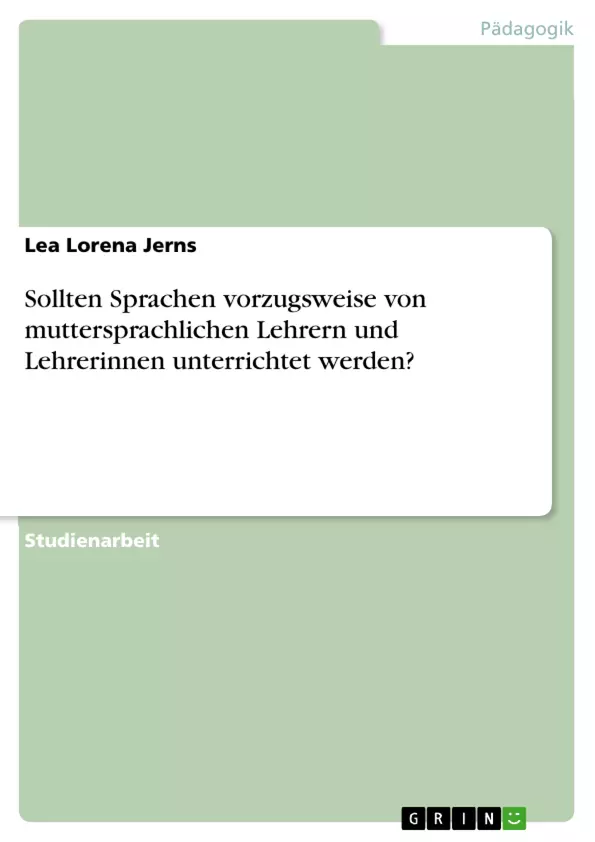Diese Hausarbeit mit dem Titel "Sollten Sprachen vorzugsweise von muttersprachlichen Lehrern/Lehrerinnen unterrichtet werden?" widmet sich dem umstrittenen Thema, ob beziehungsweise inwiefern muttersprachliche Sprachenlehrer_Innen qualifizierter für den Sprachenunterricht sind als nicht-muttersprachliche Sprachenlehrer_Innen. Hierbei werde ich mich in erster Linie auf das Englische beziehen. Ziel wird es sein, in dieser Arbeit verschiedene Literatur, die sich mit dem Thema Unterricht eines 'native' versus eines 'non-native speaker teachers' befasst, zu diskutieren, gegenüberzustellen und deren Widersprüche und Übereinstimmungen aufzugreifen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Muttersprachliche versus nicht-muttersprachliche Sprachenlehrer_Innen
- Muttersprachliche und nicht-muttersprachliche Identitäten
- Vorteile und Nachteile muttersprachlicher und nicht-muttersprachlicher Sprachenlehrer_Innen
- NSTs und NNSTs in der Vorbildfunktion für Fremdsprachenlerner_Innen
- Das Lehren von Kultur
- Fehlendes Selbstbewusstsein, mangelnde Glaubhaftigkeit und Unsicherheit – Probleme, die ausschließlich dem NNST vorbehalten sind?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die umstrittene Frage, ob muttersprachliche Sprachenlehrer_Innen im Vergleich zu nicht-muttersprachlichen Sprachenlehrer_Innen für den Unterricht besser qualifiziert sind. Der Fokus liegt dabei auf dem Englischen. Die Arbeit befasst sich mit verschiedenen wissenschaftlichen Texten, die sich mit der Thematik des native versus non-native speaker teachers auseinandersetzen, analysiert deren Argumente und stellt Widersprüche sowie Übereinstimmungen heraus.
- Die Bedeutung der Debatte über die Qualifikation von muttersprachlichen und nicht-muttersprachlichen Lehrkräften im Kontext der Tatsache, dass weltweit die Mehrheit der Englischlehrer_Innen keine Muttersprachler_Innen sind.
- Die Auseinandersetzung mit dem verbreiteten Vorurteil, nur Muttersprachler_Innen seien eine verlässliche linguistische Quelle.
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich für beide Parteien (NSTs und NNSTs) im Kontext des Fremdsprachenunterrichts ergeben.
- Die Rolle der Kultur im Sprachenunterricht und deren Einfluss auf die Lehrqualität.
- Die Bedeutung von Selbstbewusstsein, Glaubhaftigkeit und Sicherheit für den Lernerfolg.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Problemstellung dar: Sind muttersprachliche Sprachenlehrer_Innen besser qualifiziert als nicht-muttersprachliche? Die Arbeit konzentriert sich auf das Englische und analysiert verschiedene wissenschaftliche Texte, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen.
Muttersprachliche versus nicht-muttersprachliche Sprachenlehrer_Innen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Aspekten der Muttersprachlichkeit und Nicht-Muttersprachlichkeit im Kontext des Sprachenunterrichts. Es werden die Identitäten von muttersprachlichen und nicht-muttersprachlichen Lehrkräften betrachtet und die Vor- und Nachteile beider Gruppen analysiert.
- Die Bedeutung der Vorbildfunktion von muttersprachlichen und nicht-muttersprachlichen Lehrkräften für die Lerner_Innen.
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich durch die Vermittlung von Kultur im Sprachenunterricht ergeben.
- Die Frage, ob nicht-muttersprachliche Lehrer_Innen aufgrund von mangelndem Selbstbewusstsein, Glaubhaftigkeit oder Unsicherheit benachteiligt sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Sprachenunterricht, Muttersprachlichkeit, Nicht-Muttersprachlichkeit, native speaker teachers, non-native speaker teachers, Englisch als Fremdsprache, Kulturvermittlung, Selbstbewusstsein, Glaubhaftigkeit und Sicherheit im Kontext des Fremdsprachenlernens.
Häufig gestellte Fragen
Sind Muttersprachler (NSTs) grundsätzlich bessere Englischlehrer?
Dies ist eine umstrittene Frage. Während NSTs oft eine höhere authentische Sprachkompetenz besitzen, haben Nicht-Muttersprachler (NNSTs) den Vorteil, den Lernprozess selbst durchlaufen zu haben.
Welche Vorteile bieten Nicht-Muttersprachler im Unterricht?
Sie dienen als Vorbild für erfolgreiches Sprachenlernen, kennen die spezifischen Schwierigkeiten der Lernenden besser und verfügen oft über ein hohes Maß an explizitem Grammatikwissen.
Welche Herausforderungen haben Muttersprachler als Lehrer?
Oft fehlt ihnen das Bewusstsein für die Schwierigkeiten beim Erwerb ihrer Sprache als Fremdsprache oder sie verfügen über weniger methodisch-didaktisches Hintergrundwissen.
Spielt die Vermittlung von Kultur eine Rolle?
Ja, NSTs können oft tiefere Einblicke in die Zielkultur geben, während NNSTs besser zwischen der eigenen und der fremden Kultur vermitteln können.
Was ist wichtiger: Muttersprachlichkeit oder pädagogische Qualifikation?
Die Forschung deutet darauf hin, dass fachliche und didaktische Kompetenz für den Lernerfolg entscheidender sind als der Status als Muttersprachler.
- Arbeit zitieren
- Lea Lorena Jerns (Autor:in), 2016, Sollten Sprachen vorzugsweise von muttersprachlichen Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet werden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368368