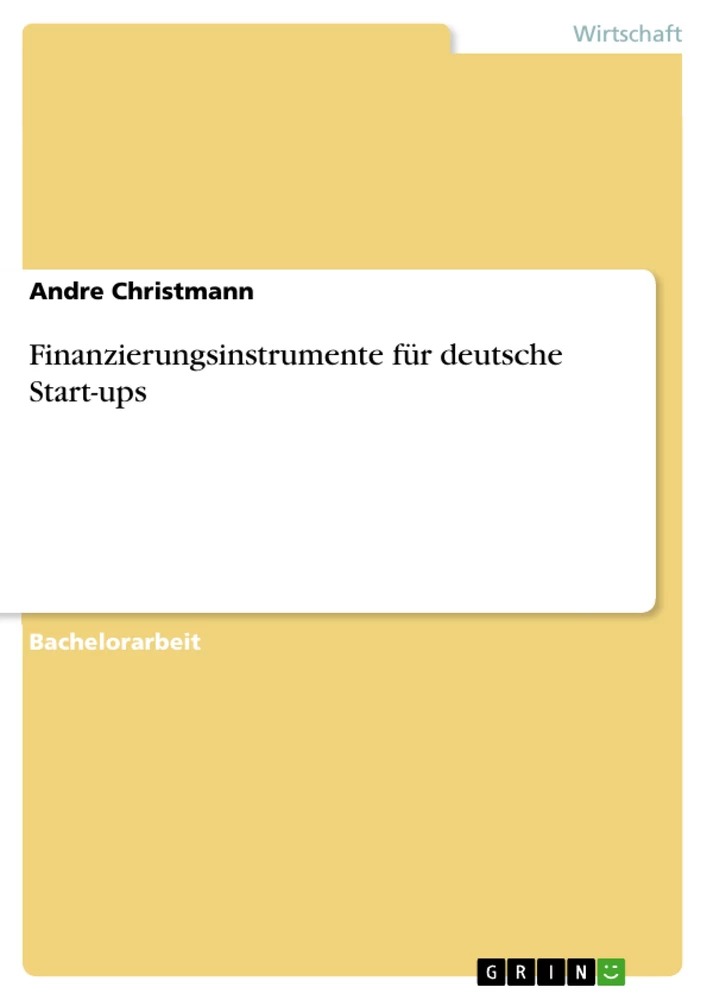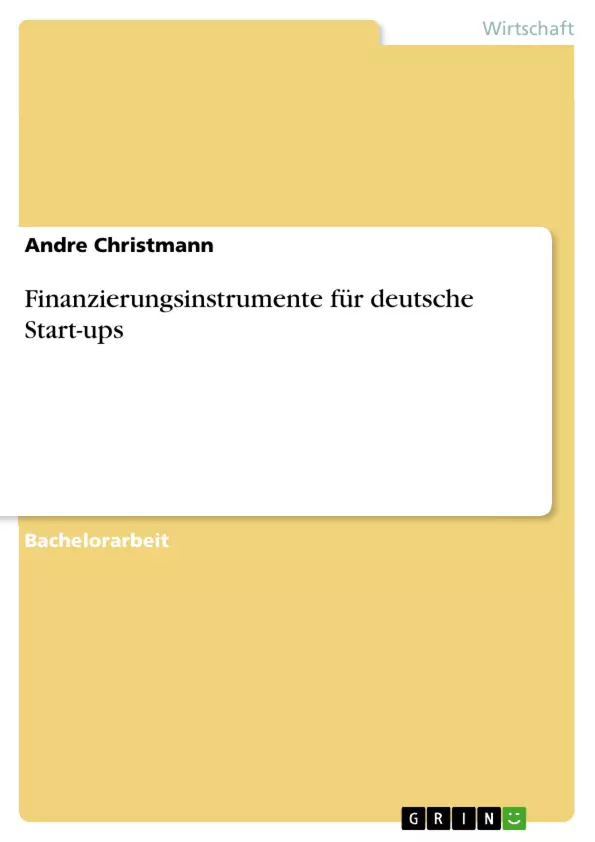Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die relevanten Finanzierungsinstrumente für deutsche Start-ups zu betrachten und auf deren Eignung zu prüfen. Eine empirische Untersuchung wird danach die Entwicklung der Finanzierungsinstrumente aufzeigen und einen Ausblick ermöglichen. Zusammengefasst soll diese Arbeit einen Beitrag zur politischen sowie zur wirtschaftlichen Debatte bezüglich der sinkenden Gründeraktivität in Deutschland liefern.
Die Grundlage dieser Arbeit bildet Fachliteratur aus den Bereichen Finanzierung und Wirtschaft. Als Sekundärliteratur fließen Studien der KfW und weiterer renommierter Institute in diese Arbeit ein. Speziell der KfW-Gründungsmonitor, der Bitkom Start-up-Report und der Deutsche Startup Monitor der KPMG liefern die empirische Datengrundlage. Zusätzlich stützen Zahlen von Branchenverbänden die oben genannten empirischen Erhebungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Gegenstand der Arbeit
- 1.2 Struktur und Vorgehensweise
- 2. Merkmale und finanzielle Rahmenbedingungen eines Start-ups
- 2.1 Definition eines Start-ups
- 2.2 Abgrenzung zu traditionellen Unternehmensgründungen
- 2.3 Finanzielle Barrieren für Start-ups
- 2.4 Finanzierungsrisiken für Investoren
- 3. Finanzierungsphasen im Lebenszyklus eines Start-ups
- 3.1 Lebenszyklusmodell
- 3.2 Gründungsphase (Early-Stage)
- 3.3 Expansionsphase (Expansion-Stage)
- 3.4 Reifephase (Later-Stage)
- 3.5 Kritische Würdigung des Lebenszyklusmodells eines Start-ups
- 4. Kreditfinanzierung und deren Eignung für deutsche Start-ups
- 4.1 Formen der Kreditfinanzierung
- 4.1.1 Bankkredit
- 4.1.2 Förderkredit
- 4.1.3 Crowdlending
- 4.2 Kreditfinanzierung - Eignung für deutsche Start-ups
- 5. Beteiligungsfinanzierung und deren Eignung für deutsche Start-ups
- 5.1 Formen der Beteiligungsfinanzierung
- 5.1.1 Venture Capital Gesellschaften
- 5.1.2 Business Angels
- 5.1.3 Business Inkubator
- 5.1.4 Crowdinvesting
- 5.1.5 Öffentliche Fördermittel
- 5.2 Beteiligungsfinanzierung - Eignung für deutsche Start-ups
- 6. Mezzanine-Finanzierung und deren Eignung für deutsche Start-ups
- 6.1 Formen der Mezzanine-Finanzierung
- 6.1.1 Debt Mezzanine Capital
- 6.1.2 Equity Mezzanine Capital
- 6.2 Mezzanine-Finanzierung - Eignung für deutsche Start-ups
- 7. Aktueller Stand
- 7.1 Aktuelle Entwicklung der deutschen Start-up-Szene
- 7.2 Aktuelle Finanzierungs-Situation in Deutschland
- 7.2.1 Kreditfinanzierung
- 7.2.2 Beteiligungsfinanzierung
- 7.2.3 Mezzanine-Finanzierung
- 7.2.4 Überblick über die aktuelle Finanzierungssituation in Deutschland
- 8. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die verschiedenen Finanzierungsinstrumente für deutsche Start-ups. Ziel ist es, einen Überblick über die verfügbaren Optionen zu geben und deren Eignung für unterschiedliche Phasen im Lebenszyklus eines Start-ups zu bewerten.
- Kreditfinanzierung (Bankkredite, Förderkredite, Crowdlending)
- Beteiligungsfinanzierung (Venture Capital, Business Angels, Crowdinvesting, öffentliche Fördermittel)
- Mezzanine-Finanzierung (Debt und Equity Mezzanine Capital)
- Finanzierungsphasen im Start-up Lebenszyklus
- Aktuelle Finanzierungslandschaft für deutsche Start-ups
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt den Gegenstand der Arbeit, nämlich die Finanzierungsinstrumente für deutsche Start-ups. Sie erläutert die Struktur und Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf eine systematische Untersuchung der verschiedenen Finanzierungsformen konzentriert und deren Eignung für verschiedene Phasen des Unternehmenslebenszyklus bewertet. Die Einleitung legt den Fokus auf die Herausforderungen und Besonderheiten der Start-up-Finanzierung im deutschen Kontext.
2. Merkmale und finanzielle Rahmenbedingungen eines Start-ups: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Start-up" und grenzt ihn von traditionellen Unternehmensgründungen ab. Es analysiert die spezifischen finanziellen Herausforderungen, mit denen Start-ups konfrontiert sind, wie z.B. hohe Anfangsinvestitionen, unsichere Einnahmen und ein erhöhtes Risiko für Investoren. Die Kapitel verdeutlicht die Notwendigkeit spezifischer Finanzierungslösungen. Der Abschnitt beleuchtet die besondere Risikoprofile für Investoren, die in Start-ups investieren, und diskutiert deren Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Kapital.
3. Finanzierungsphasen im Lebenszyklus eines Start-ups: Dieses Kapitel stellt ein Lebenszyklusmodell für Start-ups vor und analysiert die spezifischen Finanzierungsbedürfnisse in den verschiedenen Phasen (Gründung, Expansion, Reife). Es wird erläutert, wie sich die Finanzierungsstrategien im Laufe des Lebenszyklus eines Unternehmens verändern und welche Finanzierungsinstrumente jeweils am besten geeignet sind. Dabei wird auch kritisch betrachtet, inwiefern das Lebenszyklusmodell eine praxisnahe Abbildung der Realität darstellt und welche Einschränkungen es besitzt.
4. Kreditfinanzierung und deren Eignung für deutsche Start-ups: Das Kapitel behandelt verschiedene Formen der Kreditfinanzierung für Start-ups, darunter Bankkredite, Förderkredite und Crowdlending. Es wird im Detail auf die jeweiligen Vor- und Nachteile eingegangen und bewertet, wie gut diese Finanzierungsformen für deutsche Start-ups geeignet sind. Die Analyse berücksichtigt die strengen Kreditvergabebedingungen von Banken gegenüber jungen Unternehmen mit geringem Sicherheitenbestand. Die Diskussion beinhaltet auch die Rolle von staatlichen Förderprogrammen und die zunehmende Bedeutung von alternativen Kreditplattformen wie Crowdlending.
5. Beteiligungsfinanzierung und deren Eignung für deutsche Start-ups: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Beteiligungsfinanzierung als eine wichtige Finanzierungsquelle für Start-ups. Es untersucht verschiedene Formen der Beteiligungsfinanzierung, darunter Venture Capital, Business Angels, Crowdinvesting und öffentliche Fördermittel. Für jede Form werden die spezifischen Merkmale, Vorteile und Nachteile detailliert beschrieben und die Eignung für die Finanzierung deutscher Start-ups bewertet. Die Analyse berücksichtigt die unterschiedlichen Investitionsstrategien und die jeweiligen Anforderungen an die Start-ups.
6. Mezzanine-Finanzierung und deren Eignung für deutsche Start-ups: In diesem Kapitel wird die Mezzanine-Finanzierung als hybride Finanzierungsform zwischen Fremd- und Eigenkapital genauer betrachtet. Es werden die unterschiedlichen Arten der Mezzanine-Finanzierung (Debt und Equity Mezzanine Capital) erklärt und deren jeweilige Charakteristika analysiert. Das Kapitel bewertet die Eignung der Mezzanine-Finanzierung für deutsche Start-ups unter Berücksichtigung der spezifischen Marktbedingungen und der Risikobereitschaft der Investoren.
7. Aktueller Stand: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die aktuelle Situation der deutschen Start-up-Szene und der Start-up Finanzierung. Es analysiert aktuelle Entwicklungen und Trends in der Finanzierung von deutschen Start-ups und präsentiert Daten und Statistiken zu den verschiedenen Finanzierungsformen. Die Analyse umfasst die Entwicklung der Gründerquote, die wichtigsten Finanzierungsquellen und die Rolle von Venture Capital und anderen Investoren.
Schlüsselwörter
Start-ups, Finanzierung, Deutschland, Kreditfinanzierung, Beteiligungsfinanzierung, Mezzanine-Finanzierung, Venture Capital, Business Angels, Crowdfunding, Crowdlending, Fördermittel, Lebenszyklus, Finanzierungsrisiken, Investitionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Finanzierungsinstrumente für deutsche Start-ups
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die verschiedenen Finanzierungsinstrumente für deutsche Start-ups. Ziel ist es, einen Überblick über die verfügbaren Optionen zu geben und deren Eignung für unterschiedliche Phasen im Lebenszyklus eines Start-ups zu bewerten.
Welche Finanzierungsinstrumente werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kreditfinanzierung (Bankkredite, Förderkredite, Crowdlending), die Beteiligungsfinanzierung (Venture Capital, Business Angels, Crowdinvesting, öffentliche Fördermittel) und die Mezzanine-Finanzierung (Debt und Equity Mezzanine Capital).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand und die Vorgehensweise beschreibt. Es folgen Kapitel zu den Merkmalen von Start-ups, den Finanzierungsphasen im Lebenszyklus, den einzelnen Finanzierungsinstrumenten und dem aktuellen Stand der deutschen Start-up-Szene. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die zentralen Themenschwerpunkte sind die Eignung verschiedener Finanzierungsinstrumente für unterschiedliche Phasen des Start-up-Lebenszyklus, die spezifischen Herausforderungen der Start-up-Finanzierung in Deutschland und ein Überblick über die aktuelle Finanzierungslandschaft.
Wie wird die Eignung der Finanzierungsinstrumente bewertet?
Die Eignung der Finanzierungsinstrumente wird anhand von Vor- und Nachteilen, den spezifischen Anforderungen der Start-ups in den verschiedenen Phasen und den Marktbedingungen in Deutschland bewertet.
Welche Phasen des Start-up-Lebenszyklus werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Gründungsphase (Early-Stage), die Expansionsphase (Expansion-Stage) und die Reifephase (Later-Stage).
Welche Rolle spielen staatliche Fördermittel?
Staatliche Fördermittel werden als eine wichtige Form der Beteiligungsfinanzierung betrachtet und im Detail analysiert.
Wie wird die aktuelle Situation der deutschen Start-up-Szene dargestellt?
Das Kapitel "Aktueller Stand" bietet einen Überblick über die aktuelle Entwicklung der deutschen Start-up-Szene und die aktuelle Finanzierungssituation in Deutschland, inklusive Daten und Statistiken zu den verschiedenen Finanzierungsformen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Start-ups, Finanzierung, Deutschland, Kreditfinanzierung, Beteiligungsfinanzierung, Mezzanine-Finanzierung, Venture Capital, Business Angels, Crowdfunding, Crowdlending, Fördermittel, Lebenszyklus, Finanzierungsrisiken, Investitionen.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels zusammenfasst.
- Arbeit zitieren
- Andre Christmann (Autor:in), 2017, Finanzierungsinstrumente für deutsche Start-ups, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368396