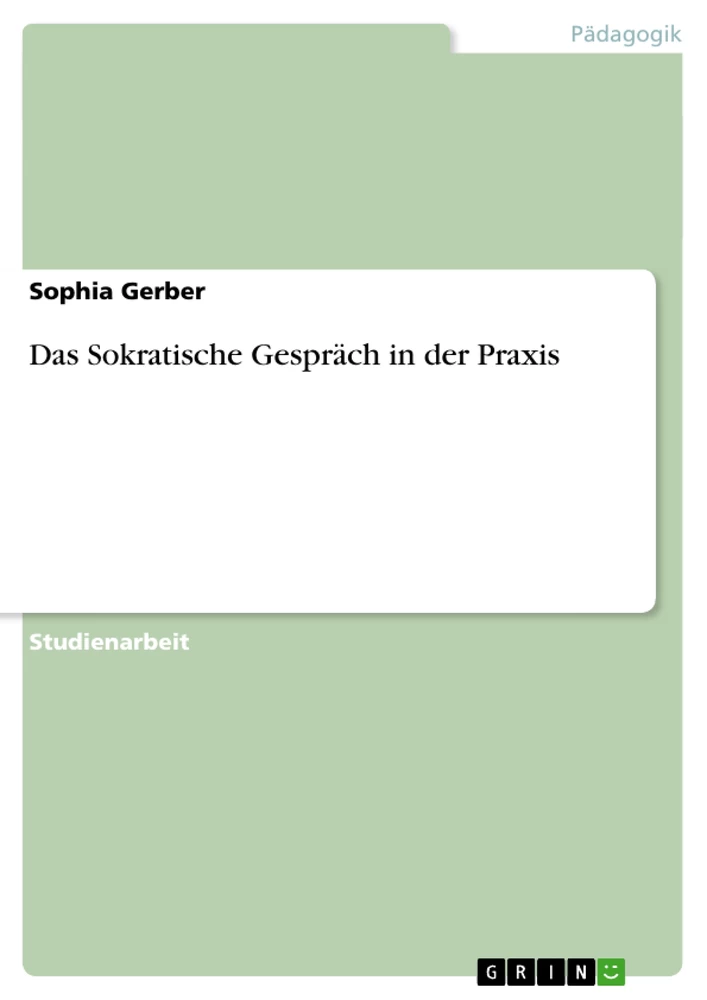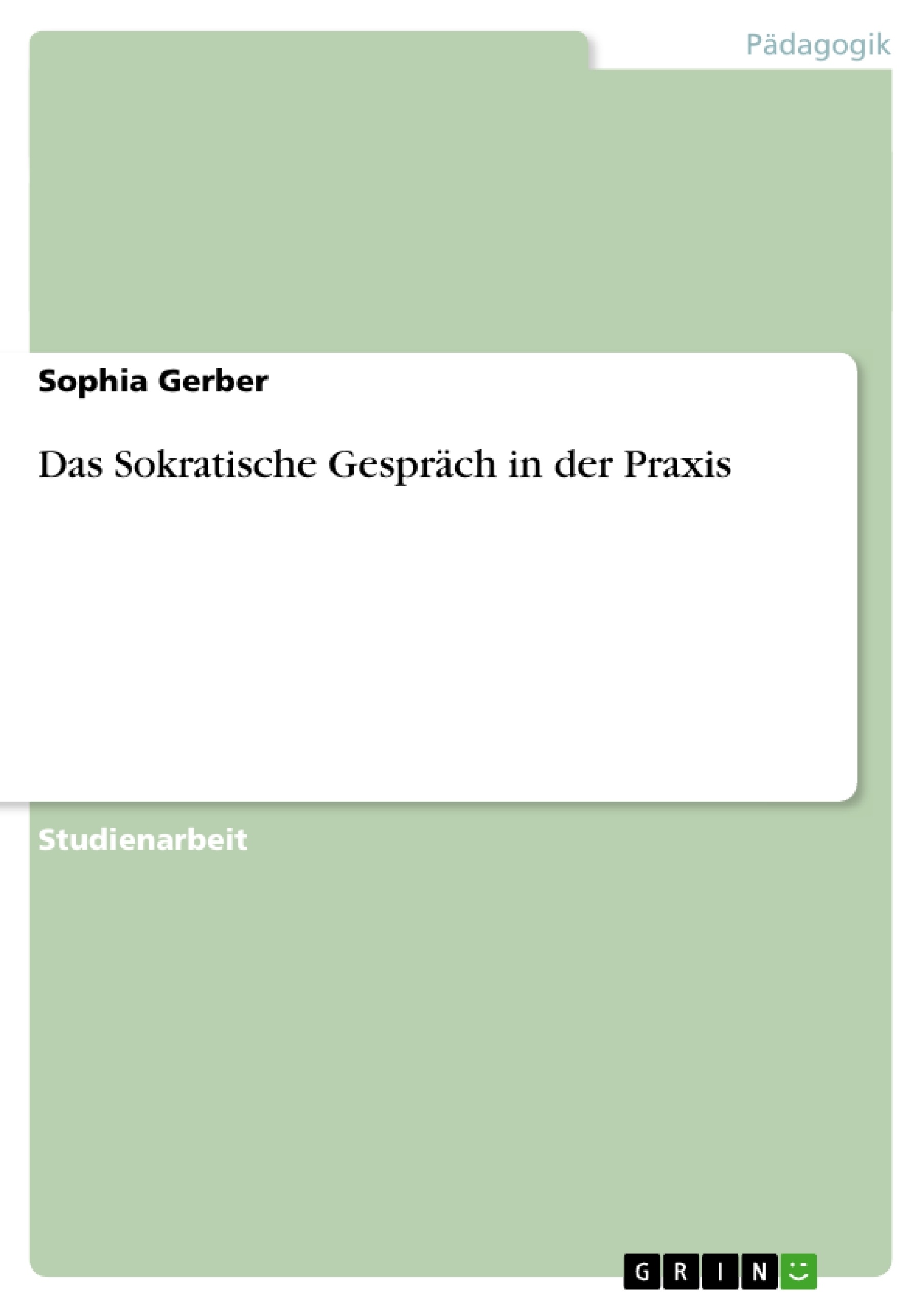Sokratische Methode im weitesten Sinne wird praktiziert, wo und wann immer Menschen durch gemeinsames Erwägen von Gründen der Wahrheit in einer Frage näher zu kommen suchen. Sokratisch würde ich ein Gespräch nennen, in dem es nicht nur sporadisch auftritt, sondern durchgängig das Gespräch bestimmt; ein Gespräch, in dem durchgängig ein gemeinsames Erwägen von Gründen stattfindet.
Das Sokratische Gespräch als Unterrichtsmethode entspricht in vielerlei Hinsicht den didaktischen Prinzipien Martin Wagenscheins, denn es ist „genetisch“, insofern es sich aus der Entstehung eines Problems ergibt, es ist „sokratisch“, insofern der Gesprächsleiter fragend den Teilnehmern beim eigenen Entdeckungsprozess hilft, und es ist „exemplarisch“, insofern an alltäglichen Fallerlebnissen das philosophische Allgemeine ergründet wird. Im Folgenden sollen zunächst die allgemeinen Phasen sowie die Anforderungen sowohl an die Gesprächsleiter als auch an die Teilnehmer dargestellt werden. Darauf erfolgt exemplarisch auszugsweise ein Protokoll eines Seminarversuchs, bei dem Studenten der Universität Rostock ein Sokratisches Gespräch zum Thema „Was ist Glück?“ durchgeführt haben. Dieses soll schließlich ausgewertet und Vor- und Nachteile der Unterrichtsmethode aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Phasen des Sokratischen Gesprächs
- 2. Anforderungen des Sokratischen Gesprächs
- 3. Fallbeispiel: Sokratisches Gespräch zum Thema „Was ist Glück?“
- 4. Vor- und Nachteile des Sokratischen Gesprächs
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Anwendung des Sokratischen Gesprächs als Unterrichtsmethode. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse und Darstellung der Methode, sowie deren praktische Anwendung im Rahmen eines Seminarversuchs zum Thema „Was ist Glück?".
- Phasen des Sokratischen Gesprächs
- Anforderungen an die Gesprächsleiter und Teilnehmer
- Praktische Anwendung im Seminarversuch
- Vor- und Nachteile des Sokratischen Gesprächs
- Bezug zu den didaktischen Prinzipien von Martin Wagenschein
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema des Sokratischen Gesprächs ein und definiert dessen Bedeutung. Sie stellt einen Bezug zu den didaktischen Prinzipien von Martin Wagenschein her.
1. Phasen des Sokratischen Gesprächs
Dieses Kapitel beschreibt die idealtypischen Phasen des Sokratischen Gesprächs, von der Themenstellung bis zur Konsensfindung. Dabei werden konkrete Schritte und Vorgehensweisen erläutert.
2. Anforderungen des Sokratischen Gesprächs
Das Kapitel beleuchtet die Anforderungen, die an die Teilnehmer und den Leiter eines Sokratischen Gesprächs gestellt werden. Es werden wichtige Fähigkeiten und Verhaltensweisen hervorgehoben.
3. Fallbeispiel: Sokratisches Gespräch zum Thema „Was ist Glück?“
Dieses Kapitel präsentiert ein Fallbeispiel, das die praktische Anwendung des Sokratischen Gesprächs in einem Seminarversuch zum Thema „Was ist Glück?" veranschaulicht. Es werden Auszüge aus einem Protokoll des Gesprächs dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf das Sokratische Gespräch als Unterrichtsmethode, dessen Phasen, Anforderungen und praktischen Anwendungen. Zentrale Themen sind die didaktischen Prinzipien von Martin Wagenschein, philosophische Reflexion und die Suche nach gemeinsamen Einsichten durch gemeinsames Erwägen von Gründen. Das Beispiel des Seminarversuchs zum Thema „Was ist Glück?" verdeutlicht die praktische Umsetzung der Methode.
- Quote paper
- Sophia Gerber (Author), 2004, Das Sokratische Gespräch in der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36844