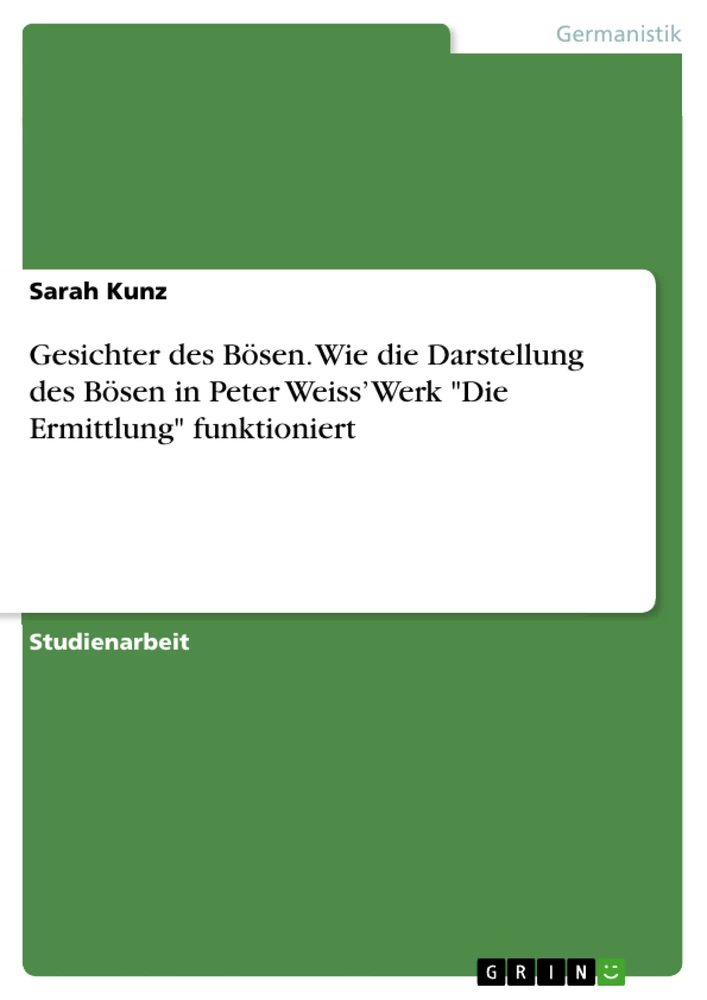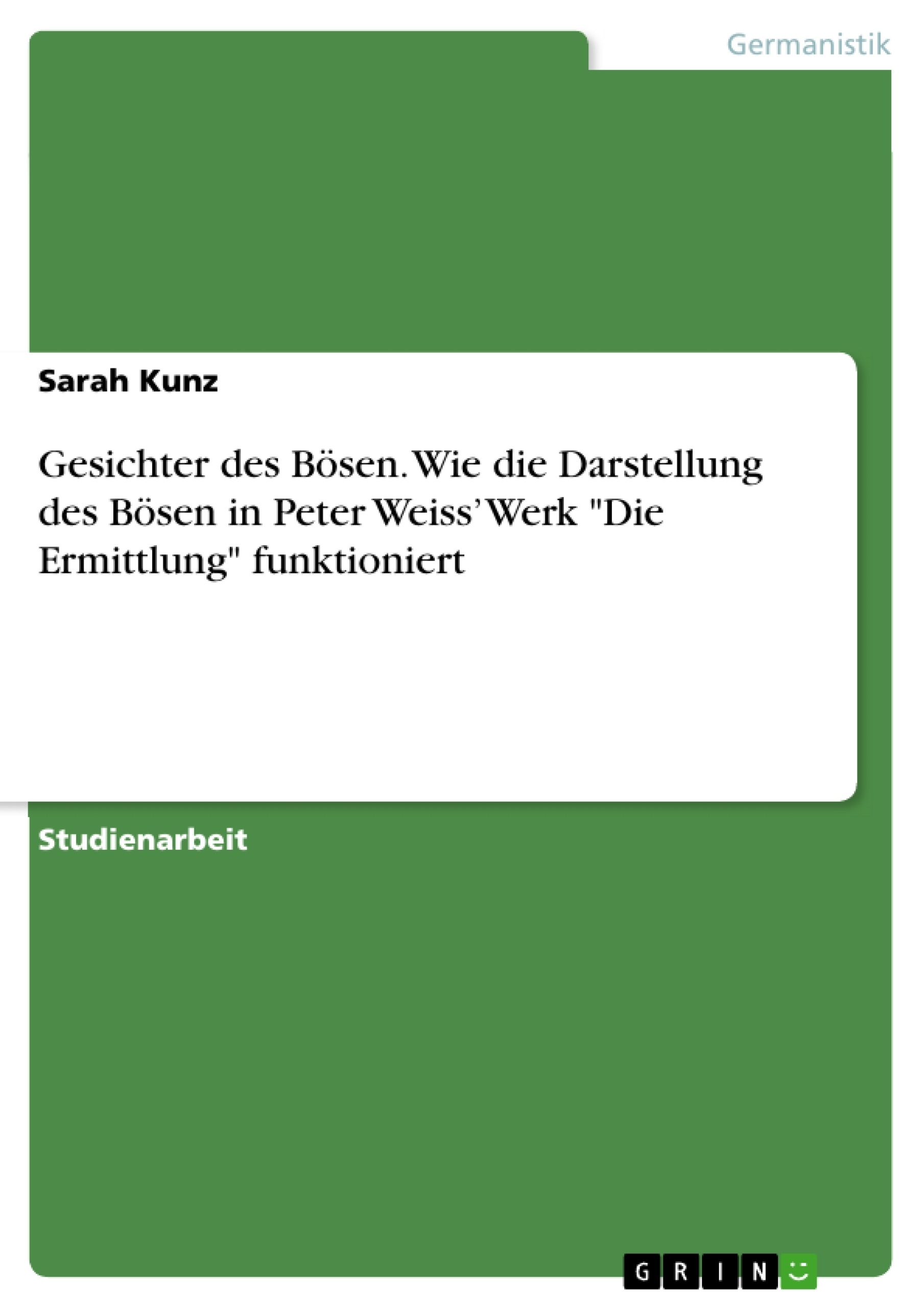Durch Taten, Worte und Charaktere wird das Böse lebendig gemacht und nimmt am Handlungsstrang teil. Unter anderem ist das Böse auch in Peter Weiss‘ "Die Ermittlung" zu finden, einem dokumentarischen Theater über die Frankfurter Prozesse. Das Böse ist in diesem Oratorium allgegenwärtig. Vor allem lässt es sich in den Täterfiguren, zu deren Anklagen mehrere Zeugen herbeigerufen werden, beobachten. Die grausamen Taten der SS-Besatzung machen die Figuren selbst zur Verkörperung des Bösen und spiegeln die Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges. Ziel dieser Arbeit ist es, die Erscheinung des Bösen aufzuzeigen und zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Definition „das Böse“
- 3. Das Böse in Die Ermittlung
- 3.1 Darstellung im Gericht
- 3.2 Darstellung durch Erzählungen der Zeugen
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Bösen in Peter Weiss' Stück „Die Ermittlung“. Ziel ist die Analyse der Erscheinungsform des Bösen im Kontext des dokumentarischen Theaters und seiner Wirkung auf den Zuschauer. Dabei wird die Frage untersucht, wie die Grausamkeit der Nazizeit allein durch die sprachliche Darstellung vermittelt wird.
- Definition des Bösen aus philosophischer und theologischer Sicht
- Darstellung des Bösen in „Die Ermittlung“
- Die Rolle der Zeugenaussagen
- Die Wirkung der statischen Darstellung
- Die ethischen Implikationen der Darstellung von Grausamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Darstellung des Bösen in Peter Weiss' "Die Ermittlung" in den Mittelpunkt. Sie verweist auf die Definition des Bösen in Goethes Faust und dessen Manifestation in verschiedenen literarischen Werken. Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung des Bösen in "Die Ermittlung" zu analysieren und aufzuzeigen, wie die Grausamkeiten der Nazizeit durch die rein sprachliche Gestaltung des Stücks vermittelt werden. Der Verzicht auf einen traditionellen Handlungsstrang und die Fokussierung auf die Gerichtsverhandlung werden als stilistische Mittel zur Vermittlung des Grauens hervorgehoben. Die ethische Problematik der Darstellung von Barbarei und die Auseinandersetzung mit Adornos Aussage über die Barbarität des Schreibens nach Auschwitz bilden den abschließenden Gedanken der Einleitung.
2. Definition „Das Böse“: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen philosophischen und theologischen Definitionen des Bösen. Es wird Immanuel Kants Auffassung vom radikalen Bösen als angeborenem Hang des Menschen zum Bösen vorgestellt, wobei die Betonung auf der menschlichen Willensfreiheit liegt. Im Kontrast dazu wird Hannah Arendts Konzept der Banalität des Bösen erläutert, das das Böse nicht als tiefgründig, sondern als Folge von Unwissenheit und mangelndem Denken darstellt. Schließlich wird der Teufel als religiöses Symbol des Bösen betrachtet, das die negativen Aspekte der menschlichen Natur verkörpert und den angeborenen Hang zum Bösen aus theologischer Perspektive erklärt.
3. Das Böse in Die Ermittlung: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Bösen in Peter Weiss’ "Die Ermittlung". Es untersucht, wie das Böse durch die Darstellung der Gerichtsverhandlung und die Erzählungen der Zeugen vermittelt wird. Die grausamen Taten der SS-Besatzung werden als Verkörperung des Bösen dargestellt und spiegeln die Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs wider. Die Kapitel 3.1 und 3.2 werden nicht einzeln zusammengefasst, sondern im Kontext des gesamten Kapitels betrachtet, indem die Darstellung im Gericht und die Zeugenaussagen als zwei Seiten derselben Medaille gesehen werden: die sprachliche Konstruktion der Verbrechen und deren Auswirkungen.
Schlüsselwörter
Peter Weiss, Die Ermittlung, Das Böse, Darstellung des Bösen, Dokumentartheater, Nazizeit, Grausamkeit, Zeugenaussagen, Frankfurter Prozesse, Immanuel Kant, Hannah Arendt, Radikalität des Bösen, Banalität des Bösen, Theologische Perspektive.
Häufig gestellte Fragen zu Peter Weiss' "Die Ermittlung"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung des Bösen in Peter Weiss' Drama "Die Ermittlung". Der Fokus liegt auf der sprachlichen Gestaltung des Stücks und wie diese die Grausamkeiten der Nazizeit vermittelt, insbesondere im Kontext des dokumentarischen Theaters und dessen Wirkung auf den Zuschauer.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Definitionen des Bösen aus philosophischer und theologischer Sicht (Kant, Arendt, theologische Perspektive des Teufels), die Darstellung des Bösen in "Die Ermittlung", die Rolle der Zeugenaussagen, die Wirkung der statischen Darstellung des Stücks, und die ethischen Implikationen der Darstellung von Grausamkeit. Die Arbeit untersucht, wie die Grausamkeit allein durch die sprachliche Darstellung vermittelt wird und setzt sich mit Adornos Aussage über die Barbarität des Schreibens nach Auschwitz auseinander.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur Definition des Bösen, ein Kapitel zur Analyse der Darstellung des Bösen in "Die Ermittlung" (mit Unterkapiteln zu Gerichtsdarstellung und Zeugenaussagen) und einen Schluss. Die Kapitelzusammenfassungen geben einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche philosophischen und theologischen Perspektiven auf das Böse werden betrachtet?
Die Arbeit vergleicht Kants Auffassung vom radikalen Bösen als angeborenem Hang des Menschen mit Arendts Konzept der Banalität des Bösen. Zusätzlich wird der Teufel als religiöses Symbol des Bösen betrachtet.
Wie wird das Böse in "Die Ermittlung" dargestellt?
Das Böse wird in "Die Ermittlung" durch die Darstellung der Gerichtsverhandlung und die Zeugenaussagen vermittelt. Die grausamen Taten der SS werden als Verkörperung des Bösen dargestellt, wobei die sprachliche Konstruktion der Verbrechen und deren Auswirkungen im Mittelpunkt stehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Peter Weiss, Die Ermittlung, Das Böse, Darstellung des Bösen, Dokumentartheater, Nazizeit, Grausamkeit, Zeugenaussagen, Frankfurter Prozesse, Immanuel Kant, Hannah Arendt, Radikalität des Bösen, Banalität des Bösen, Theologische Perspektive.
- Quote paper
- Sarah Kunz (Author), 2016, Gesichter des Bösen. Wie die Darstellung des Bösen in Peter Weiss’ Werk "Die Ermittlung" funktioniert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368596