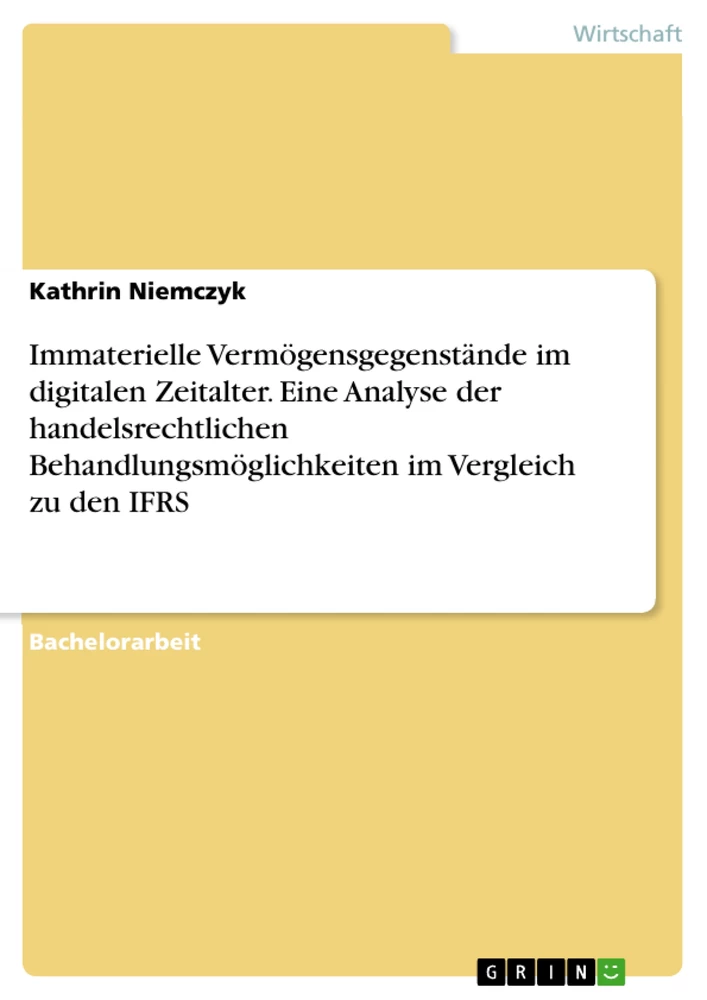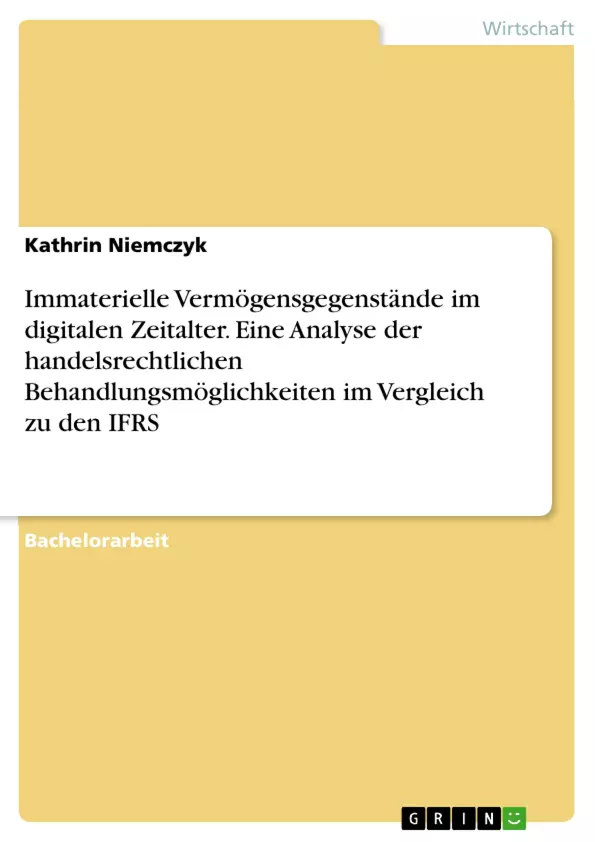In dieser Arbeit soll die Frage geklärt werden, in welchem Maß die unterschiedlichen Rechnungslegungssysteme in der Lage sind, immaterielle Vermögensgegenstände sachgerecht darzustellen und warum Abweichungen von diesem Ziel teilweise trotzdem sinnvoll sind bzw. wie diese von den Gesetzgebern begründet werden.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der bilanziellen Behandlung von immateriellen Vermögensgegenständen bzw. Vermögenswerten. Zum einen werden die Regelungen des HGB und den IFRS aufgezeigt und zum anderen werden die Regelungen dieser beiden Normen miteinander verglichen, um eine sachgerechte Einschätzung über die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse zu treffen.
Durch die zunehmende Digitalisierung der Umwelt nimmt die Bedeutung immaterieller Vermögensgegenstände stetig zu. Auch wird der Anteil der materiellen Gegenstände bei Forschungs- und Entwicklungsgesellschaften durch die große Rolle des Technologie-, Forschungs- und Informationssektors immer kleiner. Deutschland wird mehr und mehr zu einer Wissensgesellschaft und Wissen ist abstrakt gesehen ein immaterielles Gut. Daher rührt unter anderem die zunehmende Relevanz der immateriellen Vermögensgegenstände.
Die Internationalisierung spielt auch zunehmend eine entscheidende Rolle für die nationale Rechnungslegung. Ziel der Rechnungslegung, egal ob im Hinblick auf die nationale oder internationale, ist, einen funktionierenden Kapitalmarkt durch Informationssymmetrie zu unterstützen. Die Stakeholder brauchen ausreichend Informationen um auf dem Kapitalmarkt entscheiden zu können in welches Unternehmen sie investieren sollen, um die gewünschte Rendite zu erzielen. Ziel der Gesetzgeber sollte sein, dass diese benötigte Informationssymmetrie entsteht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Definition und Einordnung
- 2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände bzw. Vermögenswerte
- 2.2 E-Books
- 2.3 Bitcoins
- 2.4 Geschäfts- oder Firmenwert
- 3. Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach Handelsrecht
- 3.1 Ansatz, Aktivierung
- 3.1.1 Abstrakte Aktivierungsfähigkeit
- 3.1.2 Konkrete Aktivierungsfähigkeit
- 3.1.2.1 Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände
- 3.1.2.2 Entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände
- 3.2 Folgebewertung
- 3.2.1 Planmäßige Abschreibung
- 3.2.2 Außerplanmäßige Abschreibung
- 3.3 Ausweis und Anhangangaben
- 4. Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach IAS/IFRS
- 4.1 Ansatz, Aktivierung
- 4.1.1 Abstrakte Aktivierungsfähigkeit
- 4.1.2 Konkrete Aktivierungsfähigkeit
- 4.1.2.1 Allgemeine Ansatzkriterien für Vermögenswerte
- 4.1.2.2 Erweiterte Ansatzkriterien für selbsterstellte Vermögenswerte
- 4.1.3 Bewertungsmöglichkeiten des Zugangswertes
- 4.1.3.1 Einzeln erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
- 4.1.3.2 Erwerb immaterieller Vermögenswerte im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses
- 4.1.3.3 Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte
- 4.2 Folgebewertung
- 4.2.1 Anschaffungskostenmodell
- 4.2.2 Neubewertungsmodell
- 4.2.3 Planmäßige Abschreibung
- 4.2.4 Wertberichtigungen
- 4.3 Ausweis und Anhangangaben
- 5. Besonderheiten des Geschäfts- oder Firmenwertes
- 5.1 Nach Handelsrecht
- 5.1.1 Originärer Geschäfts- oder Firmenwert
- 5.1.2 Derivativer Geschäfts- oder Firmenwert
- 5.2 Änderungen nach BilRUG
- 5.3 Nach IAS/IFRS
- 5.3.1 Derivativer Geschäfts- oder Firmenwert
- 5.3.1 Originärer Geschäfts- oder Firmenwert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die handelsrechtliche Behandlung immaterieller Vermögensgegenstände im digitalen Zeitalter und vergleicht diese mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Bilanzierungsansätze aufzuzeigen und die Herausforderungen der Bewertung immaterieller Vermögenswerte im digitalen Kontext zu beleuchten.
- Definition und Einordnung immaterieller Vermögensgegenstände im digitalen Kontext (E-Books, Bitcoins).
- Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach Handelsrecht (Ansatz, Aktivierung, Bewertung).
- Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach IAS/IFRS (Ansatz, Aktivierung, Bewertung).
- Besonderheiten der Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes.
- Vergleich der handelsrechtlichen und IFRS-konformen Bilanzierung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problemstellung der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände im digitalen Zeitalter und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Es wird die Relevanz der Thematik im Kontext der zunehmenden Digitalisierung hervorgehoben und die Notwendigkeit eines differenzierten Vergleichs zwischen nationalem Handelsrecht und internationalen IFRS-Standards betont.
2. Definition und Einordnung: Dieses Kapitel definiert und ordnet immaterielle Vermögensgegenstände ein, unter besonderer Berücksichtigung digitaler Assets wie E-Books und Bitcoins. Es beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der immateriellen und oft schwer greifbaren Natur dieser Vermögenswerte ergeben. Der Geschäfts- oder Firmenwert wird als eine besondere Form immaterieller Vermögenswerte eingeführt und seine Bedeutung für die Unternehmensbewertung herausgestellt.
3. Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach Handelsrecht: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach deutschem Handelsrecht. Es werden die Kriterien der Aktivierung, sowohl abstrakt als auch konkret, detailliert erläutert, inklusive der Unterscheidung zwischen selbst erstellten und entgeltlich erworbenen Vermögenswerten. Die verschiedenen Bewertungs- und Abschreibungsmethoden werden analysiert und ihre Anwendung im Kontext der jeweiligen Rechtslage detailliert beschrieben. Abschließend werden die notwendigen Ausweis- und Anhangangaben im Jahresabschluss beleuchtet.
4. Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach IAS/IFRS: Analog zu Kapitel 3, widmet sich dieses Kapitel der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach den internationalen IFRS-Standards. Die Darstellung folgt dem gleichen Aufbau wie im vorherigen Kapitel und vertieft die vergleichende Analyse der jeweiligen Regelungen. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ansatz- und Bewertungskriterien, den Folgebewertungsmethoden und den Anforderungen an den Ausweis im Jahresabschluss. Die komplexen Anforderungen an die Bewertung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten werden besonders hervorgehoben.
5. Besonderheiten des Geschäfts- oder Firmenwertes: In diesem Kapitel werden die Besonderheiten der Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes sowohl nach Handelsrecht als auch nach IAS/IFRS untersucht. Die Unterscheidung zwischen originärem und derivativen Geschäfts- oder Firmenwert wird erläutert und die Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) werden analysiert. Die komplexen Bewertungsaspekte und die Herausforderungen bei der Ermittlung des Geschäfts- oder Firmenwertes werden kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögensgegenstände, digitale Vermögenswerte, E-Books, Bitcoins, Geschäfts- oder Firmenwert, Handelsrecht, IFRS, Bilanzierung, Aktivierung, Bewertung, Abschreibung, Anschaffungskosten, Folgebewertung, Jahresabschluss, BilMoG, BilRUG, Unternehmenszusammenschluss.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände im digitalen Zeitalter
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit analysiert die handelsrechtliche Behandlung immaterieller Vermögensgegenstände im digitalen Zeitalter und vergleicht diese mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten beider Bilanzierungsansätze und den Herausforderungen der Bewertung immateriellen Vermögens im digitalen Kontext.
Welche immateriellen Vermögensgegenstände werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet allgemein immaterielle Vermögensgegenstände und beleuchtet speziell digitale Assets wie E-Books und Bitcoins. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Geschäfts- oder Firmenwert.
Welche Rechtsgrundlagen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach deutschem Handelsrecht mit der Bilanzierung nach International Financial Reporting Standards (IFRS).
Welche Aspekte der Bilanzierung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ansatz-, Aktivierungs- und Bewertungskriterien, die Folgebewertung (inkl. Abschreibungsmethoden), den Ausweis im Jahresabschluss und die notwendigen Anhangangaben sowohl nach Handelsrecht als auch nach IFRS. Die Auswirkungen von BilMoG und BilRUG werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird der Geschäfts- oder Firmenwert behandelt?
Der Geschäfts- oder Firmenwert wird als besondere Form immaterieller Vermögenswerte behandelt. Die Arbeit unterscheidet zwischen originärem und derivativen Geschäfts- oder Firmenwert und analysiert die komplexen Bewertungsaspekte nach Handelsrecht und IFRS.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definition und Einordnung immaterieller Vermögensgegenstände, Bilanzierung nach Handelsrecht, Bilanzierung nach IAS/IFRS und Besonderheiten des Geschäfts- oder Firmenwertes. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Immaterielle Vermögensgegenstände, digitale Vermögenswerte, E-Books, Bitcoins, Geschäfts- oder Firmenwert, Handelsrecht, IFRS, Bilanzierung, Aktivierung, Bewertung, Abschreibung, Anschaffungskosten, Folgebewertung, Jahresabschluss, BilMoG, BilRUG, Unternehmenszusammenschluss.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der handelsrechtlichen und IFRS-konformen Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte aufzuzeigen und die Herausforderungen der Bewertung im digitalen Kontext zu beleuchten.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der relevanten Rechtsvorschriften und Bilanzierungsstandards. Die Ergebnisse werden strukturiert und professionell dargestellt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich der Rechnungslegung und Unternehmensbewertung, die sich mit der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände im digitalen Kontext auseinandersetzen.
- Quote paper
- Kathrin Niemczyk (Author), 2015, Immaterielle Vermögensgegenstände im digitalen Zeitalter. Eine Analyse der handelsrechtlichen Behandlungsmöglichkeiten im Vergleich zu den IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368905