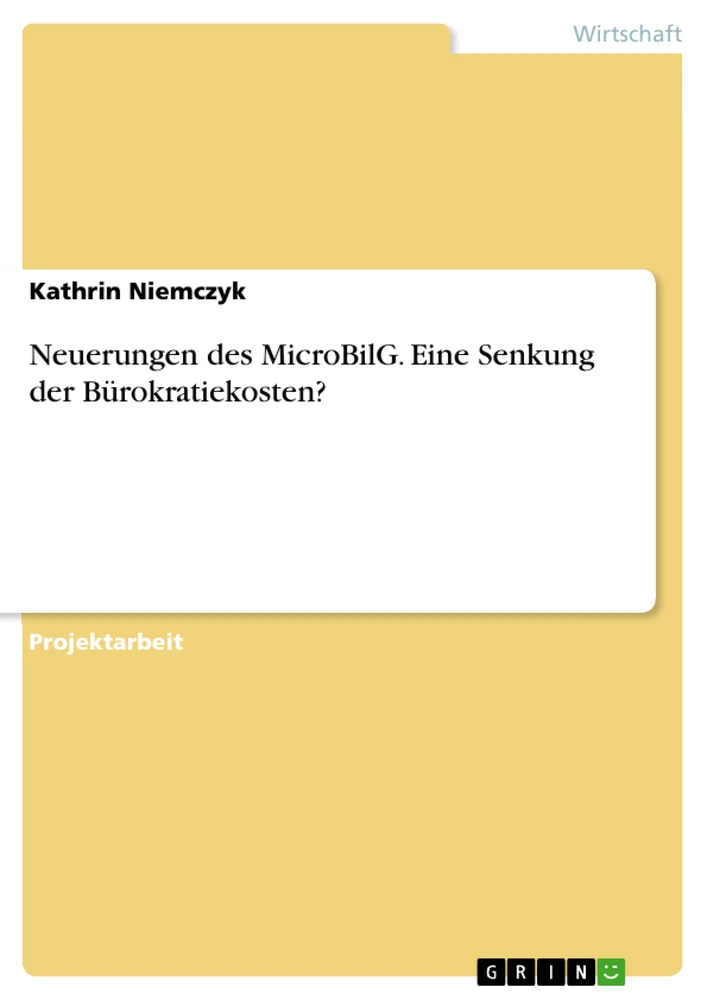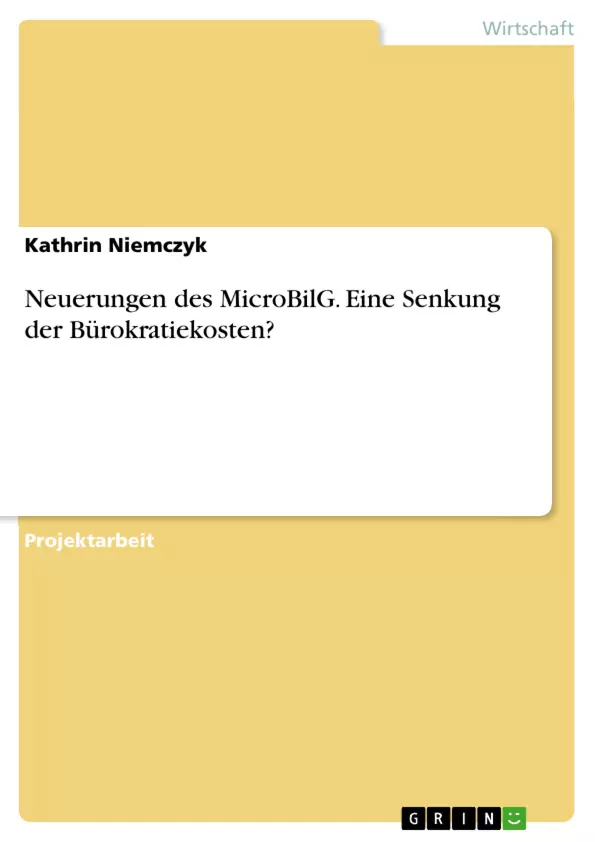In der Ausarbeitung werden Neuerungen des MicroBilG erläutert und die Erreichung der Ziele der Regierung kritisch hinterfragt bzw. beurteilt.
In Fachkreisen wird kontrovers diskutiert, ob die angestrebten Ziele des MicroBilG auch wirklich erreicht werden. Denn viele Fachleute bemängeln, dass die Anwendung der Neuregelungen lediglich zu „wertmäßigen Bilanzveränderungen“ und „negativen Auswirkungen aus Sicht der Abschlussadressaten“ führe und die Inanspruchnahme der Erleichterungen nur bei einigen Sachverhalten sinnvoll sei.
Das Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG) wurde eingeführt, um den mit der Rechnungslegung verbundenen Verwaltungsaufwand der Kleinstunternehmen durch Herabsetzung der Anforderungen an den Jahresabschluss zu senken, damit auch langfristig die Bürokratiekosten zu minimieren und schließlich summa summarum die europäische Wirtschaft anzukurbeln. Nicht zuletzt soll die Kostenentlastung auch den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und dadurch zunehmenden Wohlstand in der Gesellschaft und eine Verbesserung der Lebensqualität hervorrufen.
Mit dem MicroBilG wurde die Richtlinie 2012/6EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 14. März 2012 zur Änderung der Richtline 78/660/EWG über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen hinsichtlich Kleinstbetrieben in deutsches Recht umgesetzt. Diese Umsetzung gelang sehr schnell, wenn man bedenkt, dass der Referentenentwurf des deutschen Bundesministeriums der Justiz erst am 17. Juli 2012 vorgelegt wurde.
Dies war auch Ziel der EU, da sie durch die Richtlinie einen Teil ihrer Verschärfungen aus den Vorjahren, die zu erheblichen Unruhen im Mittelstand geführt hatten, zurückgenommen hat.
Bis zum MicroBilG unterlagen Kleinstbetriebe umfangreichen Vorgaben für die Rechnungslegung, soweit sie als Kapitalgesellschaft oder Personenhandelsgesellschaft ohne voll haftende natürliche Person organisiert waren. Einzelkaufleute wurden bereits durch das BilMoG vom 25. Mai 2009 von der Buchführung und der Pflicht zur Aufstellung von Jahresabschlüssen befreit, wenn sie bestimmte Größenmerkmale der §§ 241a und 242 Abs. 4 HGB nicht überschritten haben. Der Entlastung von Kleinstbetrieben standen zu dem Zeitpunkt jedoch noch europarechtliche Vorgaben entgegen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Vom BilMoG zum MicroBilG
- 2. Inkrafttreten
- 3. Anwendungsbereich
- 4. Erleichterungen
- 4.1 Bilanzgliederung wird zusammengefasst
- 4.2 Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wird verkürzt
- 4.3 Anhang kann entfallen
- 4.4 Hinterlegung statt Offenlegung
- 4.5 Erleichterungen für Konzerntochterunternehmen von Auslandsmüttern
- 5. Problembereiche in der Umsetzung
- 5.1 Allgemein
- 5.2 Verringerter Aufwand - auch in der Praxis?
- 5.2.1 Bilanz
- 5.2.2 Gewinn- und Verlustrechnung
- 5.2.3 Anhang
- 5.2.4 Hinterlegung
- 5.2.5 Konzerntochterunternehmen von Auslandsmüttern
- 5.2.6 Umstellungsaufwand
- 5.3 Wertung aus Sicht des Abschlussadressaten
- 6. Fazit
- 6.1 Zusammenfassung
- 6.2 Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Projektarbeit befasst sich mit dem Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG). Sie untersucht die Hintergründe, den Anwendungsbereich und die Auswirkungen des Gesetzes auf die Rechnungslegung von Kleinstkapitalgesellschaften.
- Entwicklung und Hintergründe des MicroBilG
- Anwendungsbereich und wesentliche Inhalte des Gesetzes
- Einfluss des MicroBilG auf die Rechnungslegung von Kleinstkapitalgesellschaften
- Bewertung der Auswirkungen des Gesetzes aus Sicht der Unternehmen und der Adressaten der Rechnungslegung
- Potenzielle Problemfelder in der Umsetzung des MicroBilG
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und erläutert den historischen Kontext der Entwicklung des MicroBilG aus dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG). Es folgt eine detaillierte Analyse des Anwendungsbereichs des Gesetzes und der spezifischen Erleichterungen für die Rechnungslegung von Kleinstkapitalgesellschaften. Anschließend werden potenzielle Problemfelder in der Umsetzung des MicroBilG beleuchtet. Die Arbeit endet mit einer Bewertung der Auswirkungen des Gesetzes aus Sicht der Unternehmen und der Adressaten der Rechnungslegung.
Schlüsselwörter
Kleinstkapitalgesellschaften, Bilanzrechtsänderungsgesetz, MicroBilG, Rechnungslegung, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Erleichterungen, Hinterlegung, Konzerntochterunternehmen, Auslandsmütter, Adressaten der Rechnungslegung, Problemfelder, Umsetzung
Häufig gestellte Fragen
Was ist das MicroBilG?
Das Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz dient der Entlastung kleiner Unternehmen durch vereinfachte Anforderungen an den Jahresabschluss.
Welche Erleichterungen bietet das MicroBilG?
Unternehmen können die Bilanzgliederung zusammenfassen, die GuV verkürzen, auf den Anhang verzichten und den Abschluss hinterlegen statt offenlegen.
Wer gilt als Kleinstkapitalgesellschaft?
Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei Bilanzsumme, Umsatzerlösen und Mitarbeiterzahl (gemäß Richtlinie 2012/6/EU) nicht überschreiten.
Werden die Bürokratiekosten durch das MicroBilG wirklich gesenkt?
Das wird kontrovers diskutiert. Kritiker bemängeln den Umstellungsaufwand und negative Auswirkungen auf die Informationsqualität für Banken und Gläubiger.
Was ist der Unterschied zwischen Hinterlegung und Offenlegung?
Hinterlegung bedeutet, dass der Abschluss beim Bundesanzeiger gespeichert wird, aber nicht für jedermann sofort öffentlich einsehbar ist wie bei der Offenlegung.
- Arbeit zitieren
- Kathrin Niemczyk (Autor:in), 2013, Neuerungen des MicroBilG. Eine Senkung der Bürokratiekosten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368907