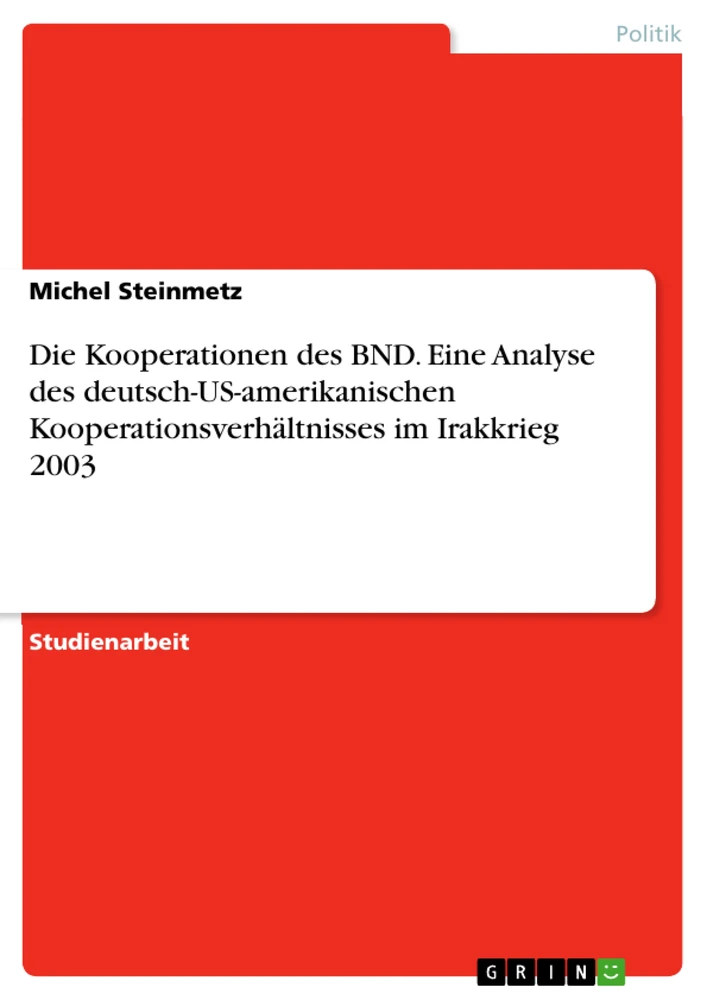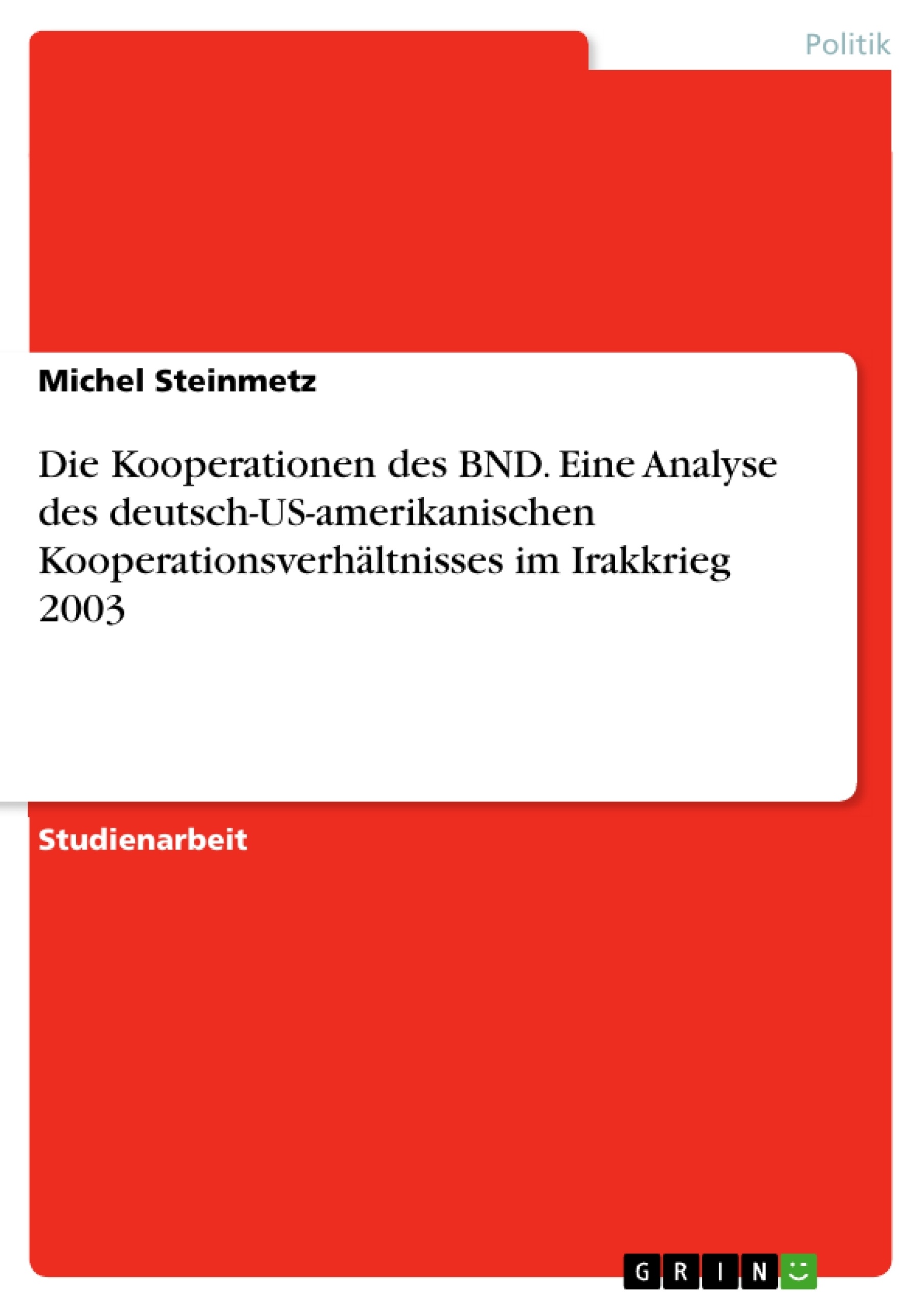In dieser Arbeit werde ich untersuchen, inwieweit Kooperationen im Auftragsprofil des BND vorgesehen sind. Dabei gehe ich nicht auf laufende Kooperationen ein, sondern werde darstellen, wie der BND generell in Bezug auf Kooperationen mit ausländischen Geheimdiensten ausgerichtet ist. Im Anschluss werde ich ein konkretes Beispiel solch eines Kooperationsverhältnisses beleuchten. Ich werde hierbei versuchen die Frage zu beantworten, wie das Kooperationsverhältnis des BND mit US-amerikanischen Geheimdiensten im Irakkrieg 2003 aussah. Dabei werden vor allem die Art und der Umfang dieser Zusammenarbeit untersucht.
Schlussendlich werde ich der Frage nachgehen, ob der BND in diesem Zusammenhang von der Bundesregierung für deren außenpolitische Ziele instrumentalisiert worden ist. Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang, inwieweit es überhaupt zu einer Instrumentalisierung kommen kann, wenn der BND dem Kanzleramt und damit der Regierung unterstellt ist. Darüber hinaus ist zu klären, ob der Einsatz des BND in dieser Art und in diesem Umfang von der Bundesregierung intendiert war.
In der heutigen Welt, in der durch das Aufkommen neuer Technologien immer mehr Vernetzungen entstehen, steigt auch die Unübersichtlichkeit. In Zeiten wie diesen hat sich die Information zu einem der wertvollsten Güter entwickelt. Die Händler dieser Informationen sind unter anderem Geheim- und Nachrichtendienste.
Damit sie über ausreichende Informationen verfügen können, werden Kooperationen untereinander gebildet. Diese Kooperationen sind oftmals Aufhänger der medialen Empörung über die Arbeit der Geheim- und Nachrichtendienste. Sie analysieren zu können, ist daher von erheblicher Relevanz, um diese Berichte umfassend beurteilen zu können, jedoch aufgrund der schwierigen Informationslage nicht immer möglich. Mit dieser Arbeit möchte ich einen Beitrag dazu leisten, die Informationslage ein wenig zu verbessern und so die Möglichkeit geben, Berichte über geheimdienstliche Tätigkeiten differenzierter bewerten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- INWIEWEIT SIND KOOPERATIONEN MIT GEHEIMDIENSTEN ANDERER LÄNDER IM AUFTRAGSPROFIL DES BND VORGESEHEN?
- Geschichtliche Einführung
- Das Auftragsprofil des BND
- Zwischenfazit
- WIE SAH DAS KOOPERATIONSVERHÄLTNIS DES DEUTSCHEN UND DER US-AMERIKANISCHEN GEHEIMDIENSTE WÄHREND DES IRAKKRIEGES 2003 AUS?
- Nachrichtendienstlicher Status quo im Irak 2002/2003
- Das deutsch-US-amerikanische Kooperationsverhältnis in der Empirie
- Zwischenfazit
- WURDE DER BND HIERBEI VON DER BUNDESREGIERUNG FÜR DEREN AUBENPOLITISCHE ZIELE INSTRUMENTALISIERT?
- Der Begriff des Instrumentalisierens
- Außenpolitische Ziele der Bundesregierung
- Instrumentalisierung oder einfache Ausübung exekutiver Gewalt?
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das deutsch-US-amerikanische Kooperationsverhältnis im Kontext des Irakkriegs 2003, wobei der Fokus auf der Rolle des Bundesnachrichtendienstes (BND) liegt. Dabei werden die Frage untersucht, inwieweit Kooperationen mit Geheimdiensten anderer Länder im Auftragsprofil des BND vorgesehen sind, wie dieses Verhältnis während des Irakkriegs konkret aussah, und ob der BND dabei von der Bundesregierung für deren außenpolitische Ziele instrumentalisiert wurde.
- Das Auftragsprofil des BND und seine historische Entwicklung
- Die Bedeutung von Kooperationen zwischen Geheimdiensten in der heutigen Welt
- Die konkrete Ausgestaltung des Kooperationsverhältnisses zwischen dem BND und US-amerikanischen Geheimdiensten während des Irakkriegs 2003
- Die Rolle der Bundesregierung bei der Instrumentalisierung von Geheimdiensten
- Die Frage, ob und inwieweit der BND im Irakkrieg 2003 für außenpolitische Ziele instrumentalisiert wurde
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Untersuchung von Geheimdienstkooperationen im Kontext der Informationsgesellschaft heraus und erläutert die Forschungsfrage, die sich auf die Rolle des BND im Irakkrieg 2003 fokussiert.
- Inwieweit sind Kooperationen mit Geheimdiensten anderer Länder im Auftragsprofil des BND vorgesehen?: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entstehung des BND und analysiert dessen Auftragsprofil, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit von Kooperationen mit ausländischen Geheimdiensten.
- Wie sah das Kooperationsverhältnis des Deutschen und der US-amerikanischen Geheimdienste während des Irakkrieges 2003 aus?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Nachrichtendienstlichen Status quo im Irak vor dem Krieg und analysiert die konkrete Zusammenarbeit zwischen dem BND und US-amerikanischen Geheimdiensten während des Irakkriegs 2003.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Geheimdienstkooperation, Bundesnachrichtendienst (BND), Irakkrieg 2003, deutsch-US-amerikanisches Verhältnis, Instrumentalisierung, Außenpolitik, Auftragsprofil, Informationsgewinnung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Geheimdienstkooperationen im Irakkrieg 2003?
Trotz der offiziellen Ablehnung des Krieges durch die Bundesregierung gab es eine nachrichtendienstliche Zusammenarbeit zwischen dem BND und US-amerikanischen Diensten.
Ist Kooperation mit ausländischen Diensten Teil des BND-Auftrags?
Ja, internationale Kooperationen sind fest im Auftragsprofil des BND verankert, um den notwendigen Informationsfluss in einer vernetzten Welt sicherzustellen.
Wurde der BND von der Bundesregierung instrumentalisiert?
Die Arbeit untersucht, ob der Einsatz des BND im Irak über die normale exekutive Gewalt hinausging, um außenpolitische Ziele hinter den Kulissen zu verfolgen.
Wie ist der BND organisatorisch unterstellt?
Der Bundesnachrichtendienst ist dem Bundeskanzleramt unterstellt und unterliegt somit der direkten Kontrolle der Regierung.
Warum sind Informationen für Geheimdienste heute so wertvoll?
In einer unübersichtlichen, technologisch vernetzten Welt ist Information ein entscheidendes Gut für die nationale Sicherheit und politische Entscheidungsfindung.
- Quote paper
- Michel Steinmetz (Author), 2016, Die Kooperationen des BND. Eine Analyse des deutsch-US-amerikanischen Kooperationsverhältnisses im Irakkrieg 2003, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369105