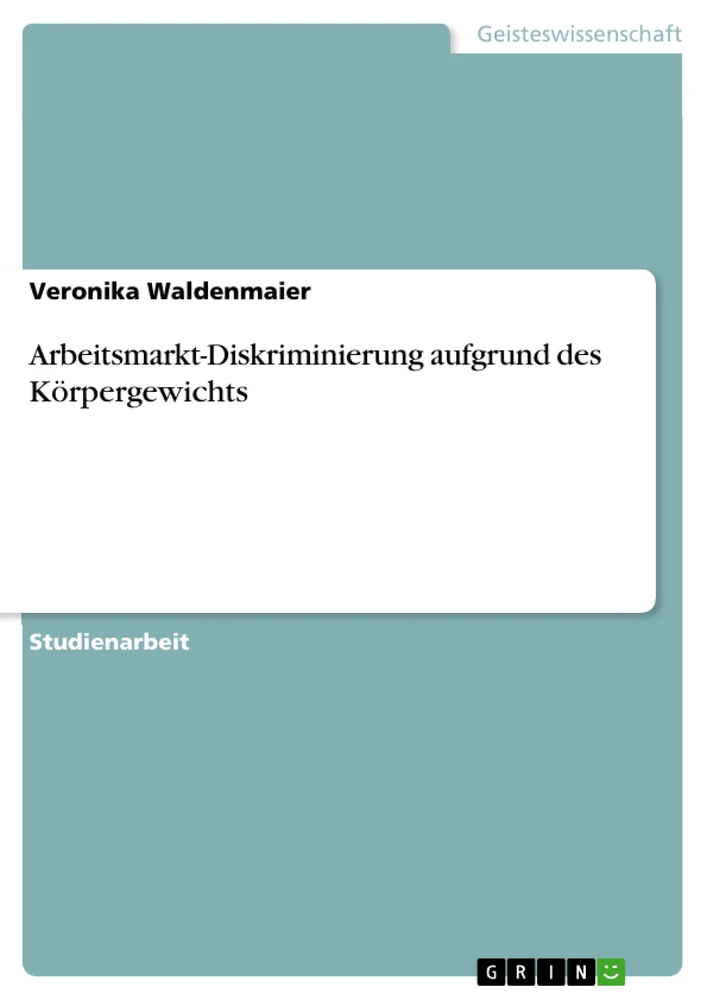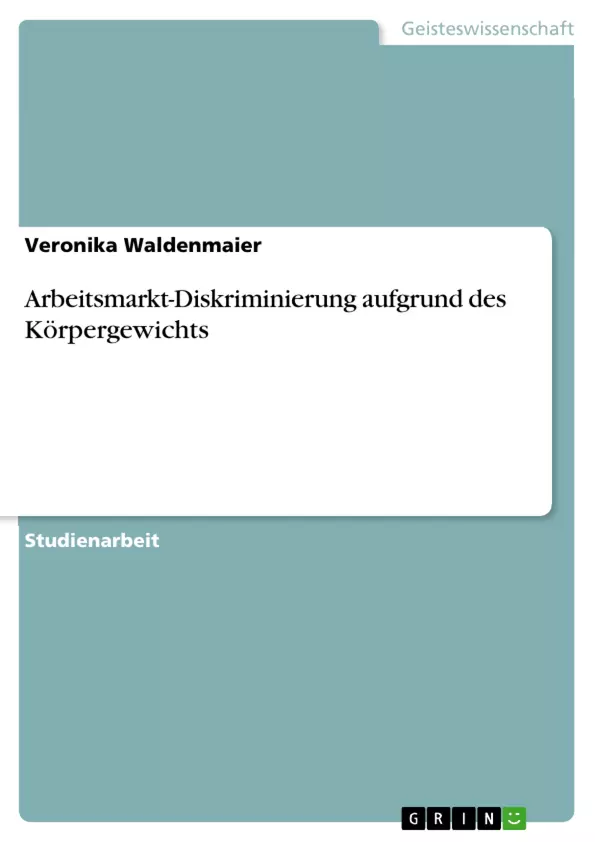Menschen wollen grundsätzlich die Möglichkeit haben, erfolgreich im Berufs- und Privatleben zu sein. Der Arbeitsmarkt stellt einen Bereich dar, in dem sich Individuen beweisen können und Input für ihren Selbstwert beziehen. Werden sie dabei ohne berechtigte Gründe eingeschränkt oder aufgrund individueller Eigenschaften benachteiligt, wird dies als ungerecht aufgefasst und stellt Diskriminierung dar.
Diskriminierung beruht oftmals auf Vorurteilen und kann aufgrund des Körpergewichts erfolgen und wirkt sich auf die Lebensbereiche Schule, berufliche Laufbahn, Gesundheitsvorsoge, zwischenmenschliche Beziehungen und psychisches Wohlbefinden aus. Der "Arbeitsmarkt" produziert Ungleichheiten, die auch gesellschaftliche Auswirkungen haben kann, wenn man bedenkt, dass sich die Nachkommen ebenfalls in einer schlechteren Ausgangsposition befinden. Die Anzahl der möglichen Betroffenen ist nicht zu unterschätzen, wenn man davon ausgeht, dass weltweit etwa eine Milliarde Menschen übergewichtig sind.
Wirtschaftsoziologisch interessant sind die Auswirkungen des Körpergewichts auf die arbeitsmarktrelevanten Kenngrößen Einkommen, Einstellungschancen, Beförderungschancen und Familieneinkommen. Lässt sich tatsächlich ein negativer Zusammenhang zwischen Übergewicht und Einkommen feststellen? Wenn es Diskriminierung aufgrund von erhöhtem Gewicht gibt, lassen sich dann auch Effekte durch Untergewicht erkennen?
Zunächst wird untersucht, welche Faktoren allgemein bei der Lohnbildung eine Rolle spielen. Nur wenn bei Kontrolle der Humankapitalvariablen, Einkommensunterschiede vorliegen, kann von Diskriminierung gesprochen werden. Die verschiedenen Theorien dazu lassen sich sowohl auf Übergewicht, wie auch auf Untergewicht übertragen. Hierzu muss die Messmethode von Körpergewichts und die Gewichtseinteilung geklärt werden, um die verschiedenen Studien miteinander vergleichen zu können. Interessant ist auch die Gewichtverteilung in den zu untersuchenden Gebieten in der Welt sowie die gesundheitlichen Auswirkungen aufgrund von Über- und Untergewicht.
Bevor der aktuelle Forschungstand zu diesem Zusammenhang betrachtet wird, muss auf das Endogenitätsproblem eingegangen werden. Es ist nicht klar feststellbar, in welche Richtung die Korrelation zwischen Gewicht und Einkommen verläuft. Abschließend werden Erklärungsansätze zu den gefundenen Ergebnissen erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Humankapital
- 2.2 Lohnbildung
- 3 Diskriminierung
- 3.1 Diskriminierende Präferenzen
- 3.2 Statistische Diskriminierung
- 3.3 Soziobiologische Perspektive
- 4 Körpergewicht
- 4.1 Gewichtsverteilung
- 5 Endogenitätsproblem
- 6 Forschungsstand
- 6.1 USA
- 6.2 Europa
- 6.3 Deutschland
- 7 Erklärungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Körpergewicht auf den Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Über- und Untergewicht und arbeitsmarktrelevanten Faktoren wie Einkommen, Einstellungs- und Beförderungschancen zu analysieren und mögliche Diskriminierungsprozesse aufzuzeigen.
- Einfluss von Körpergewicht auf Lohnbildung und Beschäftigung
- Analyse von Diskriminierungstheorien im Kontext von Körpergewicht
- Bewertung des Forschungsstandes zu diesem Thema
- Erörterung des Endogenitätsproblems bei der Untersuchung des Zusammenhangs
- Aufzeigen von Erklärungsansätzen für die gefundenen Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Diskriminierung aufgrund von Körpergewicht im Arbeitsleben vor. Sie betont die Bedeutung des Arbeitsmarktes für das Selbstwertgefühl und die gesellschaftlichen Folgen von Diskriminierung. Die Arbeit fragt nach einem Zusammenhang zwischen Über- und Untergewicht und Einkommen sowie den Auswirkungen auf Einstellungs-, Beförderungs- und Familieneinkommen. Es werden methodische Herausforderungen, insbesondere das Endogenitätsproblem, und die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Humankapitalfaktoren angesprochen. Die Einleitung leitet über zu den theoretischen Grundlagen der Lohnbildung und Diskriminierung.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Humankapital und Diskriminierung. Es erläutert das Humankapitalkonzept nach Becker, wobei auch körperliche Merkmale wie das Körpergewicht als Einflussfaktor auf die Produktivität betrachtet werden. Die Lohnbildung wird im Kontext eines kompetitiven Arbeitsmarktes und unter Berücksichtigung der Humankapitalvariablen (Schulbildung, Berufsausbildung, Berufserfahrung) analysiert. Das Kapitel stellt die Mincer-Gleichung vor, die den Zusammenhang zwischen Lohn und Humankapital quantifiziert. Die Bedeutung der Kontrolle von Humankapitalvariablen für die Identifizierung von Diskriminierungseffekten wird hervorgehoben.
3 Diskriminierung: Dieses Kapitel beschreibt Diskriminierung als Benachteiligung oder Bevorzugung aufgrund bestimmter Merkmale, die als Stigmata wirken können. Es wird der Zusammenhang zwischen Stigmatisierung und Diskriminierung erläutert und der Fokus auf Diskriminierung übergewichtiger Personen gelegt. Die Auswirkungen dieser Diskriminierung auf verschiedene Lebensbereiche (Schule, Beruf, Partnerschaften, Gesundheit) werden erwähnt.
4 Körpergewicht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verteilung von Körpergewicht in der Bevölkerung. Die gesundheitlichen Folgen von Über- und Untergewicht werden kurz angerissen. Die Kapitel behandelt vermutlich die Herausforderungen und die methodischen Überlegungen zur Messung von Körpergewicht und seiner Kategorisierung in den unterschiedlichen Studien.
5 Endogenitätsproblem: Das Kapitel diskutiert das Endogenitätsproblem im Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Einkommen. Die Schwierigkeit, die Kausalrichtung der Korrelation eindeutig zu bestimmen (beeinflusst das Gewicht das Einkommen oder umgekehrt?), wird hervorgehoben. Dies ist eine zentrale methodologische Herausforderung der Arbeit.
6 Forschungsstand: Hier wird ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Diskriminierung aufgrund von Körpergewicht in den USA, Europa und Deutschland gegeben. Wahrscheinlich werden verschiedene Studien verglichen und die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.
7 Erklärungsansätze: Das Kapitel präsentiert mögliche Erklärungsansätze für die im Forschungsstand festgestellten Zusammenhänge zwischen Körpergewicht und Arbeitsmarkt. Es wird vermutlich über verschiedene theoretische Perspektiven und ihre Anwendung auf den vorliegenden Kontext diskutiert.
Schlüsselwörter
Körpergewicht, Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Lohnbildung, Humankapital, Einkommen, Produktivität, Endogenitätsproblem, Übergewicht, Untergewicht, Forschungsstand, Diskriminierungstheorien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss von Körpergewicht auf den Arbeitsmarkt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Körpergewicht (Über- und Untergewicht) auf den Arbeitsmarkt, insbesondere auf Einkommen, Einstellungs- und Beförderungschancen. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen Körpergewicht und arbeitsmarktrelevanten Faktoren und beleuchtet mögliche Diskriminierungsprozesse.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen Körpergewicht und arbeitsmarktrelevanten Faktoren zu analysieren, Diskriminierungstheorien im Kontext von Körpergewicht zu untersuchen, den Forschungsstand zu diesem Thema zu bewerten, das Endogenitätsproblem zu erörtern und Erklärungsansätze für die Ergebnisse aufzuzeigen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Humankapitalkonzept nach Becker, wobei körperliche Merkmale wie das Körpergewicht als Einflussfaktor auf die Produktivität betrachtet werden. Die Lohnbildung wird im Kontext eines kompetitiven Arbeitsmarktes unter Berücksichtigung von Humankapitalvariablen (Schulbildung, Berufsausbildung, Berufserfahrung) analysiert. Die Mincer-Gleichung wird zur Quantifizierung des Zusammenhangs zwischen Lohn und Humankapital verwendet.
Welche Arten von Diskriminierung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Diskriminierungstheorien, einschließlich diskriminierender Präferenzen und statistischer Diskriminierung. Der Fokus liegt auf der Diskriminierung übergewichtiger Personen und den Auswirkungen dieser Diskriminierung auf verschiedene Lebensbereiche.
Wie wird das Problem der Endogenität behandelt?
Die Arbeit thematisiert das Endogenitätsproblem, also die Schwierigkeit, die Kausalrichtung zwischen Körpergewicht und Einkommen eindeutig zu bestimmen. Dies stellt eine zentrale methodologische Herausforderung dar.
Wie wird der Forschungsstand dargestellt?
Die Arbeit gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Diskriminierung aufgrund von Körpergewicht in den USA, Europa und Deutschland. Verschiedene Studien werden verglichen und die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.
Welche Erklärungsansätze werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert verschiedene theoretische Perspektiven und Erklärungsansätze für die festgestellten Zusammenhänge zwischen Körpergewicht und Arbeitsmarkt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, theoretischen Grundlagen (Humankapital, Lohnbildung), Diskriminierung (diskriminierende Präferenzen, statistische Diskriminierung, soziobiologische Perspektive), Körpergewicht (Gewichtsverteilung), Endogenitätsproblem, Forschungsstand (USA, Europa, Deutschland) und Erklärungsansätze.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Körpergewicht, Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Lohnbildung, Humankapital, Einkommen, Produktivität, Endogenitätsproblem, Übergewicht, Untergewicht, Forschungsstand, Diskriminierungstheorien.
- Quote paper
- Veronika Waldenmaier (Author), 2012, Arbeitsmarkt-Diskriminierung aufgrund des Körpergewichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369285