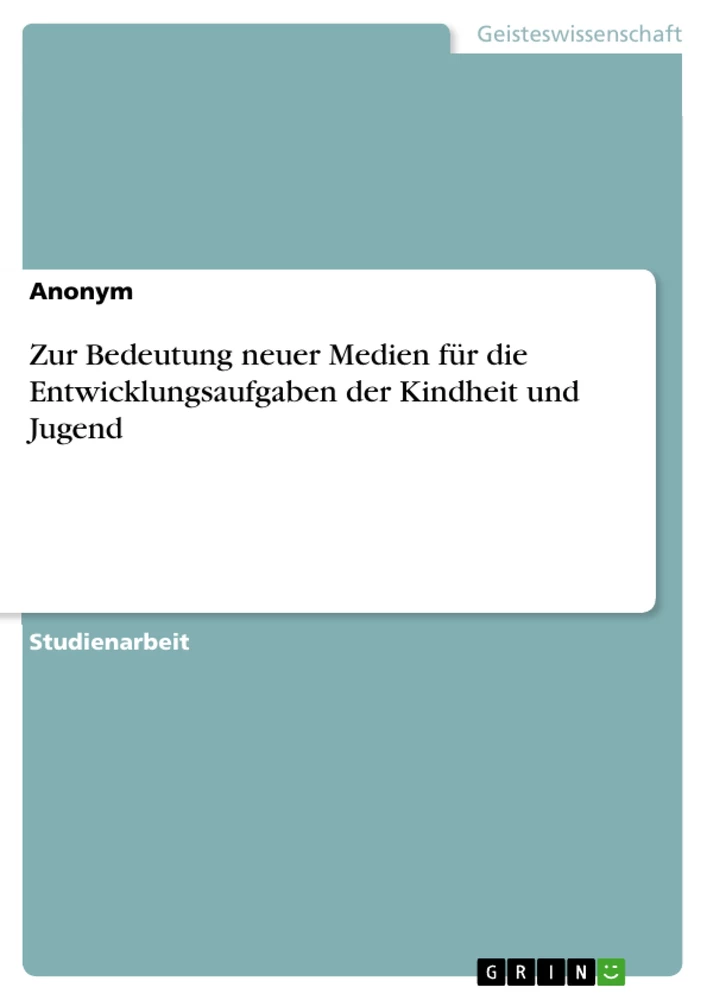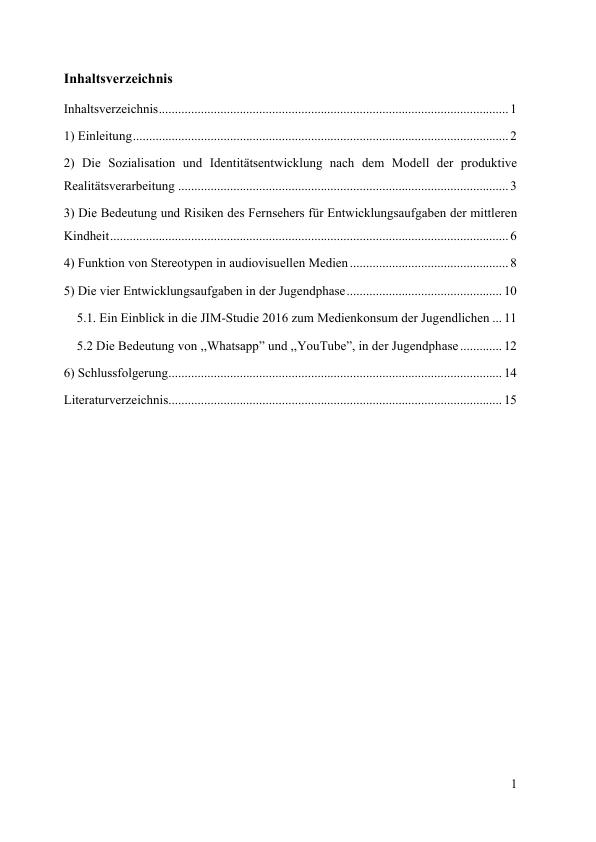Diese Hausarbeit wurde im Rahmen eines Seminars im Fach der Bildungswissenschaften verfasst. Hierbei geht es um die Bedeutung audiovisueller Medien sowie Smartphone -Dienste wie ,,YouTube" und ,,Whatsapp", für die Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen.
Individuen unterlaufen innerhalb ihres Lebenslaufes entwicklungsbezogene Stadien, welche sie bewältigen müssen. Diese Entwicklungs- oder auch Lernaufgaben müssen gemeistert werden, um ein vollwertiges, sowie zufriedenes Mitglied in der Gesellschaft zu werden. Vor allem in der Kindheit und Jugend werden dafür neue Medien herangezogen.
Die Internetnutzung und das Fernsehen gehören in der heutigen Zeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil jedes Haushaltes. Heranwachsende bedienen sich an Medien, um ihre Freizeit zu gestalten, Freundschaften zu pflegen oder, um Anregungen für ihre Handlungsmuster zu erhalten. So wird das Verhalten der Medienfiguren als Orientierung oder aber zur Reflexion des eigenen Handels genutzt. Medieninhalte bieten auch Anlässe für Gesprächsthemen innerhalb der Peer-Group, was vor allem für die interne Bindung bedeutsam ist. So handeln Gesprächsthemen oft über neuste Musikvideos, Computerspiele oder Mode- oder Beautytrends.
Diese Arbeit verfolgt das Ziel zu untersuchen, welche Bedeutung neue Medien für die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben in der Kindheit und Jugend haben können. Dabei wird auf Grund der Relevanz das Medium Fernsehen, Smartphone sowie Smartphone-Dienste wie, ,,Whatsapp" und ,,YouTube" näher betrachtet. Im Anbetracht dessen wird These aufgestellt, dass neue Medien, aber vor allem das Medium Fernsehen durch die mannigfaltigen Darstellungen an Rollen-, Berufs-, sowie Geschlechtsbilder bereichernd für die Entwicklungsthemen sein können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sozialisation und Identitätsentwicklung nach dem Modell der produktive Realitätsverarbeitung
- Die Bedeutung und Risiken des Fernsehers für Entwicklungsaufgaben der mittleren Kindheit
- Funktion von Stereotypen in audiovisuellen Medien
- Die vier Entwicklungsaufgaben in der Jugendphase.
- Ein Einblick in die JIM-Studie 2016 zum Medienkonsum der Jugendlichen
- Die Bedeutung von „Whatsapp“ und „YouTube“, in der Jugendphase
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung neuer Medien für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in der Kindheit und Jugend. Sie fokussiert dabei insbesondere auf das Medium Fernsehen sowie Smartphone und Smartphone-Dienste wie „Whatsapp“ und „YouTube“. Die Arbeit argumentiert, dass neue Medien, vor allem das Fernsehen, durch ihre vielfältigen Darstellungen von Rollen-, Berufs- und Geschlechtsbildern bereichernd für die Entwicklungsthemen sein können.
- Die Rolle neuer Medien in der Sozialisation und Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Die Bedeutung des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung von Klaus Hurrelmann für das Verständnis von Sozialisation und Identitätsbildung
- Die Entwicklungsaufgaben der Kindheit und Jugend im Kontext von Medienkonsum
- Die Auswirkungen von Stereotypen in audiovisuellen Medien auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Die spezifischen Beiträge von „Whatsapp“ und „YouTube“ zur Sozialisation und Identitätsentwicklung in der Jugendphase
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und führt in das Thema der Bedeutung neuer Medien für die Entwicklungsaufgaben in der Kindheit und Jugend ein. Kapitel 2 beleuchtet das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung nach Klaus Hurrelmann und erläutert die Konzepte von Sozialisation und Identitätsentwicklung im Kontext dieses Modells. Dieses Kapitel legt den theoretischen Rahmen für die Analyse der Bedeutung neuer Medien für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Das Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Modells und beleuchtet die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der inneren und äußeren Realität für die Persönlichkeitsentwicklung.
Schlüsselwörter
Neue Medien, Sozialisation, Identitätsentwicklung, produktive Realitätsverarbeitung, Entwicklungsaufgaben, Kindheit, Jugend, Fernsehen, Smartphone, „Whatsapp“, „YouTube“, Stereotypen, Geschlechterrollen, JIM-Studie, Individuation, Integration, Ich-Identität.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Zur Bedeutung neuer Medien für die Entwicklungsaufgaben der Kindheit und Jugend, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369354