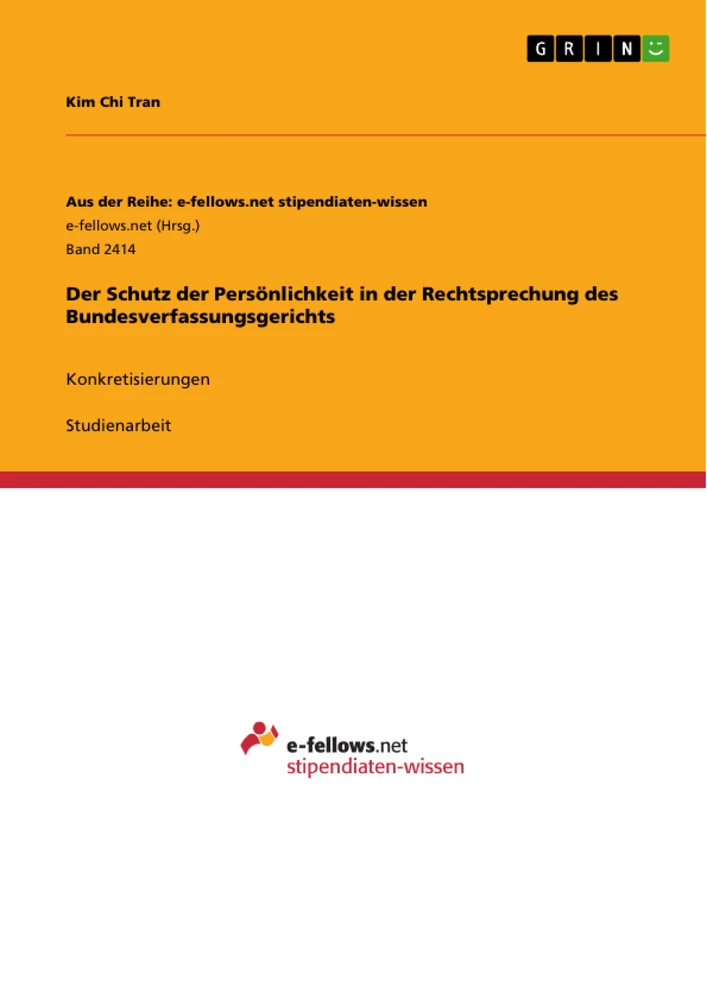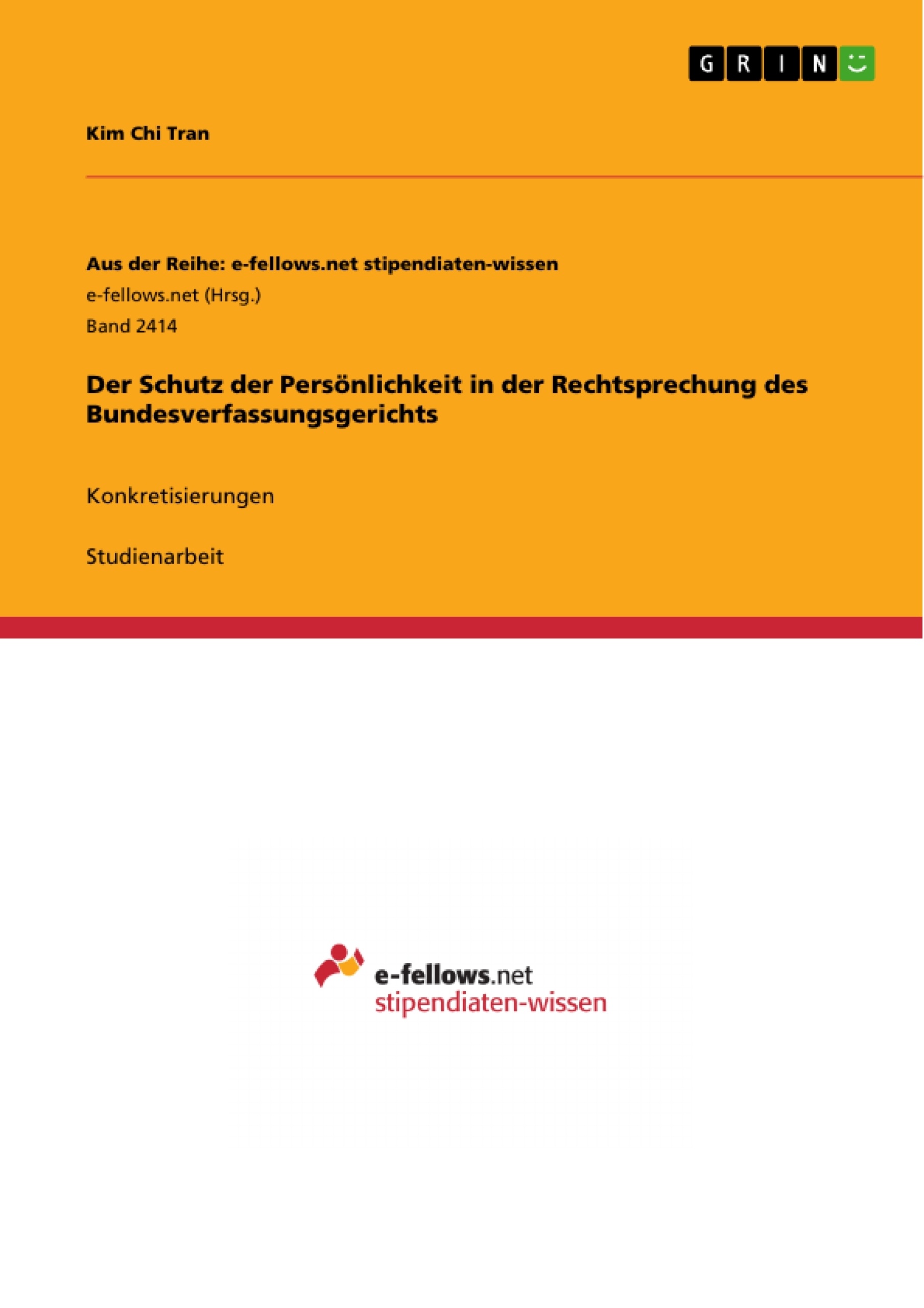In der heutigen von technischem Fortschritt und rasanten Neuerungsprozessen geprägten Zeit rückt der rechtliche Schutz der Persönlichkeit zunehmend in den Vordergrund. Nicht nur im Rahmen der häufig diskutierten Frage von Vorratsdatenspeicherung durch den Staat, sondern auch vor dem Hintergrund der Möglichkeiten in der Medizin, stellen sich die Fragen, wie weit in den persönlichen Bereich eines Individuums eingegriffen werden darf und mit welchen Mechanismen der Schutz desgleichen durch das Rechtssystem am effektivsten gelingt. Dass die Persönlichkeit heutzutage durch Art. 2 I GG i. V. m. Art. 1 I GG geschützt ist, stellt keine Selbstverständlichkeit dar.
Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann die Rechtsprechung, allen voran der Bundesgerichtshof 1954 in der sogenannten „Leserbrief- Entscheidung“ mit der rechtlichen Konkretisierung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. In dieser Entscheidung zur Veröffentlichung von Briefen oder sonstigen privaten Aufzeichnungen spricht sich der Bundesgerichtshof dafür aus, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht als ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Grundrecht angesehen werden muss.
In seinem Elfes-Urteil stellte das Bundesverfassungsgericht dann die Weichen für eine verfassungsrechtliche Konkretisierung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, indem es zum Ausdruck bringt, dass dem einzelnen Bürger eine Sphäre privater Lebensgestaltung verfassungskräftig vorbehalten ist. In einer Vielzahl von darauffolgenden Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht Inhalt und Reichweite des Schutzes durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht näher bestimmt. Der Verlauf der Entwicklung soll hier dargestellt sowie auf die ausdifferenzierten Fallgruppen anhand von Beispielen aus der Rechtsprechung dargestellt werden. Denn die Bestimmung von Inhalt und Reichweite des Schutzes durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist mit Sicherheit immer noch nicht abgeschlossen und wird für die Rechtspraxis im Hinblick auf kommende technische und medizinische Möglichkeiten weitere Herausforderungen mit sich bringen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Hinführung zum Thema
- B. Schutz der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts- Konkretisierungen
- I. Entwicklung des Schutzbereichs
- 1. Weichenstellung durch das Elfes- Urteil
- 2. Ausdifferenzierung der Schutzdimensionen
- a) Stellung und Struktur des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
- b) Selbstbestimmung
- aa) Selbstbestimmung als räumliche Rückzugs- und Abschirmungsmöglichkeit
- bb) Selbstbestimmung in thematischer Ausprägung
- aaa) Vertraulichkeit persönlicher Angelegenheiten
- bbb) Informationelle Selbstbestimmung
- ccc) Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme- Computergrundrecht
- ddd) Identitätsbezogene Selbstbestimmung
- c) Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit
- aa) Recht am eigenen Bild
- bb) Recht am eigenen Wort
- cc) Recht am eigenen Namen und Schutz der persönlichen Ehre
- dd) Recht auf Gegendarstellung
- ee) Nemo- tenetur- Grundsatz
- d) Postmortales Persönlichkeitsrecht
- II. Maßstäbe für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Eingriffen
- 1. Sphärentheorie des Bundesverfassungsgerichts
- a) Intimsphäre
- b) Privatsphäre
- c) Sozial- bzw. Öffentlichkeitssphäre
- 2. Kritik an Sphärentheorie
- C. Schlussgedanke
- Entwicklung des Schutzbereichs des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
- Ausdifferenzierung der Schutzdimensionen
- Selbstbestimmung als zentrales Element des Persönlichkeitsrechts
- Rechtfertigungsmaßstäbe für Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht
- Anwendung der Sphärentheorie in der Rechtsprechung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Schutz der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Sie analysiert die Entwicklung des Schutzbereichs und die Ausdifferenzierung der Schutzdimensionen, insbesondere die Selbstbestimmung und die Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit. Die Arbeit beleuchtet zudem die maßgeblichen Rechtfertigungsmaßstäbe für Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht, insbesondere die Sphärentheorie.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die Relevanz des Schutzes der Persönlichkeit in der heutigen Zeit dar. Es wird auf die Entwicklung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts eingegangen.
Das zweite Kapitel analysiert die Entwicklung des Schutzbereichs des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dabei wird insbesondere die Weichenstellung durch das Elfes- Urteil beleuchtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Ausdifferenzierung der Schutzdimensionen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es werden die verschiedenen Facetten der Selbstbestimmung, wie die räumliche Rückzugs- und Abschirmungsmöglichkeit, die thematische Ausprägung in Form von Vertraulichkeit persönlicher Angelegenheiten, informationeller Selbstbestimmung, dem Recht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme und der identitätsbezogenen Selbstbestimmung, analysiert.
Das vierte Kapitel behandelt die Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit und befasst sich mit dem Recht am eigenen Bild, dem Recht am eigenen Wort, dem Recht am eigenen Namen und Schutz der persönlichen Ehre, dem Recht auf Gegendarstellung und dem Nemo- tenetur- Grundsatz.
Das fünfte Kapitel untersucht das postmortale Persönlichkeitsrecht.
Das sechste Kapitel befasst sich mit den maßgeblichen Rechtfertigungsmaßstäben für Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht, insbesondere der Sphärentheorie des Bundesverfassungsgerichts.
Das siebte Kapitel analysiert die Kritik an der Sphärentheorie.
Schlüsselwörter
Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Bundesverfassungsgericht, Selbstbestimmung, Selbstdarstellung, Sphärentheorie, Intimsphäre, Privatsphäre, Öffentlichkeitssphäre, Rechtfertigung von Eingriffen, Informationelle Selbstbestimmung, Computergrundrecht, Recht am eigenen Bild, Recht am eigenen Wort, Recht am eigenen Namen, Schutz der persönlichen Ehre.
- Citation du texte
- Kim Chi Tran (Auteur), 2015, Der Schutz der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369376