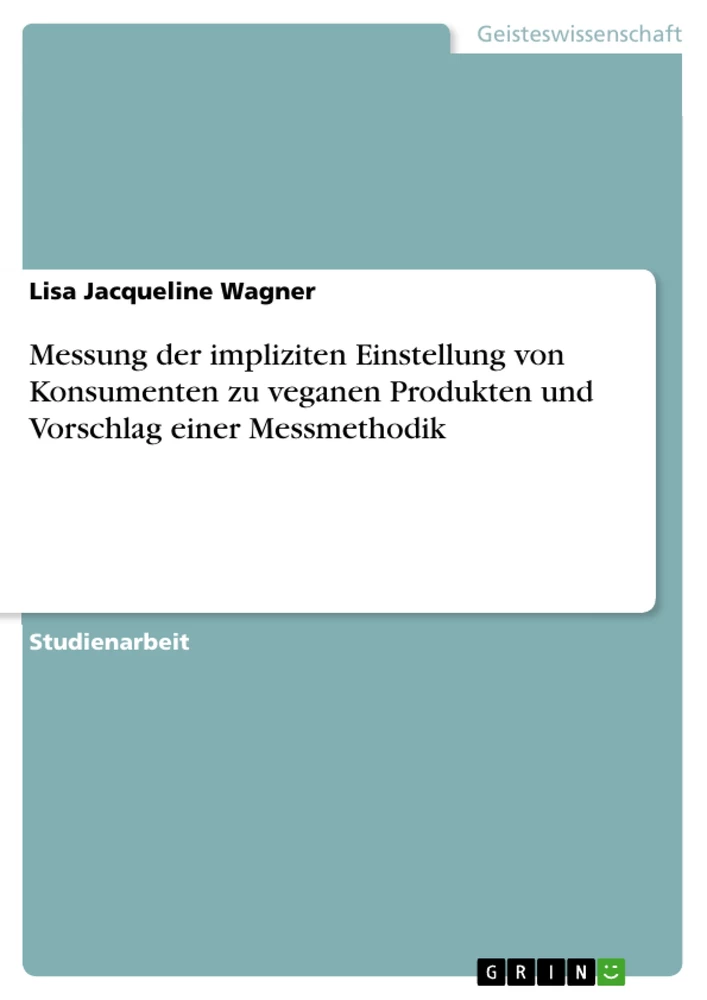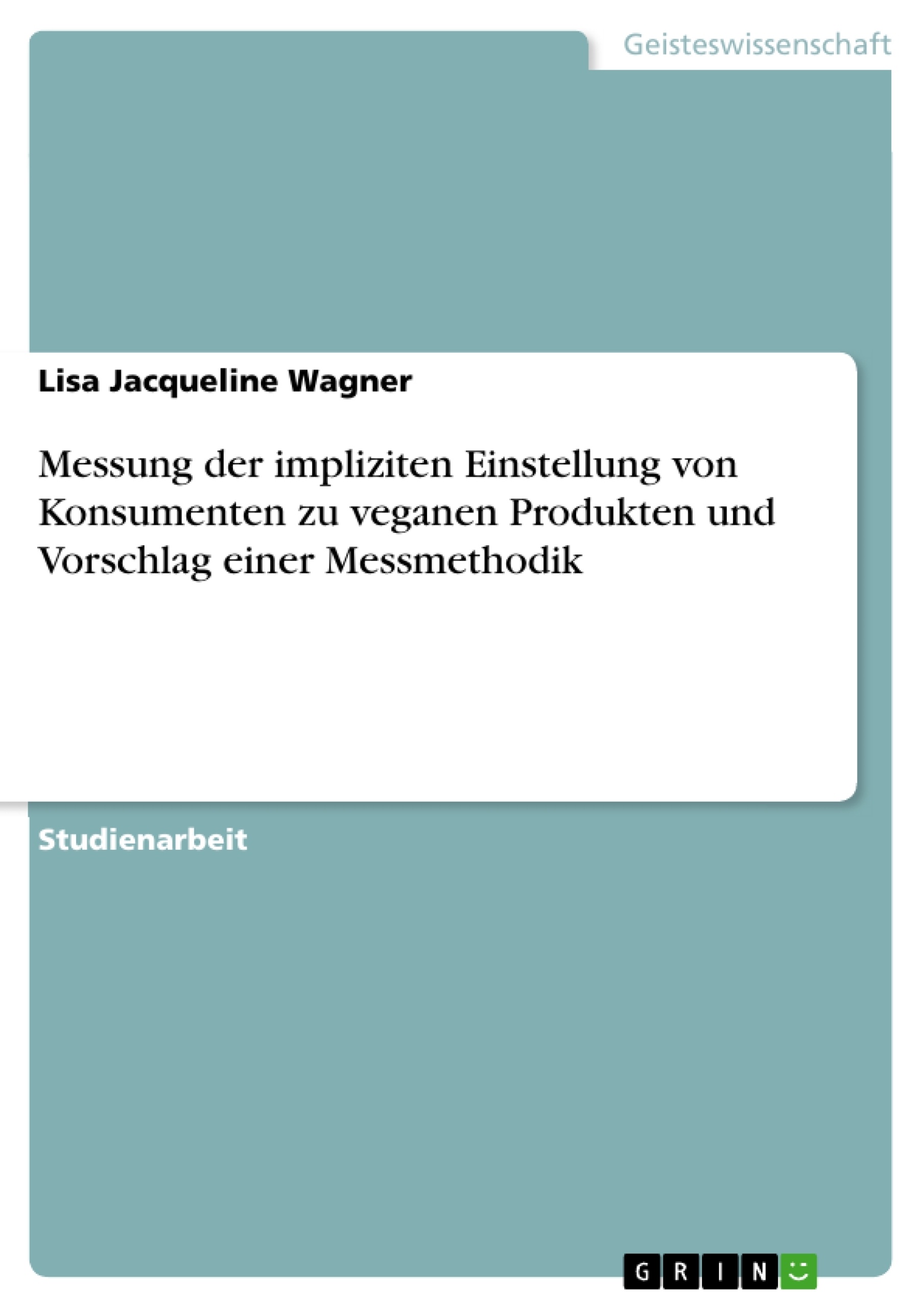Da der Konkurrenzkampf zwischen Unternehmen aufgrund von immer ähnlich werdender Produkte steigt, ist es wichtig, die Meinungen der Kunden zum eigenen, konkurrierenden und nicht zuletzt auch vom idealen Produkt zu kennen. Schlussendlich ist es das Kaufverhalten von Konsumenten, das Marktanteile, Umsätze und den Gewinn eines Unternehmens maßgeblich beeinflusst.
Kunden haben verschiedene Einstellungen gegenüber einem Produkt, jedoch wird die Meinung oft nicht direkt preisgegeben. Aus diesem Grund hat es sich die Forschung zur Aufgabe gemacht, neben der bewussten (expliziten) Einstellung und Meinung auch die unbewusste (implizite) Einstellung zu erforschen.
Die vorliegende Hausarbeit stellt zunächst allgemeine Erkenntnisse über die Messung der impliziten Einstellungen dar. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Recherche zu impliziten Einstellungen zum Thema zu veganen Produkten dargestellt und eine Handlungsempfehlung zur Anwendung des impliziten Assoziationstests (IAT) gegeben. Zuletzt wird der IAT kritisch beleuchtet sowie seine Vor- und Nachteile betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Glossar
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- 1. Einstellungsmessung anhand indirekter Messmethoden
- 1.1 Einstellungen im sozialpsychologischen Kontext
- 1.2 Explizite und implizite Einstellungen
- 1.3 Methoden zur Messung der impliziten Einstellungen
- 2. Einstellung zum Vegan-Boom
- 2.1 Nutzen der indirekten Messung
- 2.2 Aktueller Stand der Forschung zur impliziten Einstellung
- 3. Vorschlag einer Messmethodik
- 3.1. Auswahl einer Messmethodik
- 3.2. Der implizite Assoziationstest (IAT)
- 3.3. Handlungsempfehlung und der IAT zur Einstellungsmessung gegenüber veganen Produkten
- 3.4. Statistische Auswertung der Testdaten
- 4. Stellungnahme und Einschätzung der Machbarkeit des Handlungsvorschlags
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Messung der impliziten Einstellung von Konsumenten zu veganen Produkten. Sie analysiert verschiedene Methoden zur Erfassung von unbewussten Einstellungen und stellt den impliziten Assoziationstest (IAT) als ein geeignetes Instrument zur Messung der impliziten Einstellung gegenüber veganen Produkten vor.
- Die Bedeutung der impliziten Einstellung für das Kaufverhalten von Konsumenten
- Die Herausforderungen der Messung von impliziten Einstellungen
- Der Einsatz des IAT zur Erfassung der Einstellung gegenüber veganen Produkten
- Die Vor- und Nachteile des IAT als Messinstrument
- Handlungsempfehlungen zur Anwendung des IAT in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Relevanz der impliziten Einstellungsmessung im Kontext des wachsenden Wettbewerbs zwischen Unternehmen. Kapitel 1 beleuchtet die allgemeine Theorie der Einstellungsmessung und unterscheidet zwischen expliziten und impliziten Einstellungen. Es werden verschiedene Methoden zur Messung der impliziten Einstellungen vorgestellt. Kapitel 2 widmet sich dem Thema des Vegan-Booms und den Möglichkeiten, die indirekte Messung von Einstellungen für Unternehmen bietet. Es werden aktuelle Forschungsergebnisse zur impliziten Einstellung gegenüber veganen Produkten präsentiert. Kapitel 3 schlägt eine konkrete Messmethodik vor, wobei der Schwerpunkt auf dem IAT liegt. Es werden die Funktionsweise des IAT, die Durchführung des Tests und die statistische Auswertung der Testdaten erläutert. Kapitel 4 beleuchtet kritisch die Machbarkeit des vorgeschlagenen Handlungsvorschlags und diskutiert die Vor- und Nachteile des IAT.
Schlüsselwörter
Implizite Einstellung, IAT, Vegan, Konsumentenverhalten, Marktforschung, Produktentwicklung, Kaufverhalten, Markenimage, Wettbewerbsvorteil
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen expliziten und impliziten Einstellungen?
Explizite Einstellungen sind bewusst geäußerte Meinungen. Implizite Einstellungen sind unbewusste Assoziationen, die das Verhalten oft stärker beeinflussen, aber direkt nicht abgefragt werden können.
Wie funktioniert der Implizite Assoziationstest (IAT)?
Der IAT misst die Reaktionszeit bei der Zuordnung von Begriffen zu Kategorien. Schnellere Reaktionen deuten auf eine stärkere mentale Verknüpfung (z. B. Veganismus und Gesundheit) hin.
Warum ist die Messung impliziter Einstellungen für vegane Produkte wichtig?
Viele Konsumenten geben in Umfragen an, vegane Produkte gut zu finden (soziale Erwünschtheit), handeln aber im Supermarkt anders. Der IAT hilft, die wahren Kaufmotive aufzudecken.
Was sind die Vorteile des IAT in der Marktforschung?
Er umgeht Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit und liefert tiefere Einblicke in das Markenimage und unbewusste Vorurteile der Konsumenten.
Welche Nachteile hat die IAT-Methodik?
Kritiker bemängeln teilweise die Messgenauigkeit und die Tatsache, dass die Ergebnisse von der jeweiligen Testsituation beeinflusst werden können.
- Arbeit zitieren
- Lisa Jacqueline Wagner (Autor:in), 2016, Messung der impliziten Einstellung von Konsumenten zu veganen Produkten und Vorschlag einer Messmethodik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369454