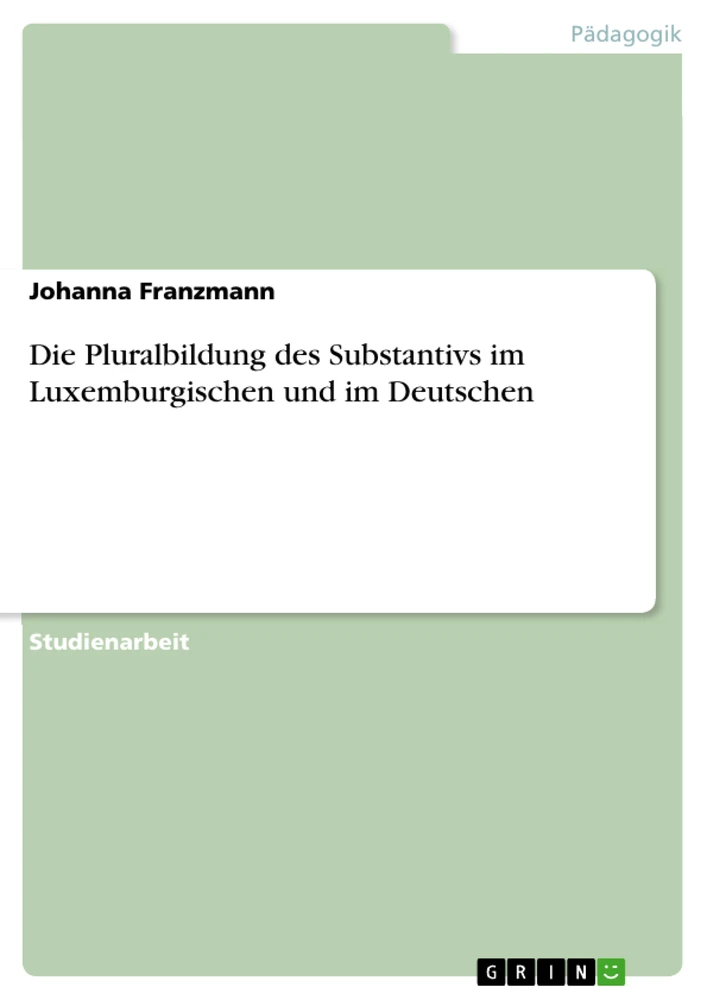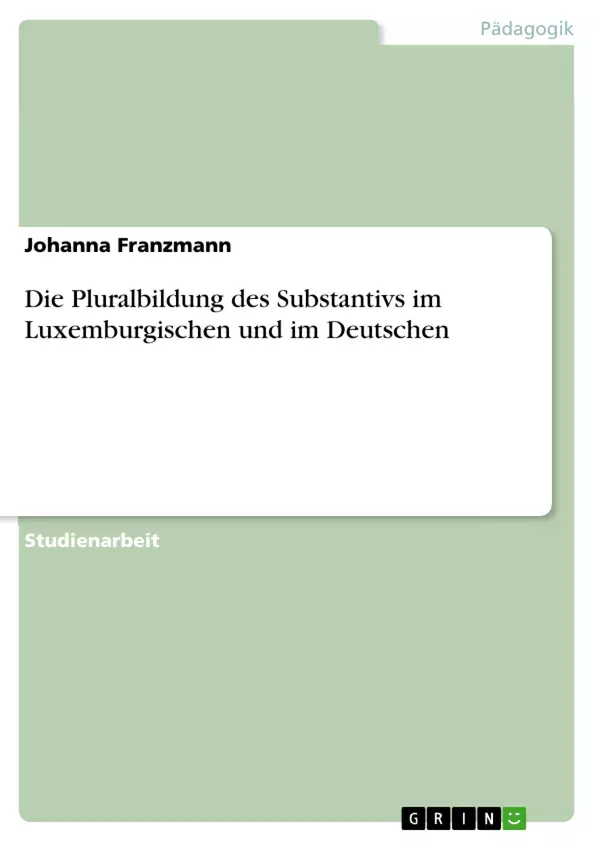Anlass für das Thema Pluralbildung im Luxemburgischen und Deutschen, war der Besuch des Seminars mit dem Überthema „Germanische Kleinsprachen“. Zu Beginn waren die Erwartungen sehr vage, da die Bedeutung des Begriffes „Germanische Kleinsprachen“ nicht bekannt war. Nach und nach wurde die Bedeutung klarer und die Spannung mehr über die „Verwandtschaftsverhältnisse“ der einzelnen Sprachen herauszufinden wuchs. Zu Beginn soll dazu ein kurzer Blick auf die Deklination des Substantives erfolgen. Daraufhin werden verschiedene Bildungsverfahren des Plurals vorstellt und auf die beiden Sprachen angewendet. Daran anschließend sollen die beiden Sprachen miteinander verglichen werden, wobei zum einen auf die Verfahren geschaut und zum andern die Komplexität der Sprachen in den Blick genommen wird. In einem Exkurs wird zudem der Gebrauch des Umlautes näher beleuchtet.
Das Germanische hat sich aufgrund verschiedener Wanderungsbewegungen aus dem Urgermanischen entwickelt und wird heute in drei Gruppen unterteilt: Das Westgermanische, das Nordgermanische und das Ostgermanisch, welches mittlerweile ausgestorben ist. Die bestüberlieferte Sprache des Ostgermanischen ist das Gotische. Die meisten germanischen Sprachen, mit einigen Ausnahmen, werden innerhalb von Europa gesprochen. Allerdings variiert die Sprecheranzahl sehr stark. Hier lässt sich auch die Erklärung für das Adjektiv „klein“ in Kleinsprachen erkennen. Wohingegen Englisch, Deutsch und Niederländisch von vielen Menschen gesprochen wird, ist die Sprecherzahl der „Germanischen Kleinsprachen“, wie Afrikaans, Luxemburgisch oder Isländisch sehr viel geringer.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Substantiv- Wie kann es sich verändern?
- Pluralbildung
- Verfahren und Techniken der Pluralbildung
- Der Plural im Deutschen
- Der Plural im Luxemburgischen
- Synchroner Vergleich des Plurals in den beiden Sprachen
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Exkurs: Das Phänomen des Umlautes
- Einordnung der Komplexität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Pluralbildung des Substantivs im Luxemburgischen und Deutschen im Vergleich. Sie untersucht die Verfahren und Techniken der Pluralbildung in beiden Sprachen und vergleicht deren Komplexität. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Sprachen aufzuzeigen und die besondere Rolle des Umlautes in diesem Zusammenhang zu beleuchten.
- Verfahren und Techniken der Pluralbildung im Luxemburgischen und Deutschen
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Pluralbildungen
- Die Bedeutung des Umlautes bei der Pluralbildung
- Die Komplexität der Pluralbildung in beiden Sprachen
- Die Bedeutung des Vergleichs für das Verständnis der Sprachverwandtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Pluralbildung im Luxemburgischen und Deutschen ein. Sie erläutert den Hintergrund des Vergleichs und stellt die Relevanz des Themas für das Studium der germanischen Kleinsprachen heraus.
Kapitel 2 befasst sich mit der Deklination des Substantivs im Allgemeinen und erklärt die Dimensionen Genus, Numerus und Kasus. Es wird hervorgehoben, dass der Genitiv im Deutschen und Luxemburgischen zunehmend an Bedeutung verliert. Außerdem wird auf die Besonderheit des Luxemburgischen hingewiesen, dass der Nominativ mit dem Akkusativ zusammenfällt.
Kapitel 3 widmet sich der Pluralbildung im Detail. Es werden verschiedene Verfahren und Techniken der Pluralbildung vorgestellt und auf die beiden Sprachen angewendet.
Kapitel 4 vergleicht die Pluralbildung im Deutschen und Luxemburgischen. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Verfahren aufgezeigt und die Komplexität der Pluralbildung in beiden Sprachen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Pluralbildung, Substantiv, Luxemburgisch, Deutsch, Germanische Kleinsprachen, Vergleich, Morphologie, Verfahren, Techniken, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Komplexität, Umlaut, Sprachverwandtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Germanische Kleinsprachen"?
Dazu zählen Sprachen mit geringerer Sprecherzahl wie Luxemburgisch, Isländisch oder Afrikaans, im Gegensatz zu "Großsprachen" wie Deutsch oder Englisch.
Wie wird der Plural im Luxemburgischen gebildet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Verfahren der luxemburgischen Pluralmorphologie und vergleicht diese mit den deutschen Bildungsregeln.
Welche Rolle spielt der Umlaut bei der Pluralbildung?
In einem Exkurs wird der Umlaut als wichtiges morphologisches Mittel zur Kennzeichnung des Plurals in beiden Sprachen detailliert beleuchtet.
Was sind die Hauptunterschiede in der Deklination?
Ein markanter Unterschied ist, dass im Luxemburgischen der Nominativ meist mit dem Akkusativ zusammenfällt und der Genitiv an Bedeutung verloren hat.
Sind Deutsch und Luxemburgisch eng verwandt?
Ja, beide gehören zur westgermanischen Sprachgruppe. Der Vergleich der Pluralbildung zeigt sowohl tiefgreifende Gemeinsamkeiten als auch spezifische Eigenheiten auf.
Welche Sprache hat die komplexere Pluralbildung?
Die Arbeit analysiert und vergleicht die Komplexität der verschiedenen Techniken und Endungen in beiden Sprachen synchron.
- Quote paper
- Johanna Franzmann (Author), 2017, Die Pluralbildung des Substantivs im Luxemburgischen und im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369557