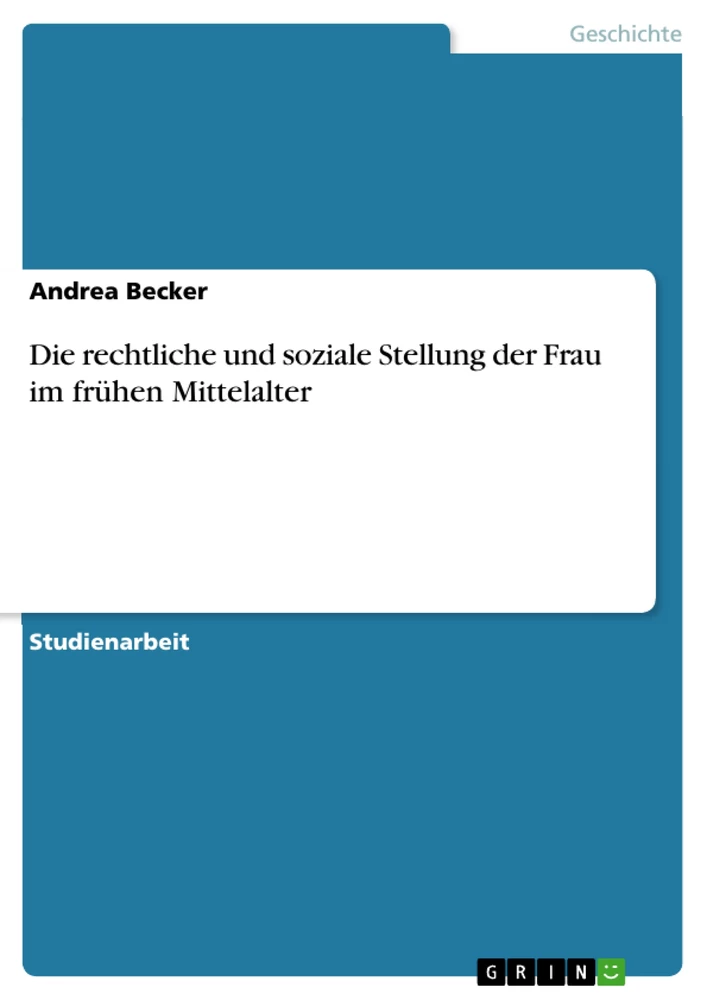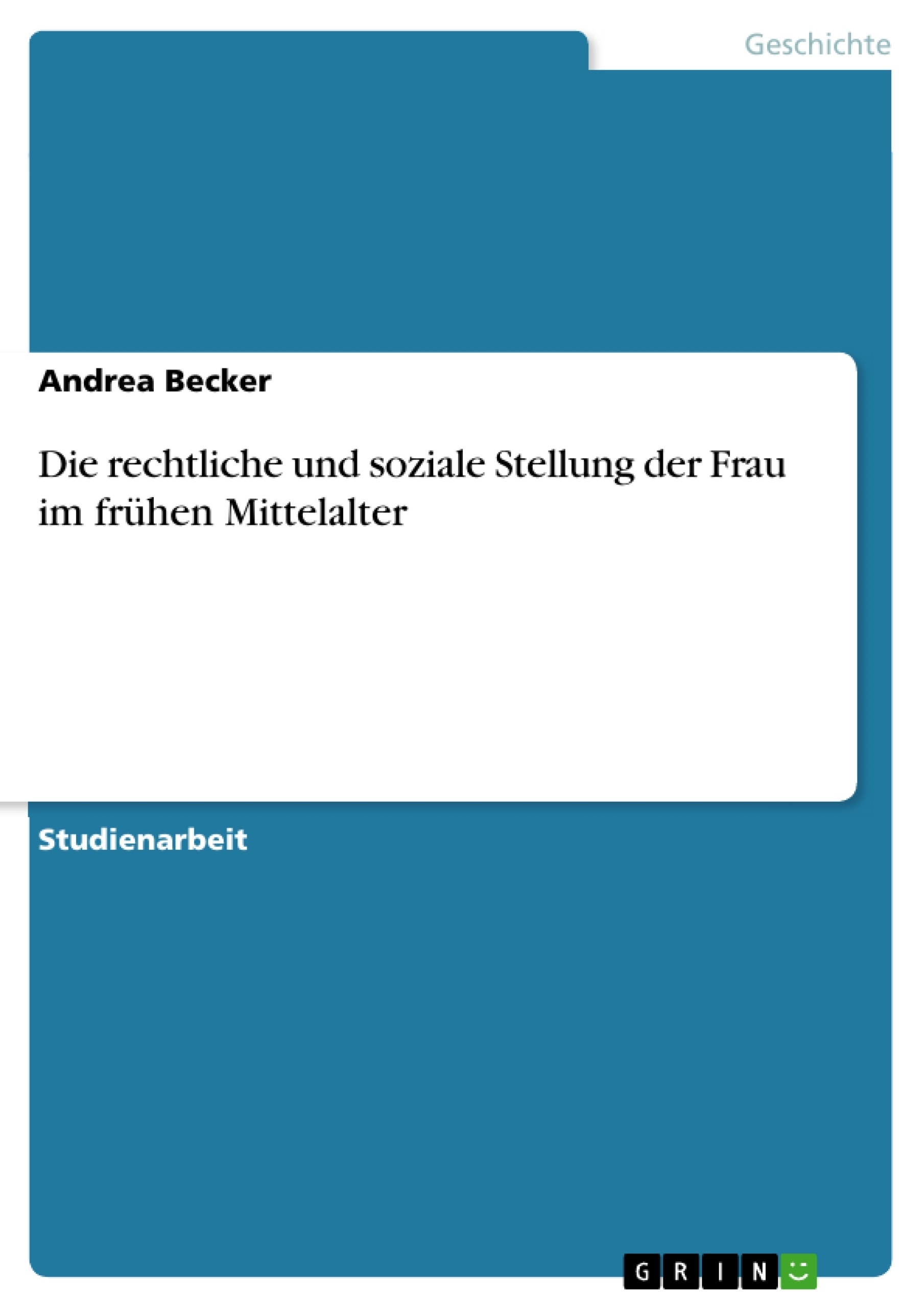Der zeitliche Rahmen dieser Hausarbeit umfaßt ausschließlich das frühe Mittelalter, also in etwa die Periode vom beginnenden 6. bis zum 11. Jahrhundert. Eine genaue Eingrenzung in Bezug auf den Begriff des frühen Mittelalters kann nur schwer vorgenommen werden. Das Problem dabei ist die Einteilung oder Gliederung „des unendlichen Flusses der Geschichte“. Gemeint ist damit die Bestimmung von Daten, „die den Charakter von Zäsuren haben: Wende-punkte, an denen alte Entwicklungen zu Ende gehen und von denen neue ihren Ausgang nehmen.“(1) So begann das frühe Mittelalter für die Humanisten mit dem Ende der Antike, also 476 (Untergang des weströmischen Reiches). „Mit gleichem Recht ließen sich jedoch auch andere Zahlen nennen, zum Beispiel 375: das Jahr des Hunneneinfalls, der die gesamte germanische Völkerwanderung im Gefolge hatte, oder auch 325: der Herrscherbeginn Konstantins, der als erster christlicher Kaiser eine neue christliche Ära eingeleitet hat.“(2)
Bei der Untersuchung der rechtlichen und sozialen Stellung der Frau im frühen Mittelalter müssen die von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik geprägten Rahmenbedingungen hinterfragt, sowie die Denkstrukturen und das ‚Frauenbild‘ jener Zeit berücksichtigt werden. Dies geschieht, um ein besseres Verständnis über die rechtliche und soziale Stellung der Frau im frühen Mittelalter zu erzielen, die isoliert betrachtet für Menschen der heutigen Zeit mit einem auf Gleichberechtigung ausgerichteten Denken nur schwer nachvollziehbar ist. Unter Berücksichtigung der Fragen wie Frauen ihr Leben gestalten sollten und welche Möglichkeiten sich ihnen geboten haben wie sie ihr Leben gestalten konnten, soll ihre rechtliche und soziale Stellung im frühen Mittelalter heraus-gearbeitet werden.(3)
[...]
____
1 Josef Fleckenstein: Ortsbestimmung des Mittelalters – Das Problem der Periodisierung, in: Mittelalterforschung, Forschung und Information, Bd. 29, Berlin 1981, S. 15.
2 Ebd., S. 16.
3 Vgl. Hans-Werner Goetz: Frauenbild und weibliche Lebensgestaltung im fränkischen Reich, in: Ders. (Hrsg.): Weibliche Lebensgestaltung im frühen Mittelalter, Köln 1991, S.7.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur rechtlichen Stellung
- 2.1 Die Muntgewalt
- 2.2 Verlobung, Eheschließung und Scheidung
- 2.3 Verschiedene Eheformen
- 2.3.1 Die Raubehe
- 2.3.2 Die Friedelehe
- 3. Rechtliche und soziale Stellung der Frau in der frühmittelalterlichen Gesellschaft
- 3.1 Erbrecht, Besitzrecht und Besitzverfügung der Ehefrau
- 3.2 Beteiligung von Frauen an der politischen Herrschaft
- 3.3 Die Rolle der Kirche – die christliche Eheauffassung
- 4. Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die rechtliche und soziale Stellung der Frau im frühen Mittelalter (etwa 6. bis 11. Jahrhundert). Ziel ist es, ein Verständnis für die Lebensbedingungen und Möglichkeiten von Frauen in dieser Zeit zu entwickeln, unter Berücksichtigung der damaligen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie der vorherrschenden Denkstrukturen und des Frauenbildes. Die Arbeit analysiert die Lage der Frau vor dem Hintergrund der Ungleichheit im Vergleich zu Männern.
- Rechtliche Stellung der Frau, insbesondere im Ehe- und Erbrecht
- Soziale Rolle der Frau in der frühmittelalterlichen Gesellschaft
- Einfluss der Kirche auf die Eheauffassung und die Stellung der Frau
- Möglichkeiten und Beschränkungen der weiblichen Lebensgestaltung
- Analyse der Quellenlage und der Herausforderungen bei der Forschung zu diesem Thema
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung definiert den zeitlichen Rahmen der Arbeit (frühes Mittelalter, ca. 6. bis 11. Jahrhundert) und diskutiert die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung dieser Periode. Sie betont die Notwendigkeit, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen sowie das Frauenbild der Zeit zu berücksichtigen, um die rechtliche und soziale Stellung der Frau zu verstehen. Die Einleitung skizziert die Forschungsfragen und die verwendeten Quellen, wobei auf die eingeschränkte Quellenlage und die damit verbundenen Herausforderungen hingewiesen wird. Die Autorin erläutert ihre methodische Herangehensweise und die Auswahl der Literatur.
2. Zur rechtlichen Stellung: Dieses Kapitel befasst sich mit der rechtlichen Stellung der Frau im frühen Mittelalter, konzentriert sich dabei hauptsächlich auf Aspekte, die mit Ehe und Eherecht verbunden sind. Es analysiert die Muntgewalt, die Verlobung, Eheschließung und Scheidung sowie verschiedene Eheformen wie die Raubehe und die Friedelehe. Der Fokus liegt auf der Darstellung der rechtlichen Abhängigkeiten und der daraus resultierenden eingeschränkten Rechte der Frau im Vergleich zu Männern. Durch die detaillierte Analyse dieser rechtlichen Aspekte wird das Bild der Frau in der männerdominierten Gesellschaft des frühen Mittelalters gezeichnet.
3. Rechtliche und soziale Stellung der Frau in der frühmittelalterlichen Gesellschaft: Dieses Kapitel erweitert die Perspektive und untersucht die rechtliche und soziale Stellung der Frau umfassender. Es beleuchtet das Erbrecht, das Besitzrecht und die Besitzverfügung der Ehefrau, ihre mögliche Beteiligung an der politischen Herrschaft sowie den Einfluss der Kirche und ihrer christlichen Eheauffassung auf das Leben und die Rechte von Frauen. Es analysiert, wie diese Faktoren die Möglichkeiten und Beschränkungen der weiblichen Lebensgestaltung beeinflussten und die soziale Hierarchie widerspiegelten. Der Einfluss der Kirche und deren Ansichten werden in Verbindung mit den rechtlichen Aspekten gesetzt, um ein komplexeres Bild der weiblichen Lebensrealität zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Frau, frühes Mittelalter, Rechtsstellung, soziale Stellung, Ehe, Eherecht, Muntgewalt, Erbrecht, Besitzrecht, Kirche, christliche Eheauffassung, Männergesellschaft, Geschlechterverhältnisse, Quellenlage, mittelalterliche Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Rechtliche und soziale Stellung der Frau im frühen Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die rechtliche und soziale Stellung der Frau im frühen Mittelalter (ca. 6. bis 11. Jahrhundert). Sie analysiert die Lebensbedingungen und Möglichkeiten von Frauen in dieser Zeit vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie der vorherrschenden Denkstrukturen und des Frauenbildes. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Ungleichheit im Vergleich zu Männern.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtliche Stellung der Frau, insbesondere im Ehe- und Erbrecht, ihre soziale Rolle in der frühmittelalterlichen Gesellschaft, den Einfluss der Kirche auf die Eheauffassung und die Stellung der Frau, die Möglichkeiten und Beschränkungen der weiblichen Lebensgestaltung sowie die Analyse der Quellenlage und der Herausforderungen bei der Forschung zu diesem Thema.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur rechtlichen Stellung der Frau (inkl. Muntgewalt, Verlobung, Eheschließung, Scheidung und verschiedenen Eheformen wie Raubehe und Friedelehe), ein Kapitel zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau in der frühmittelalterlichen Gesellschaft (inkl. Erbrecht, Besitzrecht, politische Beteiligung und Einfluss der Kirche) und eine Schlussbemerkung.
Welche Aspekte der rechtlichen Stellung der Frau werden behandelt?
Das Kapitel zur rechtlichen Stellung konzentriert sich auf Ehe und Eherecht, analysiert die Muntgewalt, Verlobung, Eheschließung und Scheidung sowie verschiedene Eheformen. Es beleuchtet die rechtlichen Abhängigkeiten und die daraus resultierenden eingeschränkten Rechte der Frau im Vergleich zu Männern.
Wie wird die soziale Stellung der Frau im frühen Mittelalter betrachtet?
Die soziale Stellung der Frau wird im Kontext von Erbrecht, Besitzrecht, möglicher politischer Beteiligung und dem Einfluss der Kirche und ihrer christlichen Eheauffassung untersucht. Die Arbeit analysiert, wie diese Faktoren die Möglichkeiten und Beschränkungen der weiblichen Lebensgestaltung beeinflussten und die soziale Hierarchie widerspiegelten.
Welche Rolle spielt die Kirche in der Hausarbeit?
Die Rolle der Kirche und ihre christliche Eheauffassung wird als wichtiger Einflussfaktor auf das Leben und die Rechte von Frauen analysiert. Der Einfluss der Kirche wird in Verbindung mit den rechtlichen Aspekten gesetzt, um ein umfassenderes Bild der weiblichen Lebensrealität zu zeichnen.
Welche Quellen wurden verwendet und welche Herausforderungen gab es bei der Forschung?
Die Hausarbeit erwähnt die eingeschränkte Quellenlage und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Forschung zu diesem Thema. Die Einleitung skizziert die verwendeten Quellen und die methodische Herangehensweise der Autorin.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Frau, frühes Mittelalter, Rechtsstellung, soziale Stellung, Ehe, Eherecht, Muntgewalt, Erbrecht, Besitzrecht, Kirche, christliche Eheauffassung, Männergesellschaft, Geschlechterverhältnisse, Quellenlage, mittelalterliche Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Andrea Becker (Autor:in), 1998, Die rechtliche und soziale Stellung der Frau im frühen Mittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3698