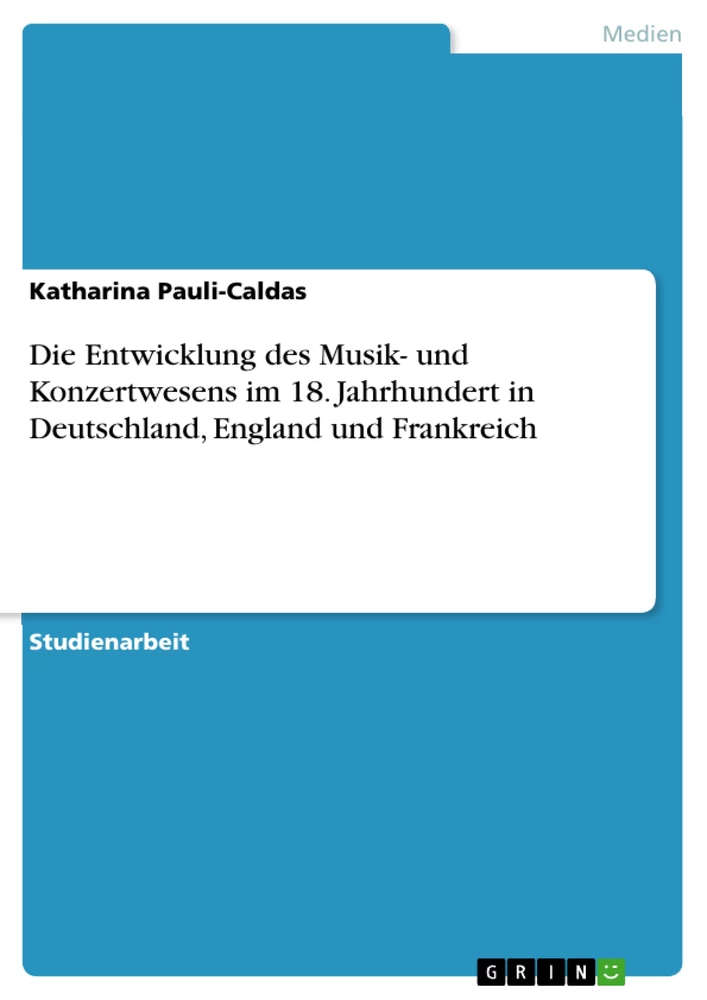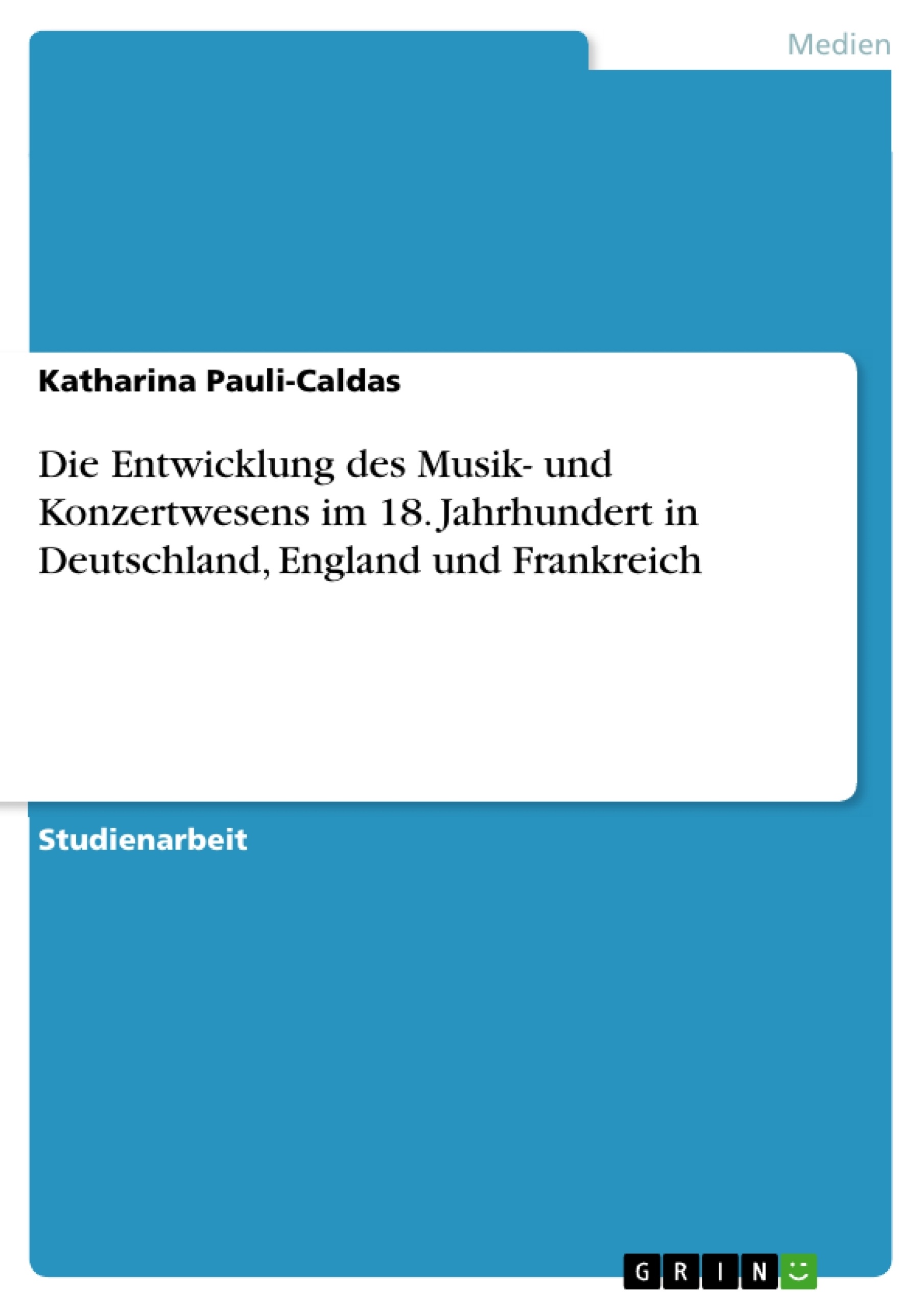Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Aufkommen der Musik- und Konzertinstitutionen im 18. Jahrhundert. Sie setzt dabei den Fokus auf England (London), Frankreich (Paris) und Deutschland. Dieses Thema ist deshalb relevant, weil sich gerade in diesen Bereichen sehr viel getan hat: Zum Beispiel wurde das Konzert mit der distinkten Rolle des Publikums und eigens für diese Anlässe reservierten Räumlichkeiten, wie wir es heutzutage kennen, erst in diesen Jahrzehnten wirklich etabliert.Daraus entwickelte sich ein verändertes Bewusstsein von Musik, welches anhand der wichtigsten Musik- und Konzertinstitutionen sowie den neuen Entwicklungen in diesem Bereich, die in dieser Arbeit besprochen werden, erkennbar wird.
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile und wird mit einem Fazit abgeschlossen. In den drei Teilen wird jeweils das Musik- und Konzertwesen Deutschlands, Englands und Frankreichs im 18. Jahrhundert untersucht und seine Entwicklung in dieser Zeit dargestellt.
Aufgrund der Tatsache, dass das Konzertwesen im 18. Jahrhundert fast in ganz Europa einen großen Aufschwung und Fortschritt erlebte, musste der Fokus dieser Arbeit auf die drei oben genannten Länder eingegrenzt werden. Diese Auswahl wurde getroffen, da Deutschland, England und Frankreich die Vorreiterrolle in diesen Entwicklungen einnahmen und eine umfassendere Bearbeitung des Themas den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Aus eben diesem Grunde musste die genauere Untersuchung weiter auf diejenigen Orte beschränkt werden, welche für das Musik– und Konzertwesen dieser Länder von besonderer Relevanz sind: In Deutschland sind dies Berlin und Leipzig, in England London und in Frankreich Paris. Die Arbeit gliedert sich entsprechend dieser Reihenfolge.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutschland
- Berlin
- Musik am (und durch den) preußischen Hof
- Öffentliches Musikwesen
- Leipzig
- Berlin
- England (London)
- Frankreich (Paris)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und dem Aufkommen von Musik- und Konzertinstitutionen im 18. Jahrhundert, mit einem Fokus auf England (London), Frankreich (Paris) und Deutschland. Das 18. Jahrhundert war eine Zeit bedeutender Veränderungen im Musik- und Konzertwesen, mit der Etablierung des modernen Konzertformats und einem sich verändernden Bewusstsein für Musik. Die Arbeit untersucht diese Entwicklungen anhand der wichtigsten Musik- und Konzertinstitutionen und den neuen Entwicklungen in diesem Bereich.
- Die Etablierung des modernen Konzertformats im 18. Jahrhundert
- Die Rolle des Publikums im Konzertwesen
- Die Bedeutung des Hofes für die Entwicklung der Musikkultur
- Die Herausbildung einer bürgerlichen Musikkultur
- Die Rolle von Musikstädten wie Berlin und Leipzig in der musikalischen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz des 18. Jahrhunderts für die Entwicklung des Musik- und Konzertwesens. Sie stellt die drei Fokusländer - England, Frankreich und Deutschland - vor und begründet die Auswahl dieser Länder.
- Deutschland: Dieses Kapitel untersucht das Musik- und Konzertwesen in Deutschland im 18. Jahrhundert. Es konzentriert sich auf die beiden wichtigsten Städte, Berlin und Leipzig, und beleuchtet die Rolle des Hofes und die Entwicklung des öffentlichen Musikwesens.
- Berlin: Dieses Kapitel befasst sich mit der Musik am preußischen Hof und dem öffentlichen Musikwesen in Berlin. Es zeigt, wie die Musik am Hof unter Friedrich II. eine Blütezeit erlebte und wie sich gleichzeitig eine eigene bürgerliche Musikkultur entwickelte.
- Leipzig: Dieses Kapitel untersucht das Musik- und Konzertwesen in Leipzig, einer weiteren wichtigen Musikstadt in Deutschland.
- England (London): Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung des Musik- und Konzertwesens in London, einer der wichtigsten Musikmetropolen des 18. Jahrhunderts.
- Frankreich (Paris): Dieses Kapitel betrachtet das Musik- und Konzertwesen in Paris, einer weiteren bedeutenden Musikmetropole im 18. Jahrhundert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Musik- und Konzertwesen, Hofmusik, öffentliche Musik, bürgerliche Musikkultur, Konzertformat, Entwicklung des Musikwesens im 18. Jahrhundert, Deutschland, England, Frankreich, Berlin, Leipzig, London, Paris. Sie beleuchtet wichtige Konzepte wie die Etablierung des modernen Konzertformats, die Rolle des Publikums, die Bedeutung des Hofes und die Herausbildung einer bürgerlichen Musikkultur.
- Quote paper
- Katharina Pauli-Caldas (Author), 2016, Die Entwicklung des Musik- und Konzertwesens im 18. Jahrhundert in Deutschland, England und Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369864