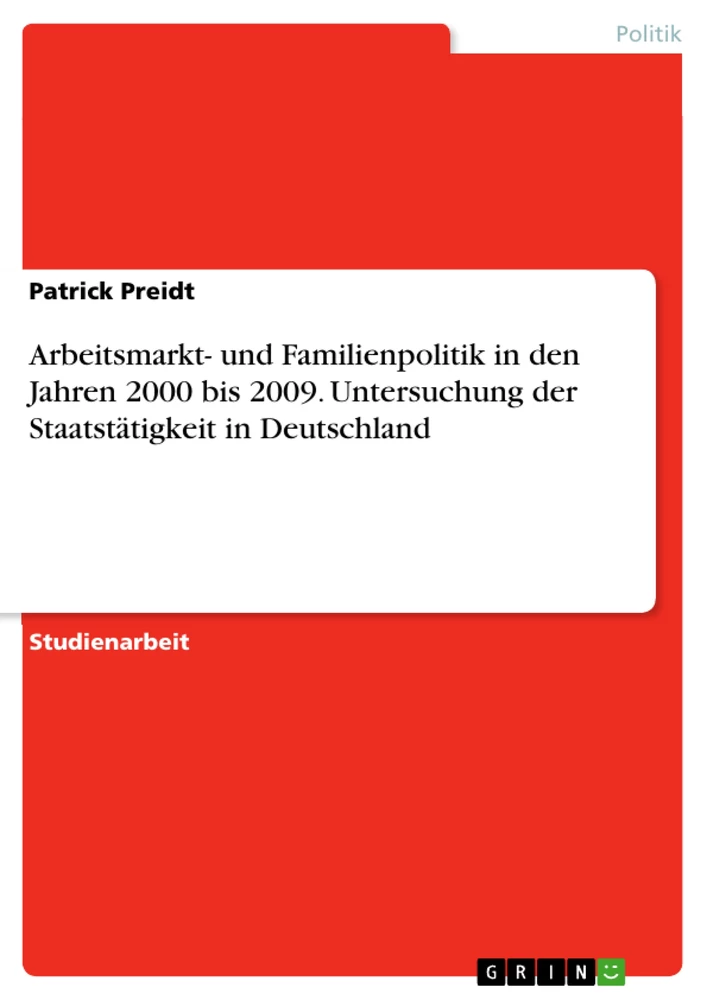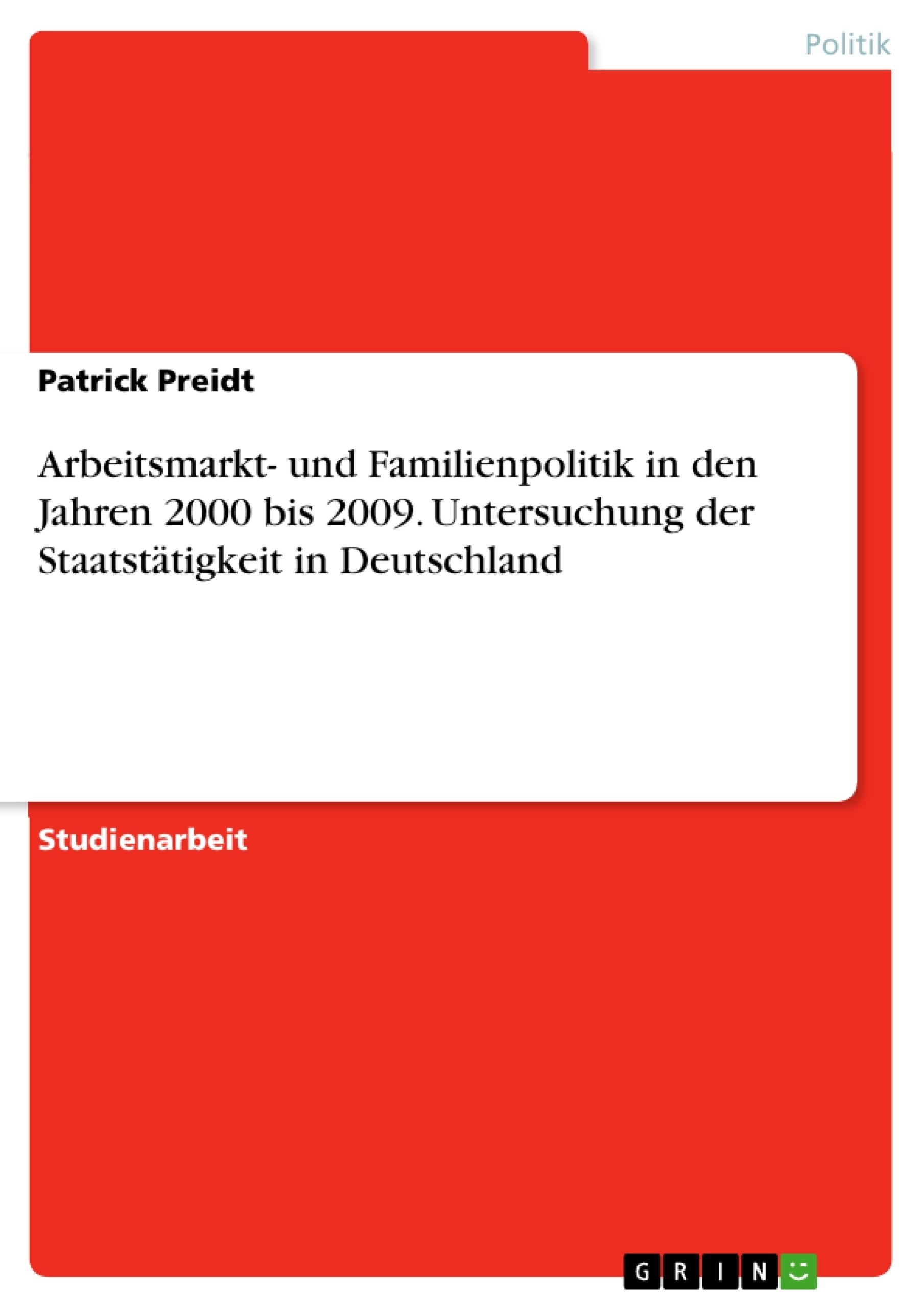Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen Feld der Wohlfahrtsstaatsforschung in Deutschland. Im Mittelpunkt der Arbeit steht dabei die Analyse der Staatstätigkeit in der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik in den 2000er Jahren. Politische und gesellschaftliche Probleme, wie der demografische Wandel, veränderte soziokulturelle Rahmenbedingungen sowie hohe Arbeitslosigkeit ließen gerade konservative Wohlfahrtsstaaten ab Ende der 1990er Jahre zu liberalen politischen Instrumenten greifen. Dabei geht es vor allem um die Frage, inwieweit der Sozialstaat durch die politischen Maßnahmen der Bundesregierung umgestaltet wurde. Die sozialpolitische Staatstätigkeit sollte zu einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands führen.
Bei der Analyse der Ursachen für die Staatstätigkeit sollen zudem mögliche Einflüsse verschiedener parteipolitischer Ideologien auf die Politikergebnisse der Regierung untersucht werden. Die politikfeldanalytische Fragestellung lautet: Inwieweit kam es im deutschen Wohlfahrtsstaat, sowohl in der Arbeitsmarkt- als auch in der Familienpolitik, zu einem Wandel, wobei im Feld der Arbeitsmarktpolitik zunehmend eine angebotsorientierte Politik betrieben wird, während sich in der Familienpolitik eine Ausweitung der Sozialausgaben feststellen lässt?
Das Untersuchungsinteresse ergibt sich aus der Tatsache, dass eine (deutliche) Änderung der Wohlfahrtskultur in gewissen Politikfeldern Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hat. Die in dieser Hausarbeit zu untersuchenden Reformen, u.a. die „Agenda 2010“, haben die Arbeitsmarkt- und Familienpolitik deutlich und nachhaltig verändert. Die politikwissenschaftlich-politikfeldanalytische Relevanz des Themas und der Fragestellung besteht darin, dass hier am Beispiel der Reformen im Bereich der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik untersucht werden soll, welche sozioökonomischen, gesellschaftlichen oder partei-ideologischen Voraussetzungen dazu geführt haben, dass Maßnahmen von der Politik ergriffen wurden, um die vielfältigen politischen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problembeschreibung / Relevanz des Themas
- 1.2 Begründung des theoretischen Rahmens / der Methodik
- 1.3 Aufbau der Arbeit / Vorgehensweise
- 2. Vorstellung des theoretischen Rahmens und der Prüfkriterien
- 2.1 Einordnung der These von Obinger/Starke
- 2.2 Sozioökonomische Theorieschule
- 2.3 Parteiendifferenztheorie
- 2.4 Ableitung der Kriterien/Variablen
- 3. Der Sozialstaat in der Krise - Probleme und Herausforderungen in der post-industriellen Gesellschaft
- 3.1 Problemlagen in Deutschland Anfang der 2000er-Jahre
- 3.1.1 Demografischer Wandel
- 3.1.2 Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
- 3.1.3 Reformbedürftigkeit des Arbeitsmarktes / des Sozialsystems
- 3.1.4 Folgen der Globalisierung
- 3.2 Zentrale Akteure/Institutionen in Deutschland
- 3.2.1 Zentrale Akteure/Institutionen in der Arbeitsmarktpolitik
- 3.2.2 Zentrale Akteure/Institutionen in der Familienpolitik
- 4. Der Sozialstaat im Wandel – vom fürsorgenden zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat
- 4.1 Staatstätigkeit in der Arbeitsmarktpolitik
- 4.1.1 Anwendung der Sozioökonomischen Theorieschule
- 4.1.2 Anwendung der Parteidifferenztheorie
- 4.2 Staatstätigkeit in der Familienpolitik
- 4.2.1 Anwendung der Sozioökonomischen Theorieschule
- 4.2.2 Anwendung der Parteidifferenztheorie
- 5. Schluss / Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Veränderungen im deutschen Sozialstaat in den Jahren 2000 bis 2009, speziell im Bereich der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik. Es wird untersucht, ob die staatspolitischen Maßnahmen zu einer liberalen Umgestaltung des Sozialstaates führten und welche Ursachen dafür verantwortlich sind. Hierzu werden die sozioökonomischen und parteipolitischen Einflüsse auf die Reformen betrachtet.
- Entwicklung des deutschen Sozialstaates in den 2000er Jahren
- Einfluss des demografischen Wandels und der Globalisierung auf die Sozialpolitik
- Analyse der Reformen im Bereich der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik
- Anwendung der sozioökonomischen Theorieschule und der Parteiendifferenztheorie
- Bewertung der Veränderungen im Hinblick auf die These vom Wandel zu einem "angebotsorientierten Wohlfahrtsstaat"
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Vorstellung des theoretischen Rahmens und der Prüfkriterien
- Kapitel 3: Der Sozialstaat in der Krise - Probleme und Herausforderungen in der post-industriellen Gesellschaft
- Kapitel 4: Der Sozialstaat im Wandel – vom fürsorgenden zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat
Das Kapitel stellt die Relevanz der Untersuchung des deutschen Sozialstaates im Kontext der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik in den Jahren 2000 bis 2009 dar. Es wird die Fragestellung formuliert und die theoretischen Konzepte der Sozioökonomischen Theorieschule und der Parteiendifferenztheorie eingeführt.
Das Kapitel stellt die These von Obinger/Starke zur Transformation des Wohlfahrtsstaates in den OECD-Staaten vor. Anschließend werden die beiden theoretischen Konzepte, die Sozioökonomische Theorieschule und die Parteiendifferenztheorie, detailliert erklärt und die daraus resultierenden Prüfkriterien für die Analyse abgeleitet.
In diesem Kapitel werden die Problemlagen in Deutschland Anfang der 2000er-Jahre, wie demografischer Wandel, veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die Reformbedürftigkeit des Arbeitsmarktes/Sozialsystems und Folgen der Globalisierung, dargestellt. Außerdem werden die zentralen Akteure und Institutionen in der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik vorgestellt.
Dieses Kapitel analysiert die Staatstätigkeit in der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik. Es werden die sozioökonomischen und parteipolitischen Einflüsse auf die Reformen untersucht, um die Veränderungen des Wohlfahrtsstaates im Kontext der "supply-side welfare state"-These zu bewerten.
Schlüsselwörter
Sozialstaat, Arbeitsmarktpolitik, Familienpolitik, Sozioökonomische Theorieschule, Parteiendifferenztheorie, Demografischer Wandel, Globalisierung, "supply-side welfare state", Deutschland, Wohlfahrtsstaatsforschung, Reformen, Agenda 2010, Kommodifizierung, Stratifizierung, De-Familialisierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich der deutsche Wohlfahrtsstaat zwischen 2000 und 2009?
Es fand ein Wandel vom fürsorgenden zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat statt, geprägt durch angebotsorientierte Arbeitsmarktpolitik und eine Ausweitung der Familienpolitik.
Was war die „Agenda 2010“?
Die Agenda 2010 war ein umfassendes Reformpaket der rot-grünen Bundesregierung zur Umgestaltung des Arbeitsmarktes und der Sozialsysteme in Deutschland.
Welche Rolle spielt die Parteiendifferenztheorie in dieser Analyse?
Die Theorie untersucht, inwieweit die jeweilige Regierungsideologie (z.B. konservativ vs. liberal) die konkreten Ergebnisse der Sozial- und Familienpolitik beeinflusst hat.
Warum wurde die Familienpolitik in den 2000er Jahren ausgeweitet?
Gründe waren der demografische Wandel und die Notwendigkeit, durch Maßnahmen wie den Ausbau der Kinderbetreuung die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen.
Welche sozioökonomischen Herausforderungen prägten diesen Zeitraum?
Zentrale Probleme waren die hohe Arbeitslosigkeit Anfang der 2000er, die Folgen der Globalisierung und die Überalterung der Gesellschaft.
Was versteht man unter einem „aktivierenden“ Sozialstaat?
Ein aktivierender Staat setzt verstärkt auf Eigenverantwortung der Bürger und knüpft Sozialleistungen an Bedingungen (Fördern und Fordern), um Menschen schneller in Arbeit zu bringen.
- Citar trabajo
- Patrick Preidt (Autor), 2017, Arbeitsmarkt- und Familienpolitik in den Jahren 2000 bis 2009. Untersuchung der Staatstätigkeit in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370274