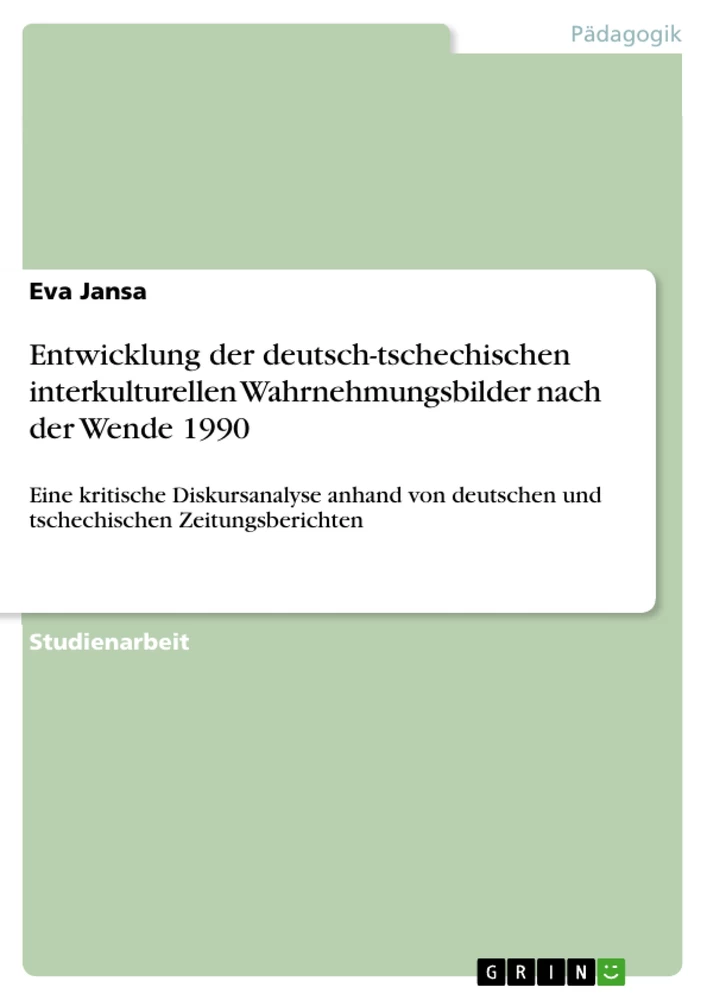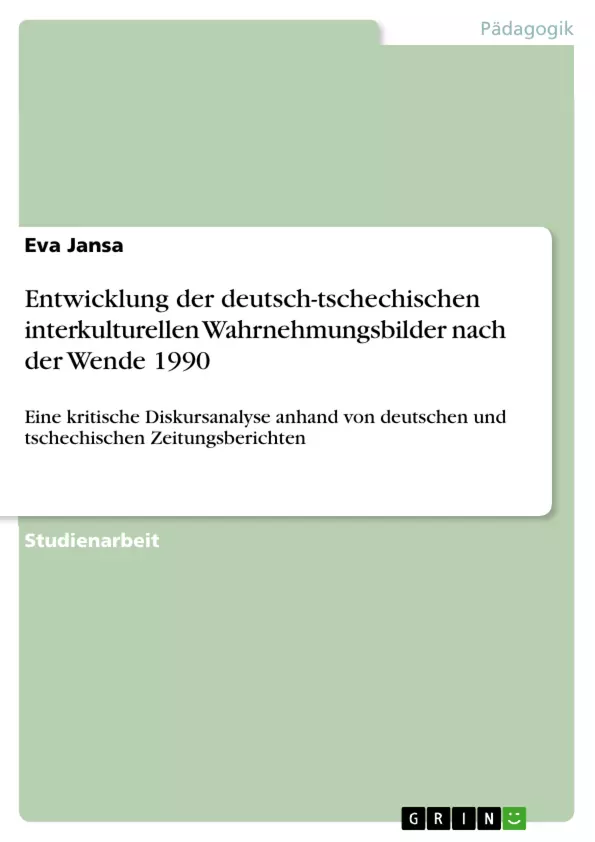Das wechselseitige Verhältnis beider Länder – der heutigen Tschechischen Republik und des nach der Wende wiedervereinigten Deutschlands – ist durch die verflochtene Geschichte vielseitig beeinflusst. Auf dieser Grundlage entstanden nicht nur greifbare kulturelle Gemeinsamkeiten, sondern auch viele Wahrnehmungsstereotypen, welche dann durch die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges vielfach verstärkt aufgetreten sind. Die Nachkriegsgeschichte unter dem Eisernen Vorhang konnte durch die mangelnde Kommunikationsmöglichkeit und ein teilweise bis vollkommen verzerrtes gegenseitiges Realitätsbild keine Korrektur der Wahrnehmung bringen.
Im ersten Teil der Seminararbeit werden theoretische Grundlagen und der methodologische Ansatz – v. a. die kritische Diskursanalyse – erörtert. Der zweite Teil fasst dann einen Rückblick auf die interkulturelle Beeinflussung im geschichtlichen Rahmen zusammen und beinhaltet auch einen Versuch das gegenseitige Bild in der Zeit des Kalten Krieges anhand der damals erschienenen literarischen Werke kurz zu erfassen. Im dritten Hauptteil wird die neueste Entwicklung – im Zeitrahmen von 1990 bis 2012 – untersucht. Es wird die Hypothese untersucht, ob die Grenzöffnung und der vermehrte gegenseitige Kontakt zum Abbau der Stereotypen und Normalisierung der jeweiligen Wahrnehmung im Sinne der Kommunikation mit einem objektiv wahrgenommenen Partner beigetragen haben.
Als Methode wird die kritische Diskursanalyse angewendet, als Datenkorpora wurden Zeitungsartikel führender tschechischer und deutscher Tageszeitungen aus den Jahren 1990 bis 2012, recherchiert nach einheitlichen thematischen Kriterien, ausgewählt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Zum Begriff „Diskurs“
- Diskursbereiche und ihre Forschung
- Die Kritische Diskursanalyse
- Korpuslinguistik
- Kulturgeschichtliche Gemeinsamkeiten und Differenzen
- Entwicklung des gegenseitigen Wahrnehmungsbildes nach der Wende bis 2012
- Spezifikation des methodischen Vorgehens und der Materialbasis (Korpusbasierte Analyse)
- Statistische Untersuchung und Auswertung von thematischen Korpora (FAZ und Lidové noviny 1995-2012)
- Qualitative Diskursanalyse anhand ausgewählter Texte (FAZ, SZ, Lidové noviny, MF Dnes in den Jahren 1993-2012)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Entwicklung des deutsch-tschechischen interkulturellen Wahrnehmungsbildes nach der Wende 1990 anhand von Zeitungsartikeln. Ziel ist es, herauszufinden, ob die Grenzöffnung und der verstärkte Kontakt zum Abbau von Stereotypen und zur Normalisierung der Wahrnehmung geführt haben.
- Die Bedeutung von Diskurstheorien für die Analyse von interkulturellen Beziehungen
- Kulturgeschichtliche Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik
- Die Rolle von Zeitungsartikeln als Quelle für die Analyse von Wahrnehmungsbildern
- Die Anwendung der kritischen Diskursanalyse für die Analyse von Textkorpora
- Die Untersuchung der Entwicklung des deutsch-tschechischen Wahrnehmungsbildes nach der Wende bis 2012
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung des deutsch-tschechischen Verhältnisses im historischen Kontext. Sie skizziert die Forschungsfrage und die methodischen Ansätze der Arbeit.
Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" erläutert den Begriff des Diskurses, verschiedene Diskurstheorien und die kritische Diskursanalyse als Forschungsmethode. Es wird der methodische Ansatz der Arbeit näher ausgeführt.
Das Kapitel "Kulturgeschichtliche Gemeinsamkeiten und Differenzen" gibt einen Überblick über die gemeinsame Geschichte und die kulturelle Prägung Deutschlands und der Tschechischen Republik. Es beleuchtet die Entstehung von Stereotypen und deren Auswirkungen auf die gegenseitige Wahrnehmung.
Das Kapitel "Entwicklung des gegenseitigen Wahrnehmungsbildes nach der Wende bis 2012" untersucht die Veränderungen in der Wahrnehmung nach der Wende. Es analysiert Zeitungsartikel aus deutschen und tschechischen Tageszeitungen mit Hilfe der kritischen Diskursanalyse.
Schlüsselwörter
Kritische Diskursanalyse, interkulturelle Kommunikation, Wahrnehmungsbilder, Stereotype, deutsch-tschechische Beziehungen, Zeitungsartikel, Korpuslinguistik, historische Diskursanalyse, Beneš-Dekrete, Topoi.
- Quote paper
- Eva Jansa (Author), 2013, Entwicklung der deutsch-tschechischen interkulturellen Wahrnehmungsbilder nach der Wende 1990, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370346