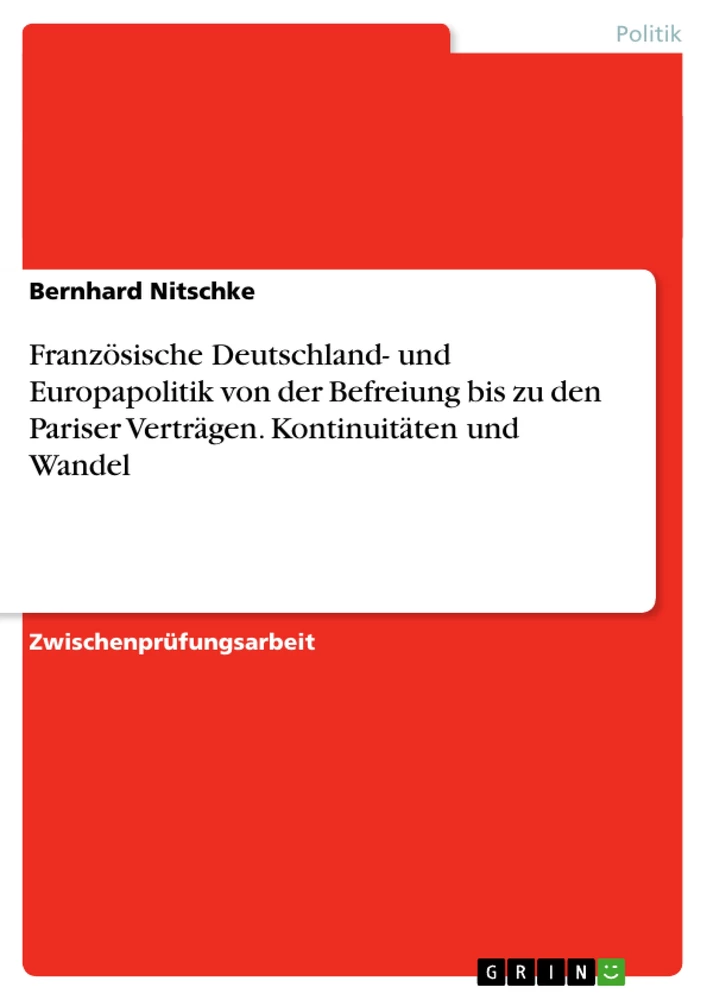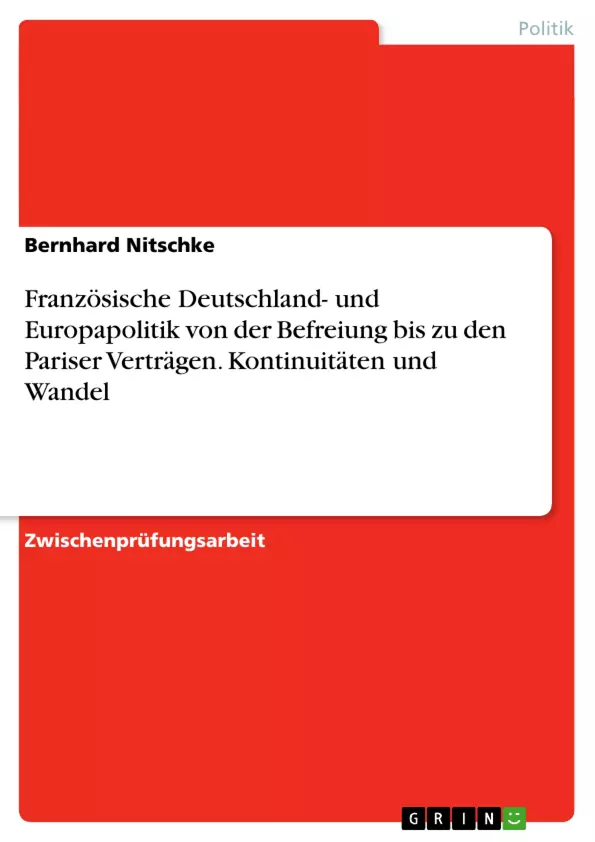In der frz. Wahrnehmung der 40er und 50er Jahre musste Deutschland zwangsläufig der Orientierungspunkt allen außenpolitischen Handelns sein. Die Erfahrungen dreier Kriege und eine schier unüberbrückbare Rivalität weisen de Gaulles – pathetisch überhöhte - Einschätzung als außenpolitische Konstante zumindest der ersten Nachkriegsjahre aus: „In Wirklichkeit ist das Schicksal Deutschlands das zentrale Problem des Universums. Für Frankreich ist es gleichzeitig eine Frage auf Leben und Tod“. Auch als der Ost-West-Konflikt und die potenzielle Bedrohung durch die SU die germanophobe Deutschlandfixiertheit (auch bei den späteren „Versöhnern“ des MRP), wenn nicht ablöst, dann doch mindestens überlagert, bleibt Deutschland Sinn – und Bezugspunkt frz. Außenpolitik; der kalte Krieg und die ungelöste Deutschlandfrage paralysieren und determinieren gleichzeitig die Akteure des Quai d’Orsay. Die in dieser Arbeit besprochene Europapolitik ist deshalb auch immer wieder gleichzeitig Deutschlandpolitik. Hier wird auch dem Besatzungsregime in der FBZ ein relativ großer Raum gegeben, weil an ihm einerseits die Begrenztheit der Handlungsmöglichkeiten, andererseits die Widersprüchlichkeit in den deutschland-, und letztlich weltpolitischen Zielen Frankreichs deutlich werden. Außerdem kann hierin der Versöhnungstopos deutsch-französischer Nachkriegsgeschichte überprüft werden, ein zumindest für Frankreich, das Deutschland langfristig als Partner gewinnen musste und wollte, wichtiger Aspekt.
Anmerkungen: Die Arbeit setzt Französischkenntnisse voraus, da oft im Original zitiert wird. Schwerpunkte: französische Besatzungspolitik, französisch-sowjetische Beziehungen und die "Deutschlandakteure" der frz. Außenpolitik: de Gaulle, Bidault, Schuman und Pleven.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorgehensweise
- 3. Frankreich und die Sowjetunion: prinzipielle Divergenzen und punktuelle Interessenkoinzidenzen
- 3.1 Vom 28.9.42 (Anerkennung des CNF durch die SU) bis zum Kriegsende am 8. Mai 1945
- 3.2 Deutschlandpolitische Divergenzen hinsichtlich der Grenzen und der staatlichen Struktur eines zukünftigen Deutschlands
- 3.3 Scheinbare Koinzidenz frz. und sowjetischer Deutschlandpolitik - Die Internationalisierung der Ruhr
- 3.4 Das Ende theoretischer frz.-sowjetischer Gemeinsamkeiten - Die Wende in der frz. Deutschlandpolitik
- 4. Handlungswille und Handlungsfähigkeit auf dem Prüfstand: Die frz. Besatzungszone(n) in Südwestdeutschland
- 4.1 Das Zustandekommen
- 4.2 Widersprüchliche Zielvorgaben
- 4.3 „Verkorkste Zone“ von Anfang an
- 4.4 Flexibilität als Ausdruck von Unsicherheit – Frankreichs unklare Vorstellungen über die Zukunft der Einzelteile der FBZ. Das Beispiel Saarland.
- 4.5 Die Besatzungszeit in frz. und deutscher Perzeption – Verstärkung der gegenseitigen Ressentiments
- 5. Die deutschland- und europapolitischen Akteure
- 5.1 De Gaulle
- 5.2 Georges Bidault
- 5.3 Robert Schuman
- 5.4 René Pleven
- 6. Resumee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die französische Deutschland- und Europapolitik in der Zeit von der Befreiung bis zu den Pariser Verträgen. Sie beleuchtet, inwieweit Frankreich eine kohärente Deutschlandpolitik verfolgte und ob es in der post-kriegsbedingten Schwäche Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Europa und insbesondere Deutschland besaß. Dabei werden sowohl die prinzipiellen Divergenzen als auch die punktuellen Interessenkoinzidenzen zwischen Frankreich und der Sowjetunion analysiert. Die Arbeit beleuchtet auch die Herausforderungen und Widersprüche, denen Frankreich in seiner Besatzungszone in Südwestdeutschland begegnete.
- Die Rolle Frankreichs im Konzert der Großen
- Die widersprüchliche Positionierung Frankreichs zwischen grandeur und Schwäche
- Die Bedeutung der Deutschlandfrage für die französische Außenpolitik
- Der Einfluss der Besatzungszone auf die deutsch-französischen Beziehungen
- Die Relevanz des europäischen Integrationsprozesses im Kontext der deutschen Frage
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der französischen Deutschland- und Europapolitik nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Die Einleitung wirft zwei grundsätzliche Fragen auf: ob es konsistente politische Ziele gab und ob Frankreich trotz seiner Schwäche Handlungsspielraum besaß.
Kapitel 2 skizziert die Vorgehensweise der Arbeit. Es werden die wichtigsten Akteure der französischen Außenpolitik vorgestellt und die Bedeutung der Besatzungszone für die deutsche Frage hervorgehoben.
Kapitel 3 beleuchtet die Beziehung zwischen Frankreich und der Sowjetunion während der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es werden die prinzipiellen Divergenzen sowie punktuelle Interessenkoinzidenzen in Bezug auf Deutschland analysiert.
Kapitel 4 untersucht die französische Besatzungszone in Südwestdeutschland. Die Widersprüchlichen Zielvorgaben und die Herausforderungen, denen Frankreich begegnete, werden detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der deutschen Frage, dem europäischen Integrationsprozess, der französischen Deutschlandpolitik, dem Verhältnis zwischen Frankreich und der Sowjetunion, sowie dem französischen Besatzungsregime in Südwestdeutschland. Sie beleuchtet die Rolle wichtiger Akteure wie de Gaulle, Bidault, Schuman und Pleven. Die Arbeit greift auf Konzepte wie grandeur, Selbstwahrnehmung, Handlungsspielraum und Handlungsfähigkeit zurück.
Häufig gestellte Fragen
Warum war Deutschland nach 1945 der zentrale Punkt der französischen Außenpolitik?
Aufgrund der Erfahrungen aus drei Kriegen galt das Schicksal Deutschlands für Frankreich als Überlebensfrage. Die Sicherheit vor Deutschland war die außenpolitische Konstante der Nachkriegsjahre.
Welche Rolle spielte die französische Besatzungszone (FBZ)?
An der FBZ zeigten sich die widersprüchlichen Ziele Frankreichs: Einerseits der Wunsch nach Kontrolle und Schwächung Deutschlands, andererseits die Notwendigkeit, Deutschland langfristig als Partner zu gewinnen.
Wie verhielt sich Frankreich gegenüber der Sowjetunion in der Deutschlandfrage?
Es gab punktuelle Interessenkoinzidenzen, etwa bei der Internationalisierung der Ruhr, aber auch tiefe Divergenzen hinsichtlich der staatlichen Struktur eines zukünftigen Deutschlands.
Wer waren die prägenden Akteure der französischen Außenpolitik in dieser Zeit?
Zentrale Figuren waren Charles de Gaulle, Georges Bidault, Robert Schuman und René Pleven, die jeweils unterschiedliche Ansätze zur Deutschland- und Europapolitik verfolgten.
Was versteht man unter dem Begriff „Grandeur“ in diesem Zusammenhang?
„Grandeur“ beschreibt den französischen Anspruch auf eine bedeutende Weltmachtrolle, der oft im Kontrast zur tatsächlichen wirtschaftlichen und militärischen Schwäche nach dem Krieg stand.
Wie entwickelte sich die Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich?
Die Arbeit untersucht den „Versöhnungstopos“ kritisch und prüft, wie aus der anfänglichen Rivalität und gegenseitigen Ressentiments der Weg zur europäischen Integration geebnet wurde.
- Quote paper
- Bernhard Nitschke (Author), 2005, Französische Deutschland- und Europapolitik von der Befreiung bis zu den Pariser Verträgen. Kontinuitäten und Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37050