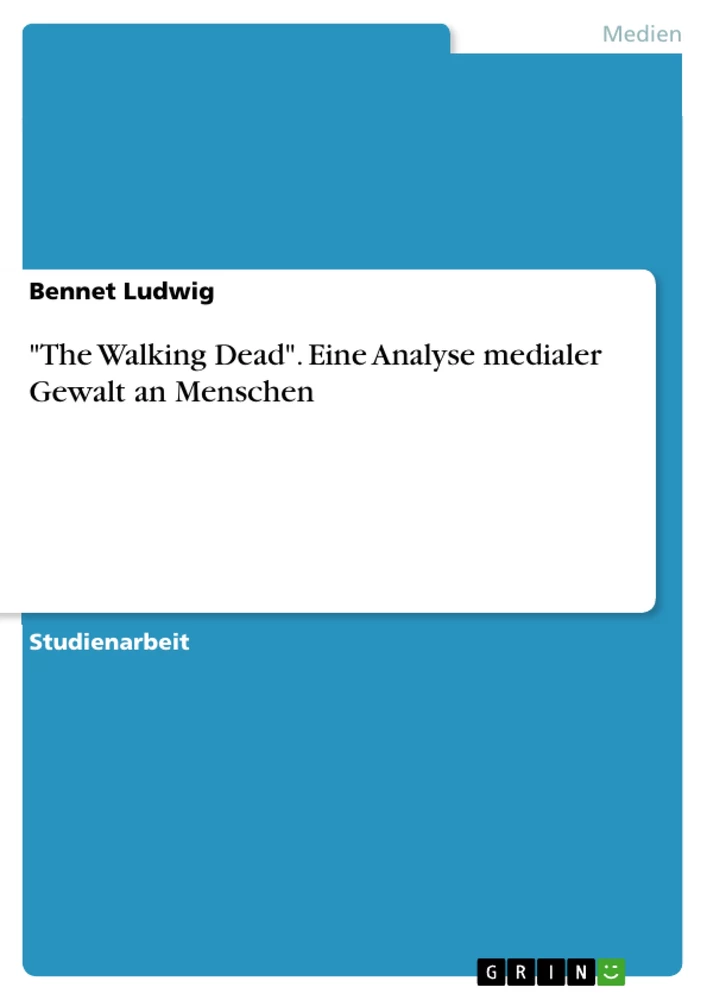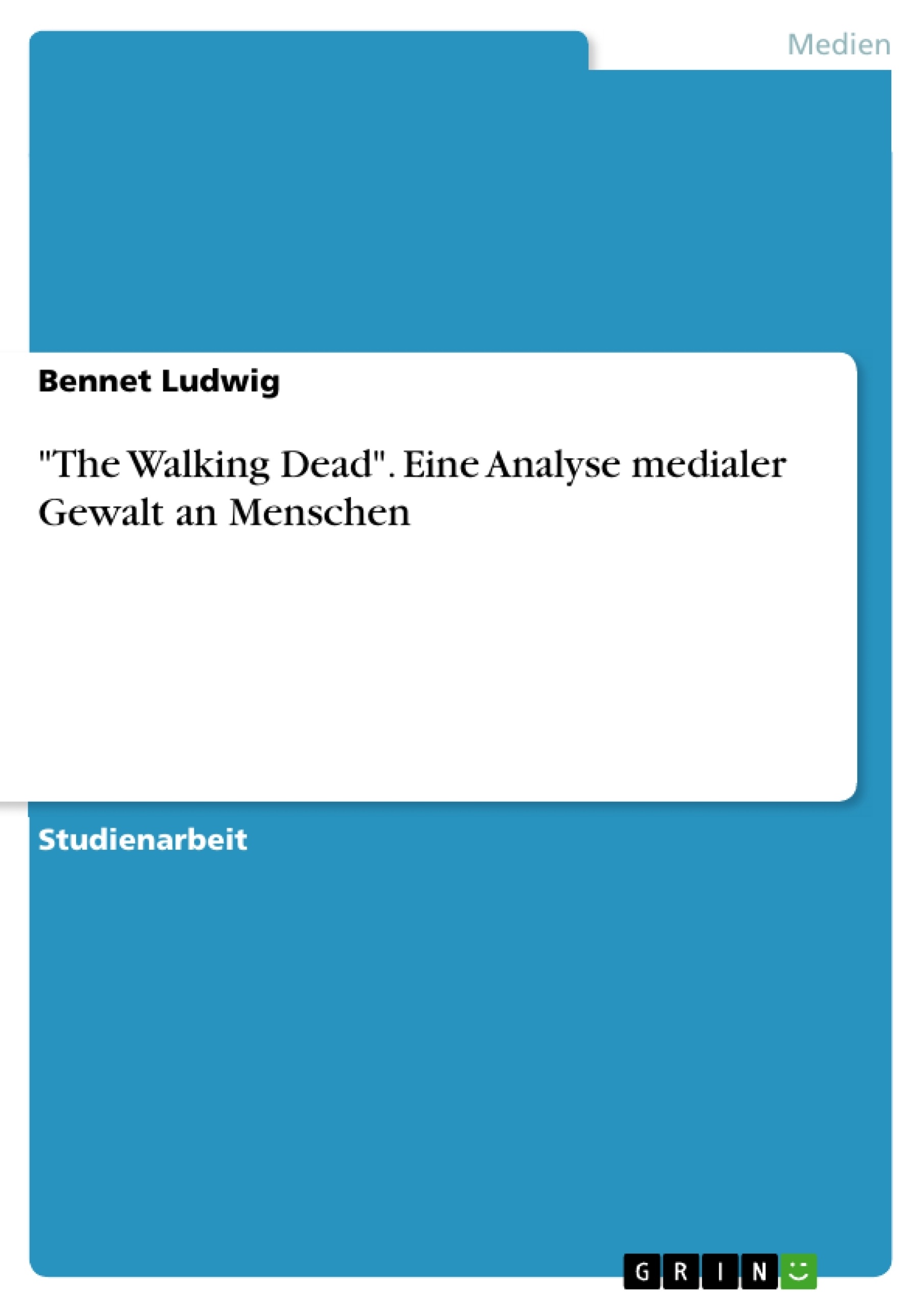In den Medien ist Gewalt ein heikles Thema, insbesondere wenn diese sich gegen Menschen richtet. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Gewaltdarstellungen und ihren Botschaften. Diese Arbeit versucht anhand der Entwicklung einer bestimmten Figur herauszuarbeiten, wie die tödliche Gewalt zwischen Menschen in der Serie inszeniert und welche Wirkung damit erzielt wird. Dazu ist es wichtig herauszuarbeiten, wer die Gewalt einsetzt und gegen wen diese gerichtet ist. Auch der Kontext der Inszenierung soll herausgearbeitet werden.
Zunächst werden dafür einige grundlegende Aspekte der Serie bezüglich ihres Genres und ihrer Besonderheiten erarbeitet. Danach wird die Figur der Carol Peletier charakterisiert und ihre Figurenentwicklung festgehalten. Auf dieser Grundlage werden in den darauf folgenden Szenenanalysen die zwischenmenschlichen Gewaltdarstellungen innerhalb der Serie genauer untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gewalt und Zombie-Apokalypse
- 3. Carol Peletier und die Gewalt
- 4. Szenenanalyse
- 4.1. Beispiel 1: Die Exekution der Lizzie Samuels
- 4.2. Beispiel 2: Die Flucht vor den Saviors
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Gewalt zwischen Menschen in der Fernsehserie "The Walking Dead". Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Figur Carol Peletier und wie ihre Handlungen die Thematisierung von Gewalt und Moral in einem postapokalyptischen Setting beleuchten.
- Gewalt als Überlebensmechanismus in einer Zombie-Apokalypse
- Die Entwicklung der Figur Carol Peletier und ihre moralische Wandlung
- Die Inszenierung von Gewalt und deren Wirkung auf den Zuschauer
- Die ethischen Implikationen von Gewaltanwendung in Extremsituationen
- Der Vergleich von zwischenmenschlicher Gewalt und der Gewalt durch Zombies
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gewalt in Medien, insbesondere im Horrorgenre, ein und stellt die Verbindung zwischen Gewalt und dem Horror-Genre fest. Sie benennt die Notwendigkeit, Gewalt nicht pauschal zu bewerten, sondern im Kontext des Genres und der Geschichte zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung von Gewalt zwischen Menschen in "The Walking Dead" und untersucht die Entwicklung von Carol Peletier als Beispiel für die Auseinandersetzung mit Gewalt in der Serie.
2. Gewalt und Zombie-Apokalypse: Dieses Kapitel beschreibt das Setting von "The Walking Dead" als Zombie-Horror und betont den Ausbruch eines Virus als zentralen Punkt der Handlung. Im Gegensatz zu vielen anderen Zombiefilmen konzentriert sich die Serie jedoch auf die Überlebenden und ihre Bemühungen, eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen. Das Kapitel hebt die allgegenwärtige Bedrohung durch Zombies und andere Menschen hervor und betont die Ambivalenz der Gewaltanwendung im Kampf ums Überleben. Die zwischenmenschliche Gewalt wird im Kontext des moralischen und ethischen Handelns der Figuren analysiert.
3. Carol Peletier und die Gewalt: Dieses Kapitel charakterisiert Carol Peletier als vorsichtige und pragmatische Frau, die in ihrem früheren Leben häuslicher Gewalt ausgesetzt war. Es wird ihre Entwicklung im Verlauf der Serie beschrieben, insbesondere wie sie von einer nicht-gewalttätigen Person zu einer Person wird, die Gewalt als Mittel zum Überleben und Schutz einsetzt. Die Kapitel beschreibt Carol's Veränderung als Reaktion auf den Verlust ihrer Familie und die Herausforderungen des postapokalyptischen Lebens. Ihre moralische Ambivalenz wird hervorgehoben und ihre Handlungsweisen im Kontext der extremen Lebensumstände analysiert.
Schlüsselwörter
Gewalt, Zombie-Apokalypse, The Walking Dead, Carol Peletier, Moral, Ethik, Überleben, Postapokalypse, Szenenanalyse, Figurenentwicklung, Medienwirkung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Gewalt und Moral in The Walking Dead: Eine Analyse der Figur Carol Peletier"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Gewalt zwischen Menschen in der Fernsehserie "The Walking Dead", insbesondere die Entwicklung der Figur Carol Peletier und deren moralische Wandlung im Kontext einer postapokalyptischen Welt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Gewalt als Überlebensmechanismus, der Entwicklung von Carol Peletier, der Inszenierung von Gewalt und deren Wirkung auf den Zuschauer, den ethischen Implikationen von Gewaltanwendung in Extremsituationen und dem Vergleich zwischenmenschlicher Gewalt mit der Gewalt durch Zombies. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der moralischen Ambivalenz von Gewalt im Kontext der Serie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Gewalt und Zombie-Apokalypse, ein Kapitel über Carol Peletier und ihre Entwicklung, eine Szenenanalyse mit Beispielen und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Thematik vor und erläutert die Notwendigkeit, Gewalt im Kontext zu analysieren. Kapitel 2 beschreibt das Setting von "The Walking Dead". Kapitel 3 konzentriert sich auf Carol Peletier und ihre moralische Wandlung. Die Szenenanalyse untersucht konkrete Beispiele aus der Serie. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche konkreten Szenen werden analysiert?
Die Szenenanalyse untersucht exemplarisch die Exekution von Lizzie Samuels und die Flucht vor den Saviors. Diese Szenen dienen dazu, Carol Peletiers Entwicklung und ihre Handlungsweisen im Umgang mit Gewalt zu veranschaulichen.
Wie wird Carol Peletier in der Arbeit dargestellt?
Carol Peletier wird als komplexe Figur beschrieben, die durch ihre Lebensumstände und den Verlust ihrer Familie eine tiefgreifende Veränderung durchmacht. Sie entwickelt sich von einer friedfertigen Person zu einer pragmatischen Frau, die Gewalt als Mittel zum Überleben und Schutz einsetzt. Ihre moralische Ambivalenz steht dabei im Mittelpunkt der Analyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Gewalt, Zombie-Apokalypse, The Walking Dead, Carol Peletier, Moral, Ethik, Überleben, Postapokalypse, Szenenanalyse, Figurenentwicklung, Medienwirkung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für die Darstellung von Gewalt in Medien, insbesondere im Horrorgenre, interessiert. Sie ist geeignet für die Analyse von Themen wie Moral, Ethik und Überleben in extremen Situationen.
Wo liegt der Fokus der Arbeit?
Der Fokus liegt auf der Analyse der zwischenmenschlichen Gewalt in "The Walking Dead" und der Entwicklung der Figur Carol Peletier als Beispiel für den Umgang mit Gewalt und Moral in einem postapokalyptischen Umfeld. Die Arbeit untersucht nicht die Gewalt durch Zombies im Detail, sondern konzentriert sich auf die Handlungen der Überlebenden untereinander.
- Quote paper
- Bennet Ludwig (Author), 2016, "The Walking Dead". Eine Analyse medialer Gewalt an Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370584