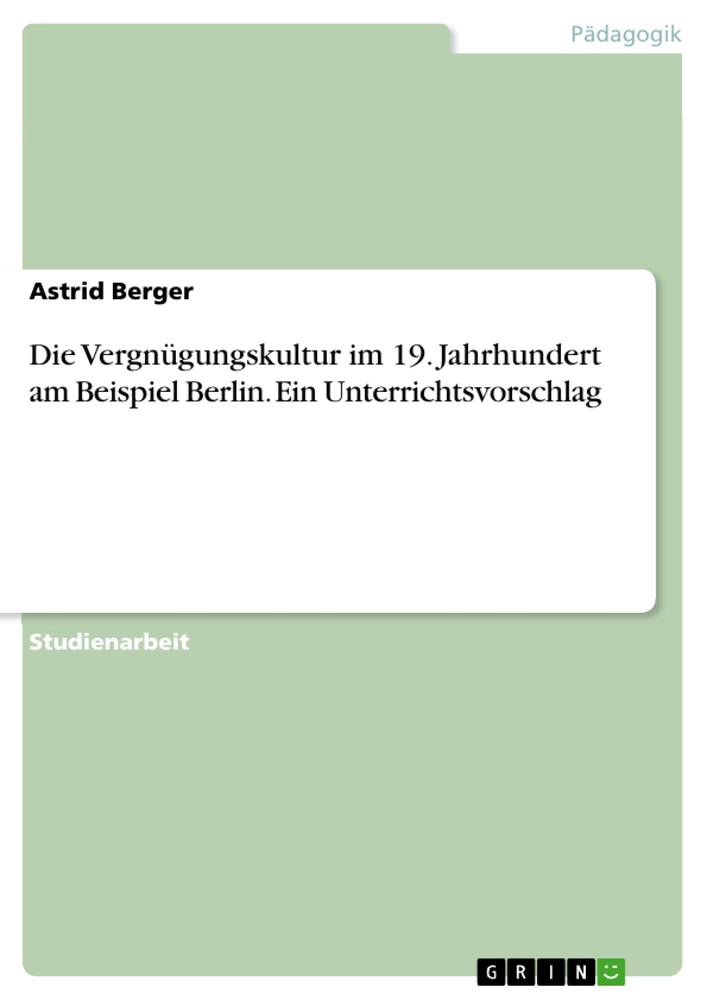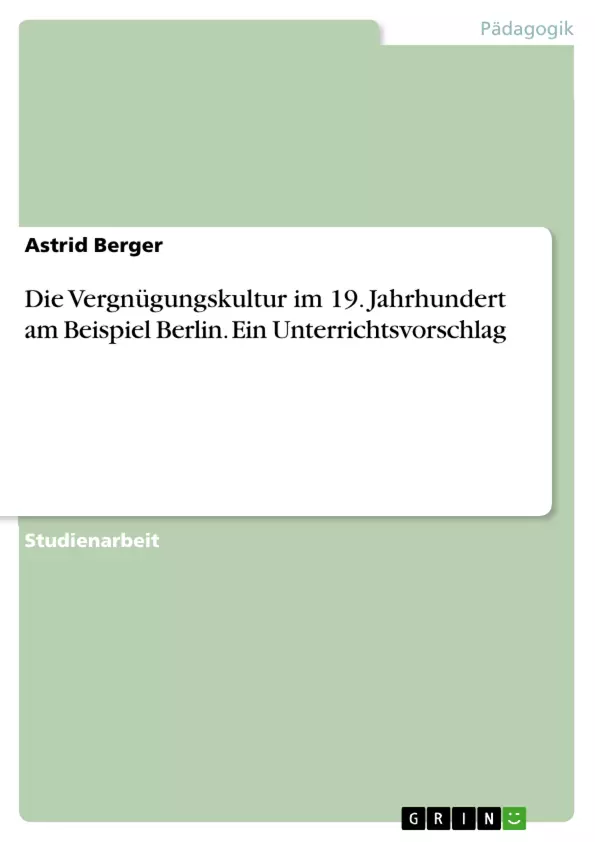Die vorliegende Arbeit stellt eine Kombinationsschrift aus fachwissenschaftlichen Überlegungen und einer Konzeption für den Schulunterricht dar.
In der vorliegenden Niederschrift soll es im ersten Abschnitt darum gehen, darzustellen, dass die Herausbildung einer modernen Vergnügungskultur nicht ohne Urbanisierung möglich war und die Vergnügungskultur ein Teil der Metropolenbildung darstellte. Anschließend soll diese Betrachtung als Vorbereitung einer Unterrichtseinheit der Sekundarstufe I an einer Berliner Schule dienen und grob skizziert werden.
Um dieser These nachzugehen müssen zunächst die Begrifflichkeiten der Metropole und Vergnügungskultur geklärt werden. Aufgrund der Kürze der Arbeit wird darauf hingewiesen, dass nur an ausgewählten Beispielen gearbeitet werden konnte.
Im zweiten Abschnitt erfolgt die Umsetzung der Analyse konzeptionell für den Unterricht an Berliner Schulen der Sekundarstufe I. Hierbei werden didaktische und methodische Überlegungen dargestellt.
Die Grundlagen der Arbeit bilden einschlägige Monographien und Sammelbände aus der Stadtgeographie, aus der Didaktik in den Unterrichtsfächer Geschichte und Geographie und aus derzeitigen Forschungen zu Vergnügungskultur im 19. Jahrhundert sowie die Rahmenlehrpläne des Landes Berlin. Seit 2011 beschäftigen sich eine Vielzahl von Autoren mit der Frage wie, wann und wo Vergnügen im 19. Jahrhundert passierte. Die bisherigen eher stadtgeographischen Untersuchungen wurden in den vergangenen Jahren erweitert. Die Wahrnehmung des Vergnügens sowie die (Aus-) Nutzung, Auslebung und Veränderung im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext rückten in den Vordergrund. Begonnen wurde dieser Aspekt der Geschichtsforschung mit den negativen Auswirkungen von Metropolen wie beispielsweise die Begünstigung der Prostitution. Zunehmend wurden alltägliche Geschehnisse und Räume in der Forschung untersucht. Aus heutiger Sicht, einer medial konstruierten Welt, in der jeder Zugang zu Medien und Vergnügen zu jeder Zeit besitzt, scheint die Frage nach der derzeitigen Forschung zu Vergnügungskultur sinnvoll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Metropole
- Vergnügen
- Vergnügungskultur im 19. Jahrhundert
- Vergnügen im Berlin des 19. Jahrhunderts
- Schlussbetrachtung
- Umsetzung im Unterricht – Didaktische Analyse
- Verortung im Rahmenlehrplan
- Lernziele der Unterrichtseinheit
- Methodisches Vorgehen
- Arbeitsmaterialien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Vergnügungskultur im 19. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der Urbanisierung Berlins. Sie analysiert die Wechselwirkungen zwischen dem Aufstieg der Metropole und der Entstehung einer spezifischen Vergnügungskultur. Neben der fachwissenschaftlichen Betrachtung dient die Arbeit als Grundlage für die Entwicklung einer Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I in Berlin, wobei didaktische und methodische Aspekte im Fokus stehen.
- Die Rolle der Urbanisierung bei der Entstehung der Vergnügungskultur
- Die Vergnügungskultur als Teil der Metropolenbildung
- Die Entwicklung und die Ausprägungen der Vergnügungskultur in Berlin im 19. Jahrhundert
- Die didaktische und methodische Umsetzung des Themas im Unterricht
- Die Relevanz von neuesten Forschungsergebnissen im Schulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Zusammenhang zwischen Urbanisierung und Vergnügungskultur. Sie stellt die Bedeutung von Metropolen im 19. Jahrhundert dar und beleuchtet die Notwendigkeit, neue Forschungsergebnisse im Schulunterricht zu berücksichtigen.
- Das Kapitel über die Metropole analysiert die Entstehung und Entwicklung von Städten im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet die Bedeutung der Industrialisierung und den damit verbundenen Wandel des städtischen Lebens.
- Das Kapitel über Vergnügen untersucht die Definition und die Bedeutung von Vergnügen im 19. Jahrhundert. Es zeigt, wie sich die Wahrnehmung und die Auslebung von Vergnügen im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext verändern.
- Das Kapitel über die Vergnügungskultur im 19. Jahrhundert beleuchtet die Entstehung und die Entwicklung der Vergnügungskultur als Teil der Metropolenbildung. Es zeigt die unterschiedlichen Formen der Vergnügungskultur in dieser Zeit.
- Das Kapitel über das Vergnügen im Berlin des 19. Jahrhunderts analysiert die spezifische Vergnügungskultur der Metropole Berlin im 19. Jahrhundert. Es zeigt, wie sich die Vergnügungskultur in Berlin von anderen Städten unterschied.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Vergnügungskultur im 19. Jahrhundert, insbesondere in Berlin. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Urbanisierung, Metropole, Vergnügungskultur, Industrielle Revolution, Gesellschaftswandel, Alltagsgeschichte, Sekundarstufe I, Didaktik, Methodisches Vorgehen, Rahmenlehrplan.
- Citar trabajo
- Astrid Berger (Autor), 2017, Die Vergnügungskultur im 19. Jahrhundert am Beispiel Berlin. Ein Unterrichtsvorschlag, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370622