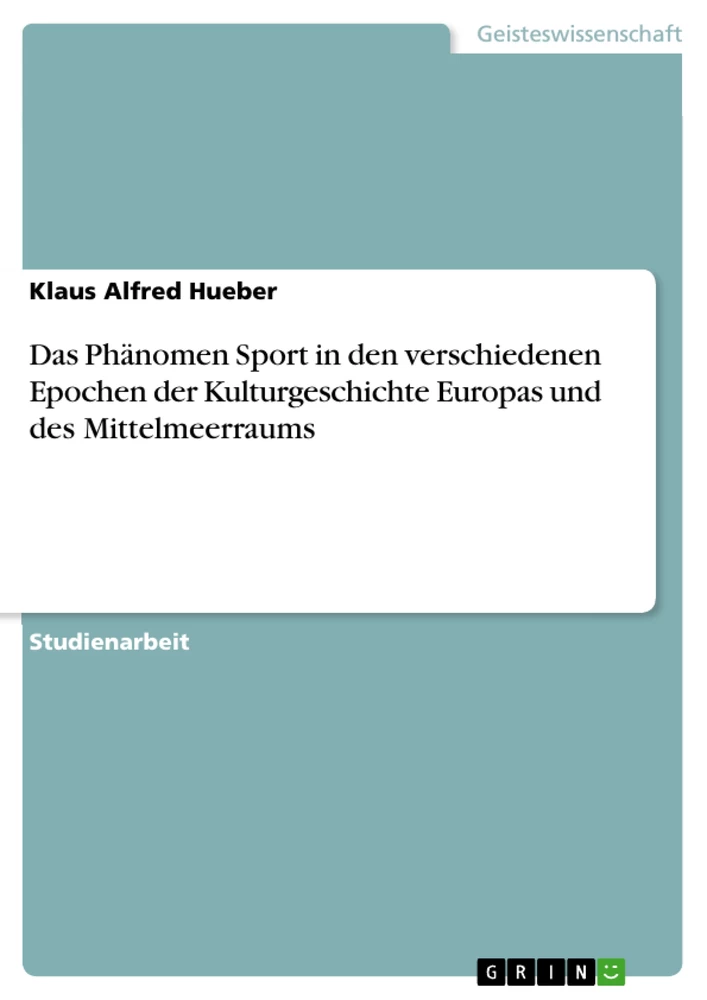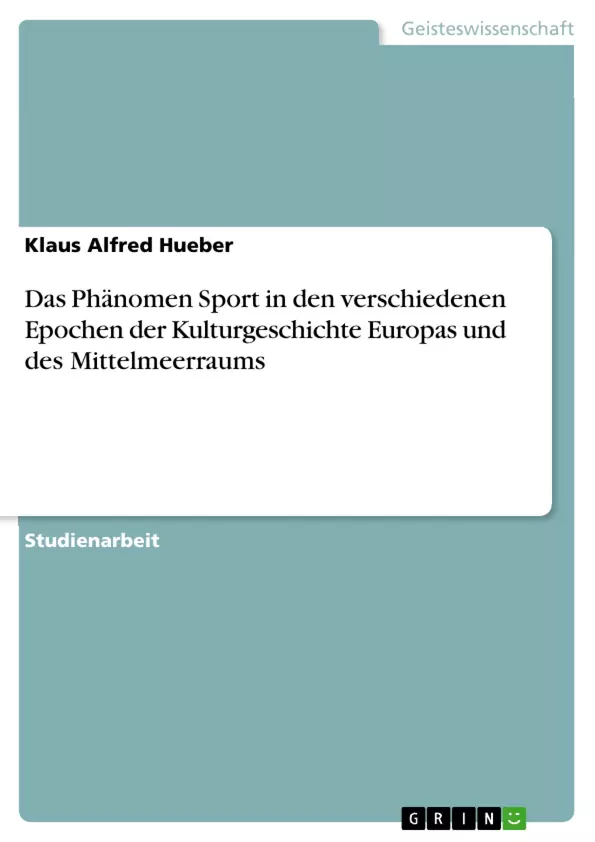Sport ist heutzutage aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Kaschuba (1989) stellt fest, dass laufende, spielende und sich sportlich gebende Menschen zur gewohnten Alltagsszenerie der Straßen und Parks gehören, sodass sich Sport zu einer Normalität unserer westlichen Gesellschaft entwickelt hat. Er nennt dieses Phänomen „Sportivität“.
Wenn man zunächst das Problem der Definition des vielschichtigen und komplexen Begriffs „Sport“ ignoriert, lässt sich die Frage stellen: Seit wann gibt es Sport überhaupt?
Die Fähigkeit zu körperlichen Leistungen ist sicherlich ein entwicklungsgeschichtliches Erbe der Menschheit. Ausdauerndes Laufen, Springen und Werfen zählen zu den Voraussetzungen des Überlebens für die damaligen Jäger und Sammler. Spekulativ bleibt dabei, seit wann es dabei zu Leistungsvergleichen oder auch einem spielerischen Charakter dieser körperlichen Betätigungen – und damit zu etwas, dass man „Sport“ nennen könnte, wenn man will – gekommen ist. Spätestens bei der Erfindung von Werkzeugen und Waffen dürfte diese jedoch geschehen sein. Schließlich braucht es zur erfolgreichen Benutzung von Wurfgeschossen, wie zum Beispiel Pfeil und Bogen, Übung. Dass es hierbei zu (spielerischen) Vergleichen gekommen ist, ist durchaus denkbar (Mandell, 1986).
Bleibt man hingegen in der Gegenwart kann man feststellen, dass bestimmte körperliche Übungen, die man durchaus als Sport bezeichnen würde, wie beispielsweise Laufen, Ringen, Wurfwettbewerbe, Schwimmen und Jagen in den meisten Kulturgemeinschaften der Welt auftreten (Behringer, 2012). Da Sport derart universell vorkommt, lässt dies den Schluss zu, dass sportliche Aspekte, wie körperliche Praxis, Spiel und Leistungsvergleiche, tiefliegende, menschliche Bedürfnisse berühren und insofern schon früh in der Menschheitsgeschichte auftreten.
Diese Arbeit untersucht das Phänomen Sport in den verschiedenen Epochen der Kulturgeschichte Europas und des Mittelmeerraums. Aus oben genannten Gründen, sind die Erkenntnisse allerdings kritisch zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mesopotamien (3500 - 500 v. Chr.)
- Altes Ägypten (3000 – 300 v. Chr.)
- Zweikampf
- Fechtkämpfe
- Freizeit- und Erholungsmöglichkeit
- Kretisch-mykenische Zeit (1600 – 1200 v. Chr.)
- Archaische Epoche (800 - 500 v. Chr.)
- Hellenistische Epoche (300 - 0 v. Chr.)
- Römisches Reich (800 v. Chr. - 500 n. Chr.)
- Mittelalter (6. - 15. Jhdt.)
- Neuzeit (15.-18. Jhdt.)
- Neuere Geschichte bis Gegenwart (ab 19. Jhdt.)
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Entwicklung des Sports von der Antike bis in die Neuere Geschichte. Sie beleuchtet die Bedeutung von Sport in verschiedenen Kulturen und Epochen und untersucht die kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse auf die Ausübung und Wahrnehmung von Sport.
- Die Entwicklung von Sport als kulturelles Phänomen in verschiedenen Epochen
- Die Bedeutung von Sport für die jeweilige Gesellschaft und Kultur
- Die Rolle von Sport in der Alltagskultur und im gesellschaftlichen Leben
- Die Entwicklung von Sportarten und Wettkampfsystemen
- Die Veränderung der Wahrnehmung und Interpretation von Sport im Wandel der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage nach den Anfängen des Sports und beleuchtet die Vielschichtigkeit und Komplexität des Begriffs „Sport“. Sie diskutiert die schwierige Rekonstruktion von Sportpraktiken aus antiken Quellenmaterialien und betont die Notwendigkeit eines kritischen Umgangs mit diesen.
- Mesopotamien (3500 - 500 v. Chr.): Dieses Kapitel geht auf die wenigen Quellen über sportliche Aktivitäten in Mesopotamien ein. Es wird vermutet, dass Sport in Mesopotamien vorrangig für (para-)militärische Zwecke eingesetzt wurde, um die militärische Überlegenheit zu demonstrieren.
- Altes Ägypten (3000 – 300 v. Chr.): Im Alten Ägypten gab es zahlreiche Darstellungen von sportlichen Aktivitäten. Sport spielte eine wichtige Rolle in vielen sozialen Klassen und hatte einen starken Vergnügungsaspekt. Das Kapitel beleuchtet verschiedene Sportarten wie Ringen, Fechten und verschiedene Freizeitaktivitäten. Es werden auch Hinweise auf eine Professionalisierung des Sports in dieser Zeit diskutiert.
- Kretisch-mykenische Zeit (1600 – 1200 v. Chr.): Dieses Kapitel beschreibt die Sportpraktiken der minoischen Kultur auf Kreta. Es werden Sportfeste und Wettbewerbe mit religiösen Hintergründen erwähnt, die als Vorläufer der Panhellenistischen Spiele angesehen werden können.
- Archaische Epoche (800 - 500 v. Chr.): In der archaischen Epoche entwickelten sich die Panhellenistischen Spiele, die aus vier Einzelereignissen bestanden. Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der olympischen Spiele und die Bedeutung von Sport in der griechischen Gesellschaft. Es wird auch auf die Professionalisierung des Sports und den Aufstieg von Sportstars eingegangen.
Schlüsselwörter
Sportgeschichte, Kulturgeschichte, Antike, Mesopotamien, Ägypten, Kreta, Mykene, Griechenland, Olympische Spiele, Panhellenistische Spiele, Professionalisierung, Sportarten, Wettkämpfe, Rituale, Kult.
Häufig gestellte Fragen
Seit wann gibt es das Phänomen „Sport“?
Körperliche Leistungen wie Laufen und Werfen waren überlebenswichtig für Jäger und Sammler. Spielerische Vergleiche und Wettkämpfe lassen sich bereits in frühen Hochkulturen wie Mesopotamien und Ägypten nachweisen.
Welche Rolle spielte Sport im Alten Ägypten?
Sport war in vielen sozialen Klassen verbreitet und diente sowohl dem Vergnügen als auch der körperlichen Ertüchtigung. Bekannt sind Darstellungen von Ringen, Fechten und Schwimmen.
Was sind die Panhellenistischen Spiele?
Dies waren die vier großen Wettkampfereignisse der griechischen Antike, darunter die Olympischen Spiele, die religiöse Rituale mit sportlichen Höchstleistungen verbanden.
Wie unterschied sich der römische Sport vom griechischen?
Während im griechischen Sport das Ideal des athletischen Wettkampfs im Vordergrund stand, war der Sport im Römischen Reich oft stärker auf Massenunterhaltung und Spektakel (z.B. Gladiatorenkämpfe) ausgerichtet.
Was versteht man unter „Sportivität“?
Der Begriff beschreibt die Normalisierung von Sport im modernen Alltag, wo sportliches Aussehen und körperliche Aktivität zum gewohnten Erscheinungsbild der Gesellschaft gehören.
- Arbeit zitieren
- MSc Klaus Alfred Hueber (Autor:in), 2016, Das Phänomen Sport in den verschiedenen Epochen der Kulturgeschichte Europas und des Mittelmeerraums, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370651