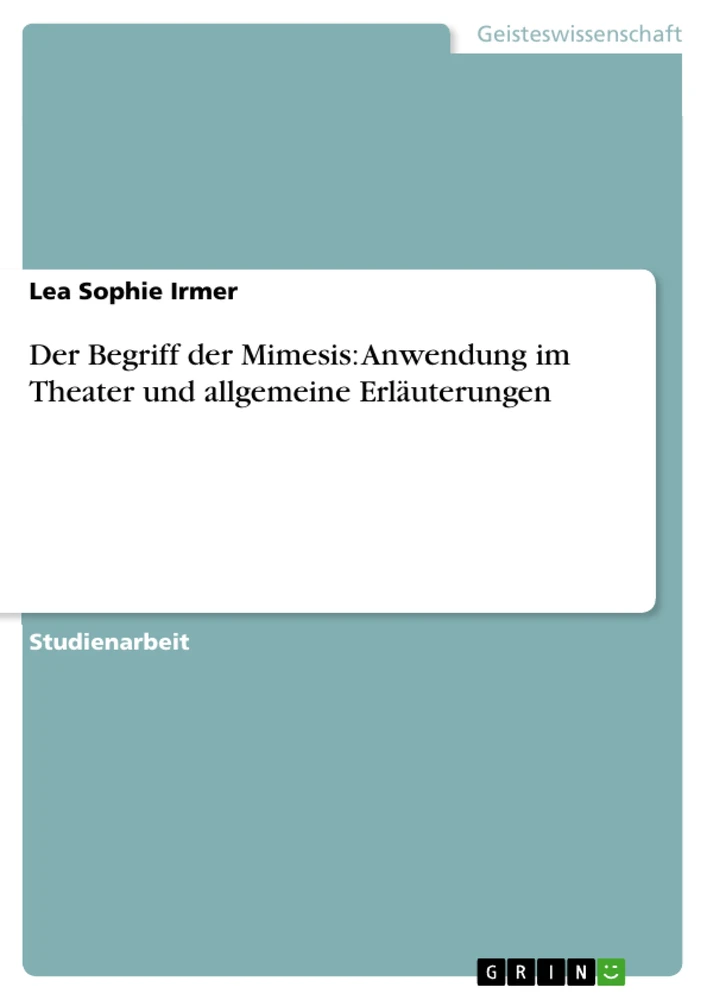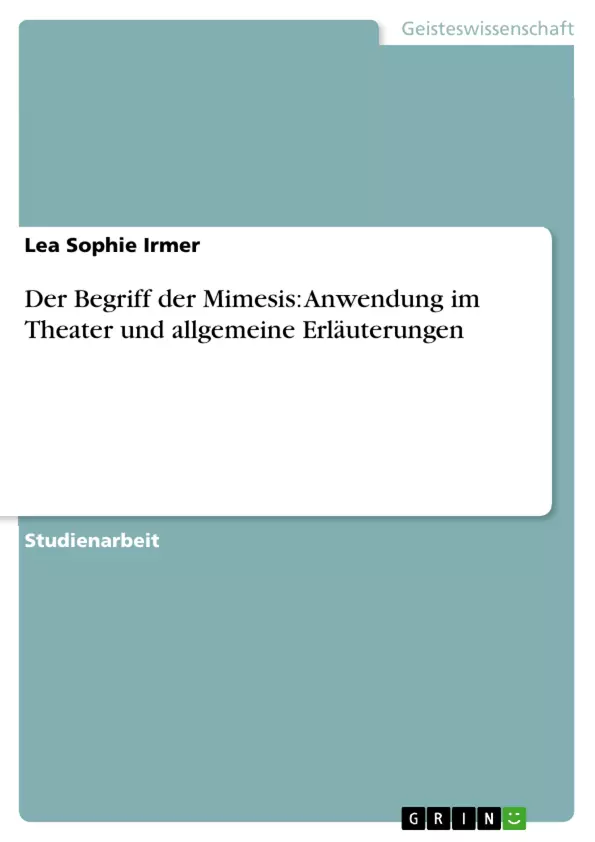In dieser Arbeit soll der Begriff „Mimesis“ von Klaus Mollenhauer im Kontext kultureller Bildung erläutert werden und in einen theaterpädagogischen Kontext gesetzt werden. Begonnen wird mit einer allgemeinen Einführung zum Begriff „Mimesis“. Es folgt die Definition Klaus Mollenhauers, in Kontext seines Verständnisses der ästhetischen Bildung. Abschließend wird entsprechend auf den theaterpädagogischen Kontext eingegangen.
Die mimetischen Prozesse setzen ab dem Säuglingsalter ein und sind zunächst überwiegend auf andere Menschen im direkten Umfeld gerichtet. Bei diesem Prozess versuchen die Kleinkinder den Personen um sich herum zu ähneln. Durch dieses Verhalten und die auf diese folgenden Reaktionen der Umwelt erwirbt das Kind entsprechende Fähigkeiten. Dies führt wiederum zum Erwerb/ Erlernen von Gefühlen, sowohl im eigenen Bewusstsein, als auch durch die Erfahrung, dass die Reaktionen auch Gefühle beim Gegenüber wecken können. Durch diesen Vorgang schreiben sich die kulturellen Bedingungen bereits in das Gedächtnis und den Körper ein.
Die Fähigkeit mimetische Lernprozesse zu nutzen, ist die Basis für den Erwerb kultureller Lernprozesse, da durch dieses mimetische Verhalten kulturelles Wissen angeeignet werden kann. Zentral im mimetischen Lernprozess ist das Vorbild. Im Kleinkindalter bereits spielt die Identifikation mit einer (Vorbild-) Person eine große Rolle. Vorwiegend wird in diesem Alter versucht, den Erwachsenen zu ähneln und sich ebenso zu verhalten wie sie. Ein Beispiel hierfür stellt das freie Rollenspiel von Kindern dar, „Vater- Mutter- Kind“, bei dem von Kleinkindern die Rollen der Eltern eingenommen werden oder auch das „Nachspielen“ von gesehenen Theaterstücken.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Begriff „Mimesis“
- II.1. Der Begriff „Mimesis“ im historischen Kontext
- II.2. Der Begriff „Mimesis“ im kulturpädagogischen Kontext
- II.3. Der Begriff „Mimesis“ im theaterwissenschaftlichen Kontext
- III. Klaus Mollenhauers Begriff „Mimesis“ im Kontext ästhetischer Bildung
- III.1. Ästhetische Bildung, ästhetische Erfahrung und ästhetische Produktivität
- III.2. „Mimesis“
- III.2.1. „Mimesis“ im Allgemeinen
- III.2.2. Bildnerische Mimesis
- IV. „Mimesis“ im theaterpädagogischen Kontext
- IV.1. Heidi Freis Ausdrucksspiel aus dem Erleben- Theaterpädagogische Theorie im Kontext der Mimesis
- IV.2. Theaterpädagogik und der Begriff „Mimesis“
- IV. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der „Mimesis“ im Kontext der theaterpädagogischen Bildung. Ziel ist es, Klaus Mollenhauers Verständnis von „Mimesis“ im Rahmen ästhetischer Bildung zu erläutern und in den theaterpädagogischen Kontext einzubetten. Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Begriff „Mimesis“, bevor sie sich Mollenhauers Definition widmet. Abschließend wird der theaterpädagogische Aspekt beleuchtet.
- Der historische Kontext des Begriffs „Mimesis“
- Der Begriff „Mimesis“ in der pädagogischen Theorie
- Mollenhauers Verständnis von „Mimesis“ und ästhetischer Bildung
- Die Rolle der Mimesis in der Theaterpädagogik
- Mimetische Lernprozesse und kulturelle Aneignung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der mimetischen Prozesse ein, beginnend im Säuglingsalter mit der Nachahmung anderer Menschen. Sie betont die Bedeutung dieser Prozesse für den Erwerb kulturellen Wissens und die Entwicklung von Fähigkeiten wie Lächeln und dem Verstehen von Gefühlen. Das Beispiel des kindlichen Rollenspiels veranschaulicht die Verbindung zwischen mimetischem Lernen und der Aneignung kultureller Muster. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit Klaus Mollenhauers Begriff von „Mimesis“ im Kontext kultureller und theaterpädagogischer Bildung an.
II. Der Begriff „Mimesis“: Dieses Kapitel bietet einen historischen Exkurs zum Begriff „Mimesis“, beginnend mit seiner ursprünglichen Bedeutung im Zusammenhang mit Schauspielern auf Sizilien. Es beschreibt die drei Aspekte des mimetischen Verhaltens im 5. Jahrhundert v. Chr.: die Nachahmung von Mensch und Tier, das Nachahmen menschlicher Handlungen und die Nachbildung von Bildern. Der Einfluss Platons und Aristoteles auf das Verständnis von Mimesis in der Pädagogik wird dargestellt, wobei hervorgehoben wird, dass Mimesis nicht nur zum Erlernen von Einstellungen und Werten, sondern auch von sozialen Handlungs- und Lebensformen beiträgt.
Schlüsselwörter
Mimesis, Theaterpädagogik, Ästhetische Bildung, Klaus Mollenhauer, Mimetisches Lernen, Kulturelle Aneignung, Rollenspiel, Identifikation, Vorbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Begriffs „Mimesis“ im Kontext der Theaterpädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Begriff der „Mimesis“ (Nachahmung) im Kontext der theaterpädagogischen Bildung. Sie untersucht insbesondere Klaus Mollenhauers Verständnis von „Mimesis“ im Rahmen ästhetischer Bildung und dessen Einbettung in die Theaterpädagogik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den historischen Kontext des Begriffs „Mimesis“, dessen Bedeutung in der pädagogischen Theorie, Mollenhauers Verständnis von „Mimesis“ und ästhetischer Bildung, die Rolle der Mimesis in der Theaterpädagogik sowie mimetische Lernprozesse und kulturelle Aneignung. Es wird auch auf den theaterpädagogischen Ansatz von Heidi Frei eingegangen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff „Mimesis“ im historischen und pädagogischen Kontext, ein Kapitel zu Mollenhauers Verständnis von „Mimesis“ in der ästhetischen Bildung, ein Kapitel zur „Mimesis“ im theaterpädagogischen Kontext (inkl. Heidi Freis Ansatz) und abschließend eine Schlussfolgerung. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über den jeweiligen Inhalt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Klaus Mollenhauers Verständnis von „Mimesis“ im Rahmen ästhetischer Bildung zu erläutern und in den theaterpädagogischen Kontext einzubetten. Sie untersucht, wie mimetische Prozesse zum Erwerb kulturellen Wissens und zur Entwicklung von Fähigkeiten beitragen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Mimesis, Theaterpädagogik, Ästhetische Bildung, Klaus Mollenhauer, Mimetisches Lernen, Kulturelle Aneignung, Rollenspiel, Identifikation und Vorbild.
Wie wird der Begriff „Mimesis“ historisch eingeordnet?
Der Begriff „Mimesis“ wird historisch von seinen Ursprüngen im antiken Griechenland (Sizilien) bis zu seiner Relevanz in der modernen Pädagogik verfolgt. Es werden die verschiedenen Interpretationen und Einflüsse von Philosophen wie Platon und Aristoteles betrachtet.
Welche Rolle spielt Heidi Frei in dieser Arbeit?
Heidi Freis Ausdrucksspiel und deren theaterpädagogische Theorie werden im Kontext der Mimesis untersucht und in die Betrachtung des Begriffs integriert.
Wie wird der Bezug zwischen Mimesis und ästhetischer Bildung hergestellt?
Die Arbeit untersucht, wie Mollenhauers Verständnis von Mimesis zu seiner Konzeption von ästhetischer Bildung beiträgt. Der Zusammenhang zwischen mimetischem Lernen, ästhetischer Erfahrung und ästhetischer Produktivität wird beleuchtet.
Welche Bedeutung hat Mimesis für den Erwerb von kulturellem Wissen?
Die Arbeit betont die Bedeutung mimetischer Prozesse für den Erwerb kulturellen Wissens und die Aneignung kultureller Muster. Dies wird u.a. am Beispiel des kindlichen Rollenspiels veranschaulicht.
- Arbeit zitieren
- B.A., M.A. Lea Sophie Irmer (Autor:in), 2015, Der Begriff der Mimesis: Anwendung im Theater und allgemeine Erläuterungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370677