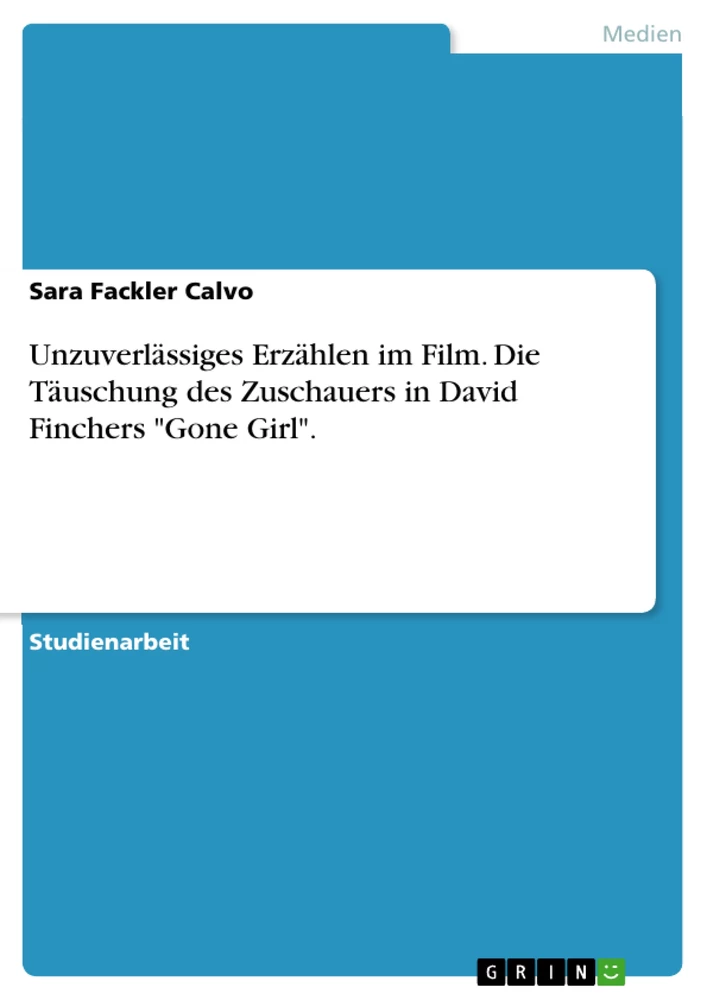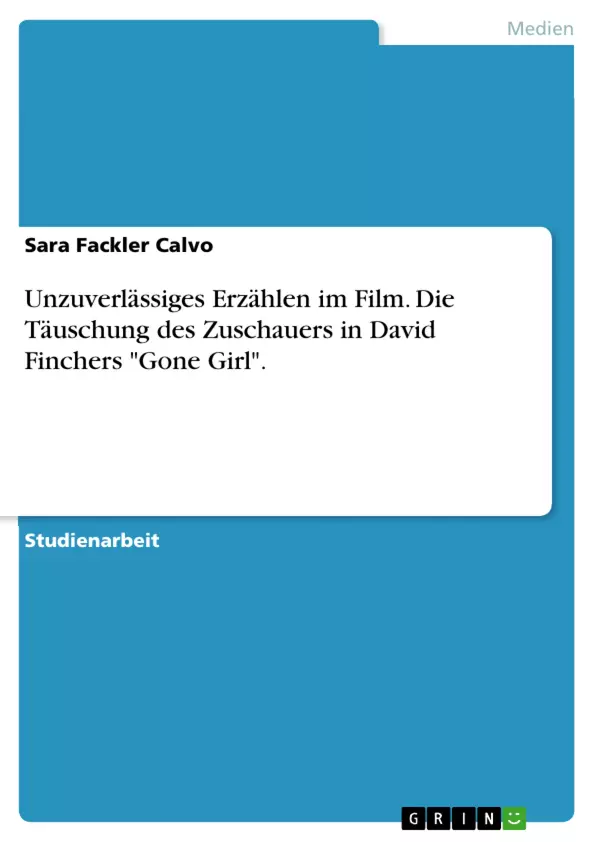Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer Form des Betrugs und zwar mit dem unzuverlässigen Erzählen im Film. Im Fokus steht hierbei der Film Gone Girl von David Fincher aus dem Jahre 2014.
Unzuverlässiges Erzählen ist eine sehr populäre Art und Weise des filmischen Erzählens, welche in immer mehr Filmen vorkommt, weshalb sie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Um einen generellen Einblick darüber zu verschaffen, worum es sich hierbei konkret handelt, soll im Rahmen dieser Arbeit zunächst der Versuch einer Definition des unzuverlässigen Erzählens im Film gegeben werden.
Anschließend werden die filmischen Signale behandelt werden, durch welche ein derartiger Film vom Rezipienten als solcher erkannt werden kann. Schließlich setzt sich diese Arbeit zum Ziel, den Film Gone Girl zu analysieren und herauszufinden, inwiefern dieser unzuverlässig ist. Zu diesem Zweck werden die im Film vorkommenden falsifizierten Analepsen, das unzuverlässige voice-over sowie die Thematik der Opferrolle behandelt und näher betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unzuverlässiges Erzählen im Film
- Eine Definition
- Signale unzuverlässigen Erzählens
- Unzuverlässiges Erzählen in Gone Girl
- Falsifizierte Analepsen
- Unzuverlässiges voice-over
- Die Täterin in der Opferrolle
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem unzuverlässigen Erzählen im Film und untersucht den Film Gone Girl von David Fincher aus dem Jahr 2014 als Beispiel für dieses narrative Phänomen. Der Fokus liegt auf der Analyse der filmischen Techniken, die zum Einsatz kommen, um den Zuschauer in die Irre zu führen und ihn auf eine falsche Fährte zu locken.
- Definition des unzuverlässigen Erzählens im Film
- Analyse der filmischen Signale für unzuverlässiges Erzählen
- Die Rolle von falsifizierten Analepsen im Film
- Die Verwendung eines unzuverlässigen voice-overs
- Die Darstellung der Täterin in der Opferrolle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema des unzuverlässigen Erzählens im Film vor und führt den Fokus auf den Film Gone Girl. Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept des unzuverlässigen Erzählens zu definieren und anhand des Films zu analysieren, welche Techniken eingesetzt werden, um den Zuschauer in die Irre zu führen.
2. Unzuverlässiges Erzählen im Film
2.1 Eine Definition
Dieser Abschnitt erörtert die Definition des unzuverlässigen Erzählens im Film und beleuchtet die Unterschiede zwischen narrativen Techniken in Literatur und Film. Es werden unterschiedliche Formen des unzuverlässigen Erzählens vorgestellt und die Rolle der Kamera und des voice-overs als manipulative Elemente diskutiert.
3. Unzuverlässiges Erzählen in Gone Girl
Dieses Kapitel analysiert den Film Gone Girl hinsichtlich des unzuverlässigen Erzählens. Es werden die spezifischen Techniken untersucht, die im Film eingesetzt werden, um den Zuschauer in die Irre zu führen, wie beispielsweise falsifizierte Analepsen und ein unzuverlässiges voice-over.
Schlüsselwörter
Unzuverlässiges Erzählen, Film, Gone Girl, David Fincher, Analepsen, voice-over, Opferrolle, Fokalisierung, Kamera, Zuschauermanipulation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter unzuverlässigem Erzählen im Film?
Es handelt sich um eine narrative Technik, bei der der Zuschauer durch manipulative filmische Mittel wie falsche Informationen oder einseitige Perspektiven bewusst in die Irre geführt wird.
Wie setzt David Fincher unzuverlässiges Erzählen in „Gone Girl“ ein?
Fincher nutzt Techniken wie falsifizierte Analepsen (Rückblenden, die sich als unwahr herausstellen) und ein unzuverlässiges Voice-over, um die Wahrnehmung des Zuschauers zu manipulieren.
Welche Rolle spielt das Voice-over in „Gone Girl“?
Das Voice-over dient dazu, die subjektive und teilweise erfundene Sichtweise einer Figur als Wahrheit zu präsentieren, was die spätere Enthüllung der Täuschung verstärkt.
Was sind Signale für unzuverlässiges Erzählen?
Signale können Widersprüche zwischen Bild und Ton, auffällige Kameraperspektiven oder die spätere Widerlegung von zuvor gezeigten Ereignissen (Analepsen) sein.
Warum wird die Täterin oft in der Opferrolle dargestellt?
Dies ist ein zentrales Element der Manipulation in „Gone Girl“, um die Sympathien des Zuschauers zu steuern und die tatsächlichen Machtverhältnisse bis zur Wendung zu verschleiern.
- Quote paper
- Sara Fackler Calvo (Author), 2016, Unzuverlässiges Erzählen im Film. Die Täuschung des Zuschauers in David Finchers "Gone Girl"., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370840