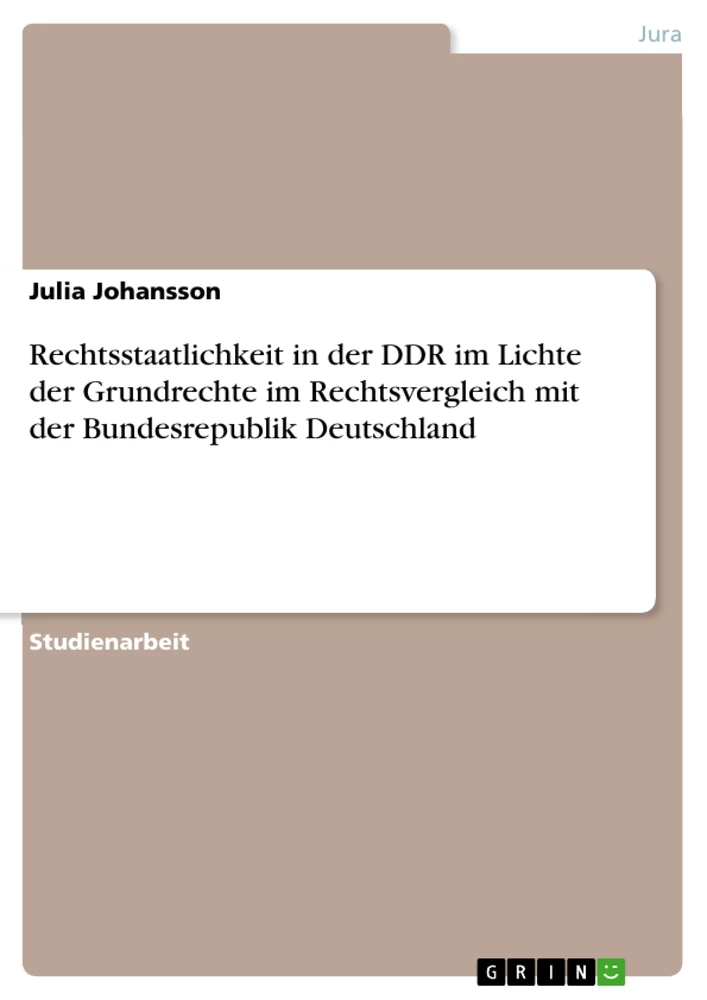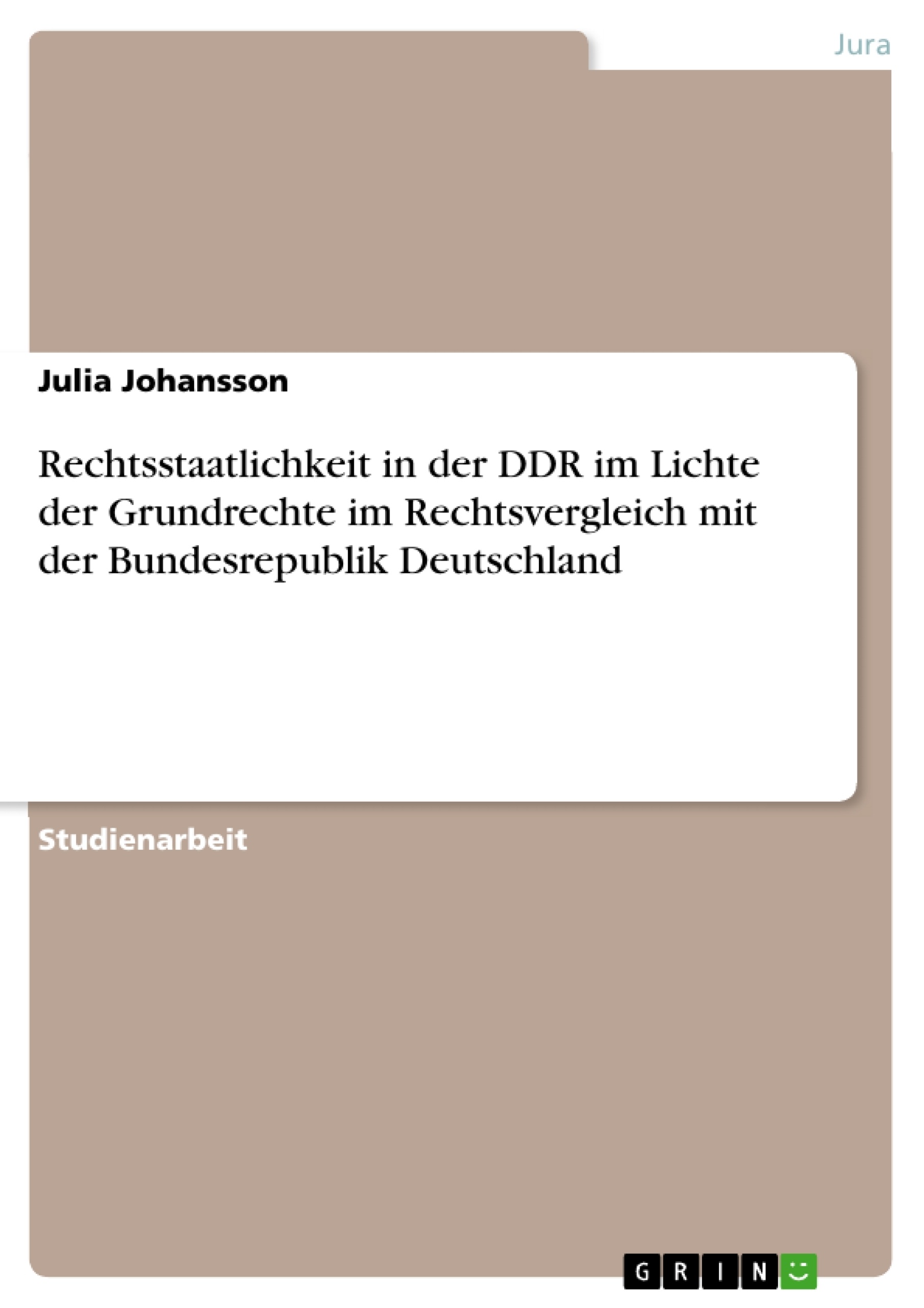War die DDR ein Unrechtsstaat? Selbst ein historisches Thema wie die DDR 25 Jahre nach dem Mauerfall kann höchste Brisanz und Aktualität entfalten. Dass der Umgang mit Grundrechten einen wichtigen Aspekt zur Bewertung von Rechtsstaatlichkeit darstellt, ist heute allgemein anerkannt. Aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit der Bürger wird die Grundrechtsthematik im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen.
Unter Einbeziehung der offiziellen DDR-Staatsrechtslehre soll beleuchtet werden, inwiefern sich die von der DDR unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten angestellte Rechtsvergleichung mit der BRD auf die Grundrechte bezog, welcher Zweck damit verfolgt wurde und welche Auswirkungen dies auf die eigene Grundrechtskonzeption hatte. Anschließend sollen die von der DDR daraus gewonnenen theoretischen Erkenntnisse in Relation zur Rechtswirklichkeit gesetzt werden, um etwaige Abweichungen in der Grundrechtsrealität der DDR aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wird die Arbeit auch Bezüge zum Völkerrecht herstellen, um zu überprüfen, ob eine Kongruenz der DDR-Rechtspraxis mit völkerrechtlichen Normen bestand.
Die Untersuchung wird sich zu Einschränkungszwecken punktuell auf ausgewählte Grundrechte beziehen, welchen eine besondere Bedeutung innerhalb des Rechtssystems der DDR zugemessen wird. Grundlage für die Untersuchung bildet im Folgenden die DDR-Verfassung von 1968/74.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Rechtsvergleichung in der DDR
- I. Sozialistische Rechtsvergleichung
- Terminologie
- II. Gesellschaftlicher und ökonomischer Hintergrund
- 1. Bedingungen für die Verwirklichung der Grundrechte
- 2. Verhinderung der Grundrechtsverwirklichung durch Privateigentum
- 3. Völkerrechtliche Bezüge
- 4. Zwischenfazit
- III. Eigenschaften und Unterschiede sozialistischer und kapitalistischer Grundrechte
- 1. Qualität sozialistischer Grundrechte
- a) Konzeption subjektiver Rechte
- b) Originarität sozialistischer Grundrechte
- c) Zwischenfazit
- 2. Sozialökonomische und kulturelle Rechte
- a) Völkerrechtliche Bezüge
- b) Notwendigkeit sozialökonomischer und kultureller Rechte
- c) Zwischenfazit
- IV. Wandel im Kapitalismus?
- 1. Ansätze eines Umdenkens
- 2. Zwischenfazit
- V. Abbau der Grundrechte im Kapitalismus
- 1. Kein stattfindendes Umdenken
- 2. Sicherung der Machtposition
- a) Berufsverbote
- b) Überwachung Oppositioneller
- 3. Diskriminierung von Frauen und Ausländern
- 4. Mangelnde Bildung
- 5. Realitätsferne Selbstdarstellung
- 6. Zwischenfazit
- VI. Maßnahmen der DDR
- 1. Bedrohung der Demokratie
- 2. Verhinderung des Grundrechtsmissbrauchs
- 3. Völkerrechtliche Bezüge
- 4. Zwischenfazit
- VII. Garantien der Grundrechte
- 1. Definition
- 2. Verschiedene Garantieformen
- a) Politische und ökonomische Garantien
- b) Juristische Garantien
- 3. Rechtsschutz
- 4. Beurteilung des Rechtsschutzes in der BRD
- 5. Zwischenfazit
- VIII. Ausgewählte Grundrechte in der DDR
- 1. Grundrecht auf Arbeit
- a) Nichtexistenz in kapitalistischen Staaten
- b) Konsequenzen der Nichtexistenz
- c) Zwischenfazit
- 2. Grundrecht auf Freizügigkeit
- a) Abgrenzung vom Auswanderungsrecht
- b) Gründe für die Nichtexistenz des Auswanderungsrechts
- c) Zwischenfazit
- 3. Grundrecht auf Freizügigkeit
- 1. Umgang mit ausreisewilligen Bürgern
- 2. Reisepraxis
- 3. Verstöße gegen Völkerrecht
- 4. KSZE-Schlussakte und UN-Konvention
- 4. Grundrecht auf Arbeit
- 1. Umgang mit ausreisewilligen Bürgern
- 2. Zwischenfazit
- 5. Meinungsfreiheit
- 1. Auslegung
- 2. Zwischenfazit
- 6. Garantien der Grundrechte
- 1. Gerichtliche Rechtsbehelfe
- 2. Außergerichtliche Rechtsbehelfe
- a) Eingaberecht
- b) Anrufung der Staatsanwaltschaft
- 3. Zwischenfazit
- C. Realität
- I. Zusammenfassung Sozialistische Rechtsvergleichung
- D. Fazit
- Sozialistische Rechtsvergleichung
- Verwirklichung von Grundrechten in der DDR
- Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Rechtsstaatlichkeit
- Relevanz von Grundrechten für die Rechtsstaatlichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Rechtsvergleichung der Rechtsstaatlichkeit in der DDR im Lichte der Grundrechte mit der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht die Konzeption und Verwirklichung von Grundrechten in beiden deutschen Staaten und beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht die Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht, insbesondere im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit in der DDR. Zunächst wird die sozialistische Rechtsvergleichung und ihr gesellschaftlicher sowie ökonomischer Hintergrund beleuchtet. Die Eigenschaften und Unterschiede sozialistischer und kapitalistischer Grundrechte werden analysiert, wobei die Konzeption subjektiver Rechte, die Originarität sozialistischer Grundrechte sowie sozialökonomische und kulturelle Rechte im Fokus stehen. Im weiteren Verlauf werden der Wandel im Kapitalismus und der Abbau von Grundrechten im Kapitalismus untersucht, wobei die Sicherung der Machtposition, Diskriminierung von Frauen und Ausländern, Mangelnde Bildung und Realitätsferne Selbstdarstellung als wichtige Punkte hervorgehoben werden.
Danach werden die Maßnahmen der DDR zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit und die Garantien der Grundrechte betrachtet. Dazu gehören die Bedrohung der Demokratie, die Verhinderung des Grundrechtsmissbrauchs, verschiedene Garantieformen wie politische und ökonomische Garantien sowie juristische Garantien. Der Rechtsschutz in der DDR wird analysiert, wobei die Beurteilung des Rechtsschutzes in der BRD eine wichtige Rolle spielt. Es werden ausgewählte Grundrechte in der DDR wie das Grundrecht auf Arbeit und das Grundrecht auf Freizügigkeit betrachtet, wobei die Nichtexistenz in kapitalistischen Staaten und die Konsequenzen der Nichtexistenz im Fokus stehen.
Schließlich werden die Aspekte der Realität in Bezug auf die Grundrechte in der DDR betrachtet, wobei der Umgang mit ausreisewilligen Bürgern, die Reisepraxis, Verstöße gegen Völkerrecht und die KSZE-Schlussakte und UN-Konventionen eine Rolle spielen. Die Meinungsfreiheit und die Garantien der Grundrechte in der DDR werden ebenfalls untersucht, wobei der Schwerpunkt auf gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsbehelfen liegt.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Themen der Rechtsvergleichung, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, DDR, Bundesrepublik Deutschland, sozialistische Rechtsvergleichung, subjektive Rechte, sozialökonomische und kulturelle Rechte, Kapitalismus, Machtposition, Diskriminierung, Garantien der Grundrechte, Rechtsschutz, Grundrecht auf Arbeit, Grundrecht auf Freizügigkeit, Meinungsfreiheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich das Grundrechtsverständnis der DDR von dem der BRD?
Die DDR betonte sozialökonomische Rechte (z. B. Recht auf Arbeit) und sah Privateigentum als Hindernis für die wahre Grundrechtsverwirklichung, während die BRD klassische liberale Freiheitsrechte fokussierte.
War das "Recht auf Arbeit" in der DDR ein echtes Grundrecht?
In der DDR-Verfassung war es zentral verankert. Die Arbeit untersucht jedoch, inwiefern dieses Recht auch mit einer Arbeitspflicht und politischer Wohlverhaltenskontrolle verknüpft war.
Wie ging die DDR mit dem Grundrecht auf Freizügigkeit um?
Die Freizügigkeit war stark eingeschränkt. Ein Recht auf Auswanderung existierte de facto nicht, und Verstöße gegen völkerrechtliche Normen (wie die KSZE-Schlussakte) waren gängige Praxis.
Welche Rolle spielten die "Eingaben" in der DDR?
Das Eingaberecht war ein außergerichtlicher Rechtsbehelf, mit dem Bürger Beschwerden an staatliche Stellen richten konnten. Es diente oft als Ventil für Unzufriedenheit in einem System ohne unabhängige Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Was verstand die DDR unter "sozialistischer Rechtsvergleichung"?
Es war eine Methode der Staatsrechtslehre, um die vermeintliche Überlegenheit des sozialistischen Rechtssystems gegenüber dem "bürgerlich-kapitalistischen" System der BRD wissenschaftlich zu begründen.
- Quote paper
- Julia Johansson (Author), 2014, Rechtsstaatlichkeit in der DDR im Lichte der Grundrechte im Rechtsvergleich mit der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370868