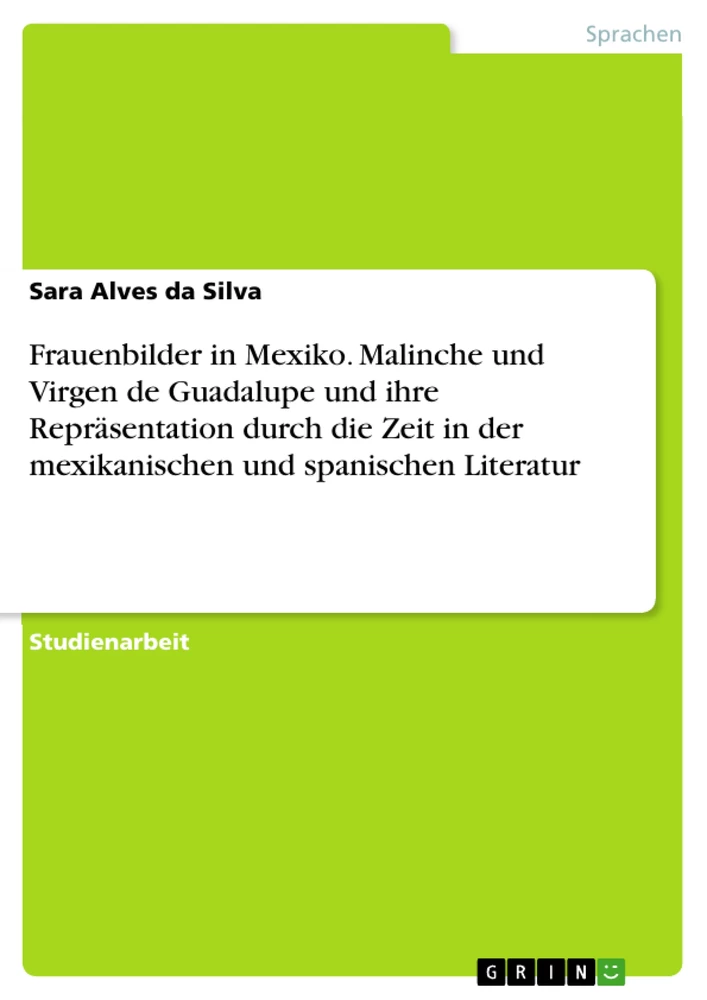In der Staatsgründung und Identitätsdiskussion Mexikos spielen die Mythenfiguren der Virgen de Guadalupe und der Malinche seit jeher eine wichtige symbolische Rolle und beeinflussen als gegensätzliche Typen von Weiblichkeit das Frauenbild in der Literatur und Gesellschaft, welches von einem Dualismus von gut/böse, rein/beschmutzt, Tugend/Sünde geprägt ist.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, mithilfe von drei Textbeispielen darzulegen, wie Malinche und die Virgen de Guadalupe in zeitgenössischen Quellen, beziehungsweise in modernerer Literatur dargestellt werden, und ihren Beitrag zur Entwicklung des Frauenbildes in Mexiko aufzuzeigen. Dafür erfolgt zunächst eine Vorstellung beider Figuren sowie ein Abriss zur Entwicklung ihrer Literatur- und Forschungsstände vom 16. bis 20. Jahrhundert. Daraufhin werden drei Beispiele im Hinblick auf die Zielsetzung analysiert.
Als kontemporäre Quelle zur Beschreibung Malinches dient dafür die „Historia verdadera de la conquista de la Nueva España“ des Chronisten Bernal Díaz del Castillo aus dem Jahre 1568. Um näher auf das Bild der Virgen de Guadalupe einzugehen, soll auf die indianische Erzählung „Nican Mopohua“ Bezug genommen werden, welche zwischen 1545 und 1550 von Antonio Valeriano verfasst wurde. Aus der aktuelleren Literatur wurde der 1989 veröffentlichte Roman „La casa en Mango Street“ der Chicana-Autorin Sandra Cisneros ausgewählt, um einige der darin auftretenden Frauen(bilder) aus einer anderen zeitlichen Perspektive genauer zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Malinche
- a. zur Figur der Malinche
- b. Literatur und Forschung zur Figur der Malinche in der Zeit vom 16. bis 20. Jahrhundert
- 3. Virgen de Guadalupe
- a. zur Figur der Virgen de Guadalupe
- b. Literatur und Forschung zur Figur der Virgen de Guadalupe in der Zeit vom 16. bis 20. Jahrhundert
- 4. Analyse der jeweiligen Darstellung in
- a. „Historia verdadera de la conquista de la Nueva España“ von Bernal Díaz del Castillo (1568)
- b. „Nican Mopohua“ (1545-1550) (übersetzt von Lasso de la Vega 1649)
- c. „La casa en Mango Street“ von Sandra Cisneros (1989)
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Malinche und der Virgen de Guadalupe in der mexikanischen Literatur und ihre Bedeutung für das Frauenbild in Mexiko. Ziel ist es, anhand von drei Textbeispielen aufzuzeigen, wie diese Figuren in verschiedenen Epochen repräsentiert wurden und wie sie zur Entwicklung des Frauenbildes beigetragen haben.
- Die historische Figur der Malinche und ihre vielschichtige Interpretation in der Literatur.
- Die Virgen de Guadalupe als religiöses Symbol und ihre Rolle im mexikanischen Nationalbewusstsein.
- Der Dualismus von "gut/böse", "rein/beschmutzt" im mexikanischen Frauenbild.
- Die Entwicklung des Frauenbildes in Mexiko vom 16. bis zum 20. Jahrhundert.
- Der Vergleich der Darstellung der beiden Figuren in verschiedenen literarischen Werken.
Zusammenfassung der Kapitel
2. Malinche: Dieses Kapitel bietet zunächst eine Einführung in die historische Figur der Malinche, wobei die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion einer vollständigen Biografie aufgrund widersprüchlicher Quellen hervorgehoben werden. Es werden gesicherte Daten zu ihrem Leben präsentiert, wie ihre Übergabe an Cortés, ihre Taufe und ihre Rolle als Dolmetscherin. Der Abschnitt beleuchtet die Debatte um ihre Interpretation als Verräterin oder Überlebende und die Herausforderungen, die sich aus ihrer Vermittlung zwischen zwei Kulturen ergeben. Der zweite Teil des Kapitels widmet sich der Literatur- und Forschungsgeschichte zur Figur der Malinche vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, wobei die sich verändernde Darstellung und Bewertung ihrer Person im Laufe der Zeit im Kontext historischer und politischer Entwicklungen analysiert wird. Die unterschiedlichen Perspektiven auf die Malinche spiegeln die komplexen Machtverhältnisse und die sich wandelnde nationale Identität Mexikos wider.
3. Virgen de Guadalupe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Figur der Virgen de Guadalupe, einem zentralen religiösen Symbol Mexikos. Es wird eine Einführung in die historische und religiöse Bedeutung der Figur gegeben, die im Kontext der spanischen Kolonisierung und der indigenen Kultur zu verstehen ist. Im zweiten Teil des Kapitels wird die Entwicklung der Literatur und Forschung zur Virgen de Guadalupe im Zeitraum vom 16. bis zum 20. Jahrhundert untersucht. Die Analyse zeigt auf, wie die Darstellung der Virgen de Guadalupe im Laufe der Zeit von religiösen, politischen und gesellschaftlichen Faktoren beeinflusst wurde und wie sie im Laufe der Geschichte unterschiedlich interpretiert und instrumentalisiert wurde, um nationale Identität und religiöse Zugehörigkeit zu festigen.
Schlüsselwörter
Malinche, Virgen de Guadalupe, Frauenbild, Mexiko, Kolonialgeschichte, nationale Identität, Literaturanalyse, Chicana-Literatur, Bernal Díaz del Castillo, Nican Mopohua, Sandra Cisneros, Dualismus, Übersetzerin, religiöses Symbol.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Darstellung der Malinche und der Virgen de Guadalupe in der mexikanischen Literatur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Darstellung der Malinche und der Virgen de Guadalupe in der mexikanischen Literatur und deren Bedeutung für das Frauenbild in Mexiko. Sie analysiert, wie diese Figuren in verschiedenen Epochen repräsentiert wurden und wie sie zur Entwicklung des Frauenbildes beigetragen haben.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei Textbeispiele: „Historia verdadera de la conquista de la Nueva España“ von Bernal Díaz del Castillo (1568), „Nican Mopohua“ (1545-1550) (übersetzt von Lasso de la Vega 1649) und „La casa en Mango Street“ von Sandra Cisneros (1989). Diese Texte ermöglichen einen Vergleich der Darstellung der beiden Figuren über verschiedene Jahrhunderte hinweg.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, anhand der ausgewählten Texte aufzuzeigen, wie die Malinche und die Virgen de Guadalupe in verschiedenen Epochen repräsentiert wurden und wie diese Repräsentationen das Frauenbild in Mexiko beeinflusst haben. Es geht um die Analyse der vielschichtigen Interpretationen beider Figuren und deren Rolle im Kontext der mexikanischen Geschichte und Identität.
Wie wird die Figur der Malinche dargestellt?
Das Kapitel über Malinche beleuchtet zunächst ihre historische Figur und die Schwierigkeiten, eine vollständige Biografie aufgrund widersprüchlicher Quellen zu erstellen. Es werden gesicherte Daten zu ihrem Leben präsentiert, ihre Rolle als Dolmetscherin und die Debatte um ihre Interpretation als Verräterin oder Überlebende diskutiert. Die Arbeit analysiert auch die sich im Laufe der Zeit verändernde Darstellung und Bewertung der Malinche in der Literatur und Forschung vom 16. bis zum 20. Jahrhundert.
Wie wird die Figur der Virgen de Guadalupe dargestellt?
Das Kapitel zur Virgen de Guadalupe behandelt die Figur als zentrales religiöses Symbol Mexikos und untersucht ihre historische und religiöse Bedeutung im Kontext der spanischen Kolonisierung und der indigenen Kultur. Die Entwicklung der Literatur und Forschung zur Virgen de Guadalupe vom 16. bis zum 20. Jahrhundert wird analysiert, wobei die Einflüsse religiöser, politischer und gesellschaftlicher Faktoren auf die Darstellung der Figur im Laufe der Zeit hervorgehoben werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Figur der Malinche und ihre vielschichtige Interpretation; die Virgen de Guadalupe als religiöses Symbol und ihre Rolle im mexikanischen Nationalbewusstsein; den Dualismus von "gut/böse", "rein/beschmutzt" im mexikanischen Frauenbild; die Entwicklung des Frauenbildes in Mexiko vom 16. bis zum 20. Jahrhundert und den Vergleich der Darstellung beider Figuren in verschiedenen literarischen Werken.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Malinche, Virgen de Guadalupe, Frauenbild, Mexiko, Kolonialgeschichte, nationale Identität, Literaturanalyse, Chicana-Literatur, Bernal Díaz del Castillo, Nican Mopohua, Sandra Cisneros, Dualismus, Übersetzerin, religiöses Symbol.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Malinche (inkl. Literatur- und Forschungsgeschichte), Virgen de Guadalupe (inkl. Literatur- und Forschungsgeschichte), Analyse der jeweiligen Darstellung in den drei ausgewählten Texten und Fazit.
- Quote paper
- Sara Alves da Silva (Author), 2017, Frauenbilder in Mexiko. Malinche und Virgen de Guadalupe und ihre Repräsentation durch die Zeit in der mexikanischen und spanischen Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370904