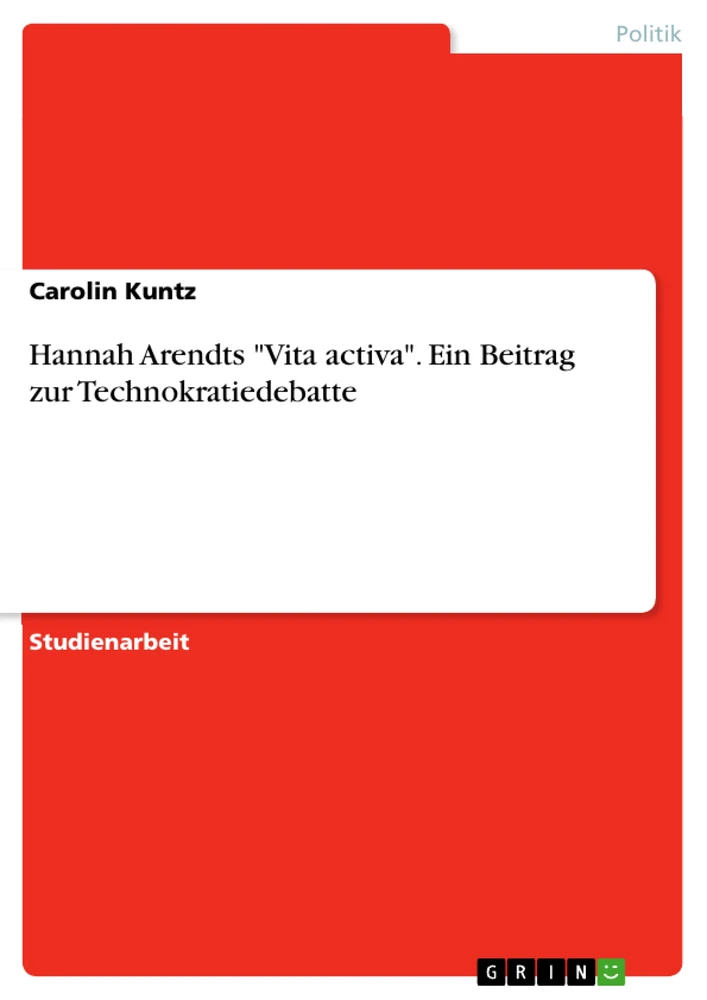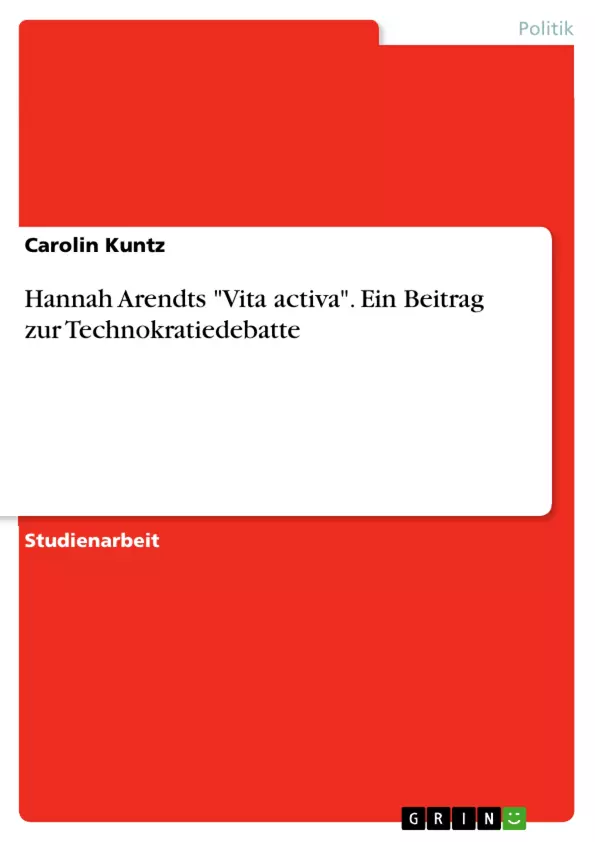Hannah Arendts Totalitarismusanalyse von 1955 setzt sich überwiegend mit dem Nationalsozialismus auseinander, weshalb sie in ihrem zweiten Werk die Vorgeschichte des kommunistischen Totalitarismus näher erforschen möchte. Im Antrag für ein Guggenheim-Stipendium Anfang der 50er Jahre lautet Arendts Arbeitshypothese, dass durch Marx eine Aufwertung des Arbeitsbegriffs statt gefunden habe, in dessen Folge das öffentliche und politische Handeln zu einem Herstellungsprozess umgedeutet wurde.
Im Folgenden wird die Annahme getroffen, dass Arendt zwar den Fokus ihrer Studie stark erweiterte, ihre Arbeitshypothese dennoch beibehält die, wenn man sie fragend formuliert, lautet: Was bedeutet es, wenn öffentliches und politisches Handeln als Arbeit und nicht als (kollektives) Handeln verstanden wird? Oder spezieller: Was bedeutet es, wenn Politik als optimierter Herstellungsprozess verstanden und gelebt wird?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Technokratiedebatte in den USA
- Entstehung des technocratic movements: Veblen und Scott
- Das technokratische Programm
- Vorläufer
- Prämissen
- Thesen
- Beiträge der Kritischen Theorie: Marcuse, Horkheimer und Adorno
- Der Beitrag der Vita activa
- Direkte Textbezüge
- Kontextuelle Bezüge zu den fünf technokratischen Thesen
- Arendts Handlungstheorie und der Technokratiegedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hannah Arendts "Vita activa" als Beitrag zur Technokratiedebatte. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Arendts Theorie des politischen Handelns mit den Ideen der Technokratie, insbesondere der US-amerikanischen Technokratiebewegung, in Beziehung steht. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung des "technocratic movements" im Kontext der Industrialisierung und Automatisierung, insbesondere durch die Werke von Thorstein Veblen, und analysiert die direkten und indirekten Bezugspunkte von "Vita activa" auf die technokratischen Ideen. Darüber hinaus werden die Argumente und Thesen Arendts mit der Handlungstheorie verknüpft, die sie in "Vita activa" entwickelt.
- Die Entstehung und Entwicklung der Technokratiedebatte in den USA
- Die zentralen Ideen und Thesen des "technocratic movements"
- Die Verbindung zwischen Arendts "Vita activa" und der Technokratiedebatte
- Arendts Handlungstheorie im Kontext der Technokratiedebatte
- Der Stellenwert der politischen Handlungsfähigkeit in der Technokratiedebatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz von Hannah Arendts "Vita activa" im Kontext der Technokratiedebatte. Es wird dargelegt, wie Arendts Werk mit der Annahme arbeitet, dass Politik als optimierter Herstellungsprozess verstanden und gelebt wird, und welche Auswirkungen dies auf das politische Handeln hat.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Technokratiedebatte in den USA. Es beleuchtet die Entstehung des "technocratic movements" durch die Werke von Thorstein Veblen und die zentralen Ideen und Thesen dieser Bewegung. Die Kritik der Kritischen Theorie an der Technokratie wird ebenfalls behandelt.
Das zweite Kapitel analysiert die direkten und indirekten Bezugspunkte von "Vita activa" auf die technokratischen Ideen. Es werden die Argumente Arendts im Kontext der Technokratiedebatte untersucht und die Bedeutung ihrer Handlungstheorie für die politische Handlungsfähigkeit in einer technokratischen Gesellschaft betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Technokratie, politische Handlungsfähigkeit, "Vita activa", Hannah Arendt, US-amerikanische Technokratiebewegung, "technocratic movements", Thorstein Veblen, Kritische Theorie, Handlungstheorie, Politik und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zu Hannah Arendts "Vita activa" und Technokratie
Was kritisiert Hannah Arendt an der Aufwertung des Arbeitsbegriffs?
Arendt sieht die Gefahr, dass durch die Fokussierung auf "Arbeit" (als bloßer Lebensunterhalt) das politische "Handeln" verdrängt wird. Politik wird dann fälschlicherweise als ein technischer Herstellungsprozess missverstanden.
Was ist das "technocratic movement" in den USA?
Es handelt sich um eine Bewegung (beeinflusst durch Veblen und Scott), die forderte, die Gesellschaft nach wissenschaftlich-technischen Effizienzkriterien statt nach politischen Ideologien zu steuern.
Wie unterscheidet Arendt zwischen Arbeiten, Herstellen und Handeln?
Arbeiten dient der biologischen Erhaltung, Herstellen schafft eine künstliche Welt von Dingen, und Handeln ist die freie Interaktion zwischen Menschen im öffentlichen Raum, die Identität und Geschichte stiftet.
Warum ist Technokratie für die Demokratie problematisch?
In einer Technokratie werden politische Fragen zu Sachzwängen erklärt. Dadurch schwindet der Raum für öffentlichen Diskurs und kollektives Handeln, da Expertenentscheidungen die demokratische Debatte ersetzen.
Welchen Bezug hat die Kritische Theorie zu Arendts Thesen?
Denker wie Adorno und Marcuse kritisierten ebenfalls die technologische Rationalität. Arendt teilt die Sorge, dass die moderne Gesellschaft den Menschen zum bloßen Funktionär in einem optimierten Prozess degradiert.
- Quote paper
- Carolin Kuntz (Author), 2017, Hannah Arendts "Vita activa". Ein Beitrag zur Technokratiedebatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370919