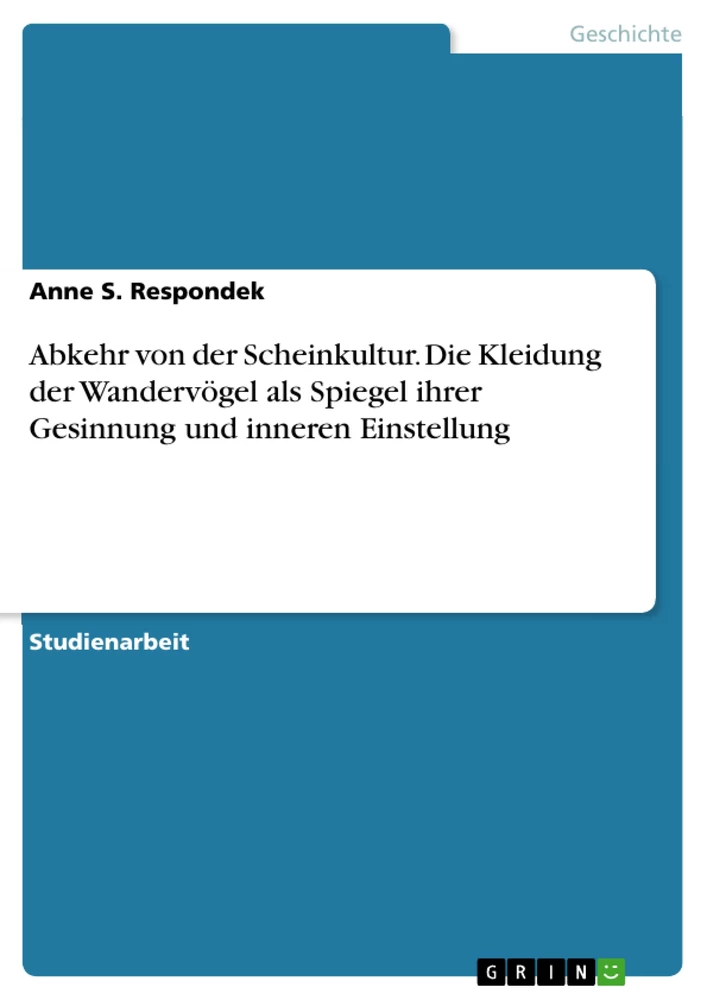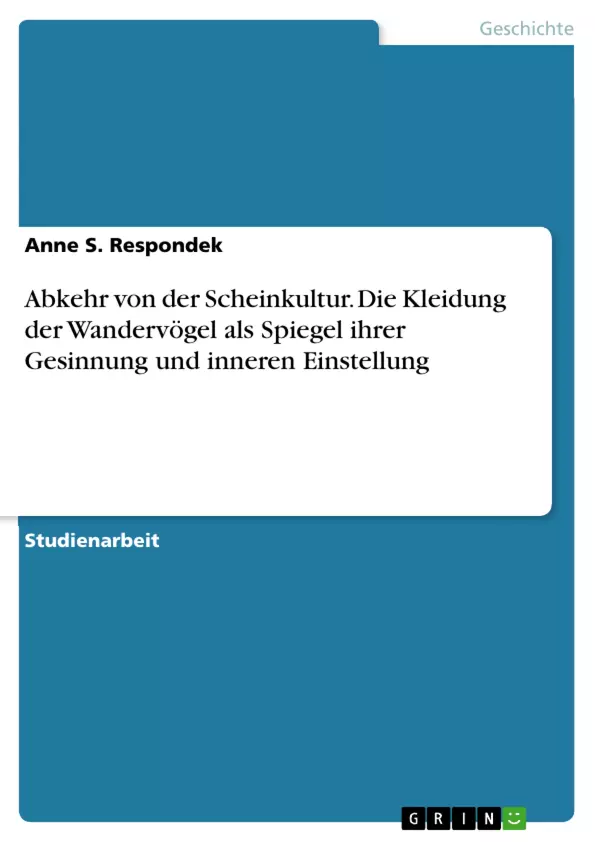Zum Verhältnis von Kleidungsverhalten und Gesellschaft existieren mehrere Theorien verschiedenster Fachrichtungen, unter anderem der Anthropologie, der Kunst-, der Sozial- und Kulturgeschichte, der Volkskunde und andere, die hier aus Platzgründen nicht alle aufgeführt werden können. Einig sind sie sich einzig darin, dass Kleidung als Zeichen sozialen Verhaltens betrachtet werden kann und sollte. Ausgegangen werden soll hier davon, dass Kleidung also ein kulturelles Zeichen ist, welches auf bestimmte regionale, soziale, kulturelle, berufsständige, geschlechtliche und altersbedingte Unterschiede zwischen Gruppen hinweist.
Hingewiesen werden soll kurz auf den Unterschied zwischen Kleidung und Mode, der längst nicht in allen Theorien begriffen wird, vor allem nicht in denen, die das Phänomen aus kulturanthropologischer Sicht betrachten. Aber „Mode ist nicht gleich Kleidung. Sie ist vielmehr ein Kommentar in Kleidern über Kleidung.“ Da die Wandervögel als Individuen, die sich trotz gruppendynamischer Prozesse meistenteils dennoch relativ frei entscheiden konnten, was sie (zumindest in ihrer Freizeit, ergo der Zeit, die sie dem Wandervogelideal am nächsten kommen durften) trugen – bzw., wenn sie die Kleidung nicht selber herstellten, entsprechende Bitten an ihre Eltern richteten – selber auch in mannigfaltigen Diskursen über ihr Kleidungsverhalten reflektierten und diskutierten, ist davon auszugehen, dass die Sachen, die sie bekleideten, für sie mehr als nur zweckdienliche eindimensionale Gegenstände waren und dass sie über diese Objekte, die sie mit Sinn aufluden, Zeichen setzen wollten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort, Fragestellung und Methode
- Was ist der Wandervogel?
- Das kleidungstechnische Umfeld des Wandervogels
- Die abgelehnte bürgerliche Kleidung
- Impulse aus der Reformkleidung
- Wandervogelkleidung
- Die Bekleidung der Wandervögel in der Anfangszeit
- Die versuchte Einführung der Kluft
- Mädchenbekleidung im Wandervogel
- Festkleidung
- Schlusswort und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Kleidung der Wandervögel als Ausdruck ihrer Gesinnung und inneren Einstellung. Ziel ist es, die Wunschbilder und Werte aufzuzeigen, die in der Kleidung der Wandervögel, die sich im Laufe der Jahre stark verändert hat, zum Ausdruck kamen. Die Arbeit analysiert auch die Rolle der Kleidung bei der Ein- und Ausgrenzung von Mitgliedern der Gruppe.
- Die Wandervogelkleidung als Ausdruck von Protest und Selbstbestimmung
- Die Abgrenzung von der bürgerlichen Kleidung und die Suche nach einer eigenen Identität
- Die Bedeutung von Symbolen und Ritualen in der Kleidung der Wandervögel
- Der Einfluss von Mode und Jugendkultur auf die Entwicklung der Wandervogelkleidung
- Die Ambivalenz von Mode als Mittel zur Selbstverwirklichung und Unterwerfung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Kleidung als Ausdruck von sozialem Verhalten. Es werden die Wandervögel als Jugendkultur vorgestellt, die durch ihre Kleidung eine eigene Subkultur schufen. Kapitel zwei beleuchtet den Wandervogel als Jugendbewegung im Kontext der wilhelminischen Gesellschaft. Hier werden die gesellschaftlichen Gegebenheiten der Zeit und die Rolle der Wandervögel als Protestgruppe gegen die bürgerliche Gesellschaft beschrieben. Kapitel drei widmet sich dem kleidungstechnischen Umfeld des Wandervogels. Es wird die abgelehnte bürgerliche Kleidung und die Impulse aus der Reformkleidung erläutert. Kapitel vier behandelt die Wandervogelkleidung selbst, beginnend mit der Bekleidung der frühen Wandervögel. Es wird die Einführung der Kluft und die Mädchenbekleidung sowie die Festkleidung der Wandervögel analysiert.
Schlüsselwörter
Wandervogel, Jugendkultur, Kleidung, Mode, Symbol, Selbstbestimmung, Protest, Subkultur, bürgerliche Gesellschaft, Reformkleidung, Kluft, Identität, Gesinnung, innere Einstellung, Geschlecht, Tradition, Ritual.
- Arbeit zitieren
- Anne S. Respondek (Autor:in), 2012, Abkehr von der Scheinkultur. Die Kleidung der Wandervögel als Spiegel ihrer Gesinnung und inneren Einstellung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370944