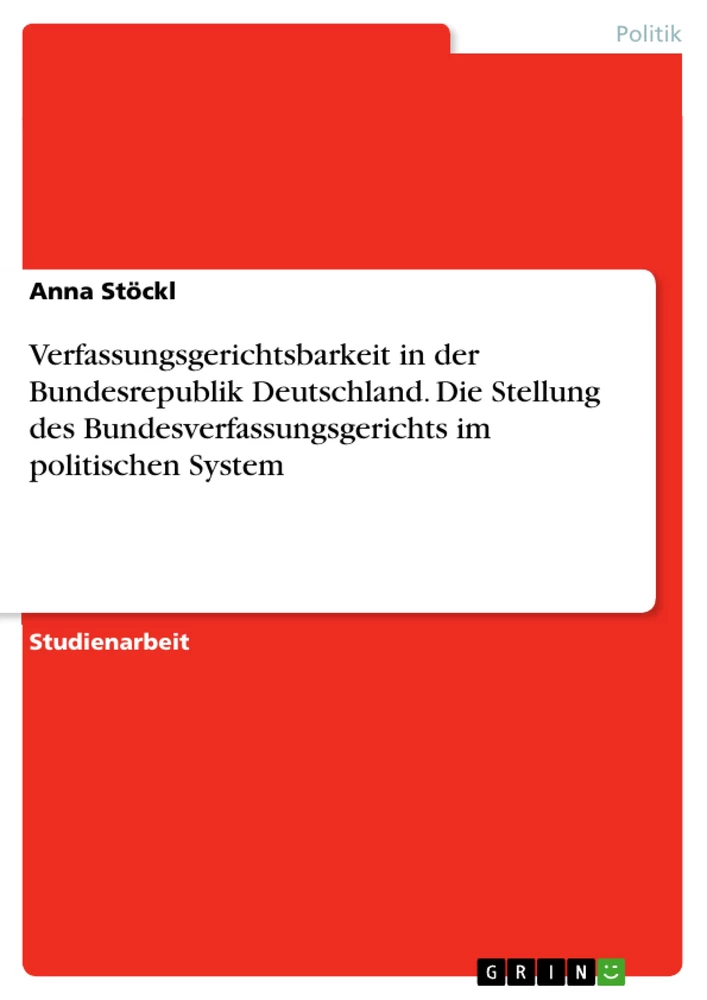Im Rahmen dieser Hausarbeit werden im ersten Teil die wichtigsten Punkte des Buches „Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland“ von Marcus Höreth deskriptiv dargestellt und im zweiten Teil aufgezeigt, wie sich die Stellung des BVerfG im politischen System kompakt erfassen und inwiefern sich die These einer „Karlsruher Republik“ aufrechterhalten oder relativieren lässt. Innerhalb der Buchbesprechung liegt das Hauptaugenmerk auf der Ausarbeitung von Marcus Höreth, zieht jedoch andere wissenschaftliche Quellen hinzu. Auf den geschichtlichen Hintergrund der Verfassungsgerichtsbarkeit wird nur am Rande eingegangen, da eine umfassende Erläuterung über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen würde. Zum Schluss werden im Fazit die Ergebnisse zusammengefasst und ein Blick auf noch offen stehende Fragen und die zukünftige Sicht geworfen.
Es gibt kaum mehr Mythen über eine Institution, als über das Karlsruher Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Sowohl über die bundesdeutsche Geschichte, ihre Zuständigkeiten, als auch über die Stellung des Gerichts in der Politik herrschen reißerische Kolportagen. Haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes das Verfassungsgericht erschaffen oder ernannten sich Richter und Richterinnen selbst zum mächtigen Verfassungsorgan? Hängt das Verfassungsgericht mit der Politik zusammen oder entscheiden und agieren die Instanzen Politik und Recht unabhängig voneinander? Ist das BVerfG eine Superrevisionsinstanz? Wirken sich gesellschaftliche Entwicklungen auf die Verfassungsgerichtsbarkeit aus oder andersherum?
All diese Fragen und Mythen versucht der Politikwissenschaftler der TU Kaiserslautern Marcus Höreth im Zuge seiner wissenschaftlichen Arbeit zu verstehen und zu beantworten. Sein Band „Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland“ aus der Reihe „Brennpunkt Politik“ entlarvt diese Mythen, zeigt Funktionen und Organisation der Verfassungsgerichtsbarkeit auf, untersucht die Stellung des BVerfG im politischen System und diskutiert die These einer „Karlsruher Republik“. Er stellt Fragen in Bezug auf die Idee der Verfassungsgerichtsbarkeit, verschiedene Organisationsmodelle, die Doppelrolle des Karlsruher Gerichts, die Interdependenz zwischen Gericht und Regierung und der Machtrolle des BVerfG.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Bundesverfassungsgericht
- 2.1. Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der BRD
- 2.1.1. Organisation der Verfassungsgerichtsbarkeit
- 2.1.2. Funktionen der Verfassungsgerichtsbarkeit
- 2.1.3. Probleme der Verfassungsgerichtsbarkeit
- 2.2. Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System
- 2.3. These einer „Karlsruher Republik“
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Mythen rund um das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu entlarven und seine Stellung im politischen System der Bundesrepublik Deutschland zu analysieren. Sie basiert auf dem Buch „Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland“ von Marcus Höreth. Die Arbeit beschreibt die Organisation und Funktionen des BVerfG und diskutiert die These einer „Karlsruher Republik“.
- Organisation und Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland
- Stellung des BVerfG im politischen System
- Vergleich verschiedener Modelle der Verfassungsgerichtsbarkeit (z.B. US-amerikanisches und österreichisches Modell)
- Die „Karlsruher Republik“ – These und deren kritische Betrachtung
- Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Verfassungsgerichtsbarkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die zahlreichen Mythen, die das Bundesverfassungsgericht umgeben. Sie stellt zentrale Fragen nach der Entstehung des Gerichts, seiner Unabhängigkeit von der Politik und seinem Einfluss auf politische Entscheidungen. Die Arbeit von Marcus Höreth wird als Grundlage der Analyse vorgestellt, wobei der Fokus auf der Beschreibung der wichtigsten Punkte des Buches und der kritischen Auseinandersetzung mit der These einer „Karlsruher Republik“ liegt. Der historische Hintergrund wird nur kurz angerissen.
2. Das Bundesverfassungsgericht: Dieses Kapitel beschreibt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) als höchstes deutsches Gericht mit Sitz in Karlsruhe, zuständig für verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Fragen. Es erläutert die Organisation des Gerichts in zwei Senate mit jeweils acht Richtern und mehreren Kammern, die für die Bearbeitung von Verfassungsbeschwerden zuständig sind. Die Wahl des Standorts Karlsruhe soll die Unabhängigkeit des Gerichts von der Politik gewährleisten. Die Rolle des BVerfG als „Hüter der Verfassung“ wird hervorgehoben, sowie seine Zuständigkeit für Grundrechtsstreitigkeiten und staatsorganisatorische Fragen.
2.1. Verfassungsgerichtsbarkeit in der BRD: Dieses Kapitel vergleicht das deutsche Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit mit dem amerikanischen und österreichischen System. Es unterscheidet zwischen der „diffusen“ (US-amerikanisches Modell) und der „konzentrierten“ (österreichisches und deutsches Modell) Verfassungsgerichtsbarkeit. Der Vorteil des deutschen Modells mit seiner institutionellen Trennung von Fachgerichtsbarkeit und Verfassungsgerichtsbarkeit wird herausgestellt, im Gegensatz zum amerikanischen Modell, wo das oberste Gericht zugleich als Verfassungsgericht fungiert. Die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland und die Bedeutung des BVerfG für den Schutz der Verfassung werden diskutiert.
2.1.1. Organisation der Verfassungsgerichtsbarkeit: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss der Rechtsprechung auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen, sowohl im Kontext der isolierten als auch der diffusen Verfassungsgerichtsbarkeit. Der Vorteil des deutschen Trennungsmodells, bei dem die Kompetenz der verfassungsrechtlichen Normenkontrolle bei einem einzigen Organ liegt, wird im Vergleich zum Nachteil des amerikanischen Modells mit der Doppelrolle des obersten Gerichts als Verfassungsgericht herausgestellt. Das deutsche Modell wird als Vorbild für viele andere Länder gesehen.
Schlüsselwörter
Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Verfassungsgerichtsbarkeit, Grundgesetz, Normenkontrolle, Karlsruher Republik, Politikwissenschaft, Rechtsprechung, Verfassungsschutz, institutionelle Unabhängigkeit, diffuse vs. konzentrierte Verfassungsgerichtsbarkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Analyse der Verfassungsgerichtsbarkeit
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland, mit besonderem Fokus auf das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Er analysiert die Organisation und Funktion des BVerfG, seine Stellung im politischen System und die umstrittene These einer „Karlsruher Republik“. Der Text basiert auf dem Buch „Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland“ von Marcus Höreth.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: die Organisation und Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland (inkl. Vergleich mit US-amerikanischen und österreichischen Modellen), die Stellung des BVerfG im politischen System, die These der „Karlsruher Republik“ und deren kritische Betrachtung, sowie den Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Verfassungsgerichtsbarkeit.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Bundesverfassungsgericht (mit Unterkapiteln zur Organisation und Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit in der BRD, sowie einem Unterunterkapitel zur Organisation der Verfassungsgerichtsbarkeit), und ein Fazit. Zusätzlich enthält er ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte sowie eine Liste von Schlüsselbegriffen.
Was ist die These der „Karlsruher Republik“ und wie wird sie im Text behandelt?
Die „Karlsruher Republik“ ist eine These, die dem Bundesverfassungsgericht einen übermäßigen Einfluss auf das politische System Deutschlands zuschreibt. Der Text untersucht diese These kritisch und analysiert die Rolle des BVerfG im politischen Kontext.
Welche Modelle der Verfassungsgerichtsbarkeit werden verglichen?
Der Text vergleicht das deutsche Modell der konzentrierten Verfassungsgerichtsbarkeit mit dem US-amerikanischen Modell der diffusen Verfassungsgerichtsbarkeit und dem österreichischen Modell. Es werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle diskutiert.
Welche Rolle spielt das Buch von Marcus Höreth?
Das Buch „Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland“ von Marcus Höreth dient als Grundlage für die Analyse im vorliegenden Text. Die Arbeit beschreibt die wichtigsten Punkte des Buches und setzt sich kritisch mit der These einer „Karlsruher Republik“ auseinander.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Verfassungsgerichtsbarkeit, Grundgesetz, Normenkontrolle, Karlsruher Republik, Politikwissenschaft, Rechtsprechung, Verfassungsschutz, institutionelle Unabhängigkeit, diffuse vs. konzentrierte Verfassungsgerichtsbarkeit.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Personen, die sich für die deutsche Verfassungsgerichtsbarkeit und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts im politischen System interessieren. Er eignet sich besonders für akademische Zwecke und die Analyse der im Text behandelten Themen.
- Quote paper
- Anna Stöckl (Author), 2017, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370968