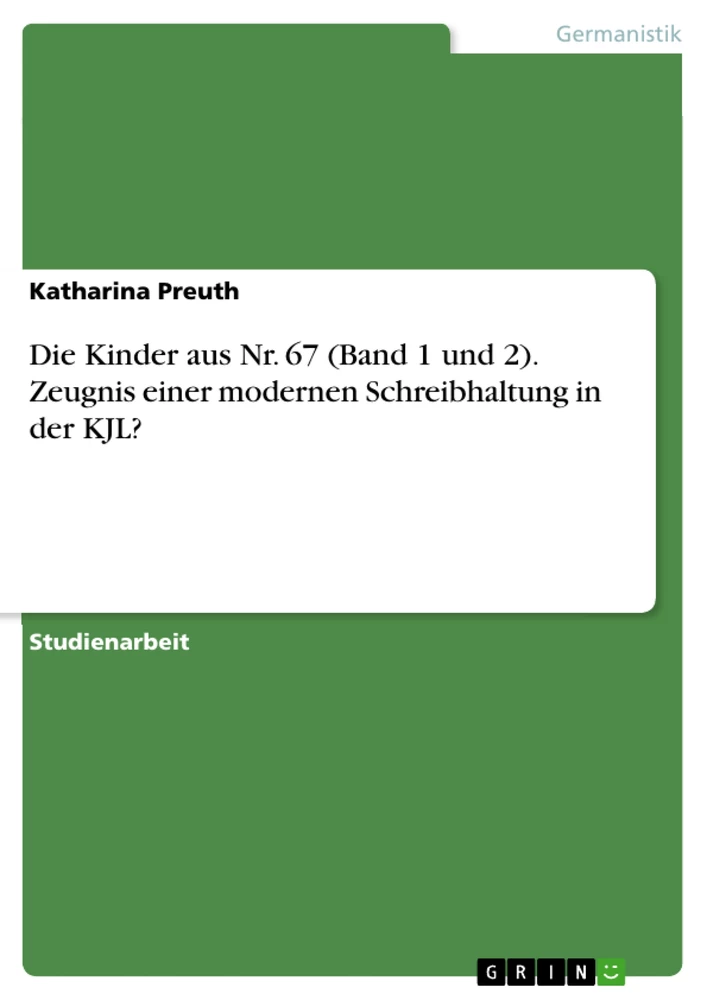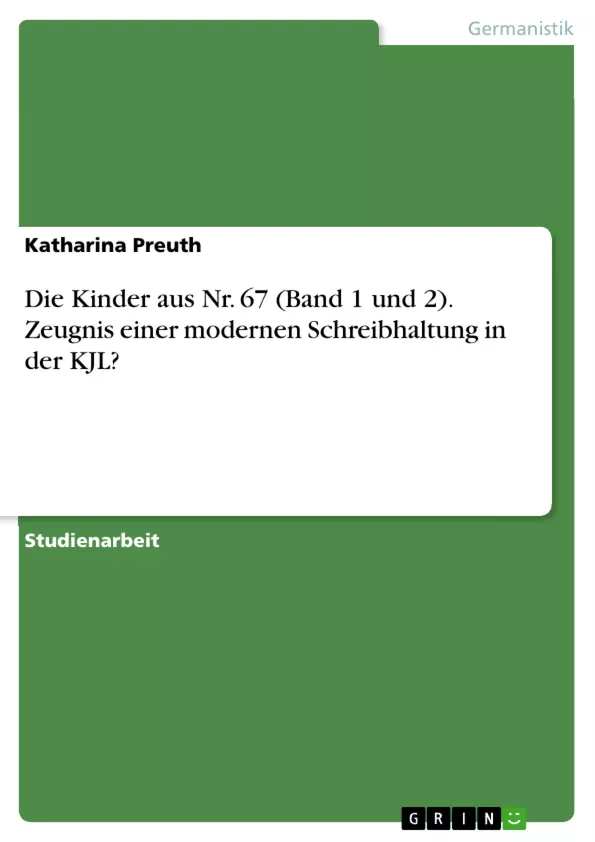In der vorliegenden Arbeit lege ich den Fokus auf die Art und Weise des Schreibens von Lisa Tetzner als Autorin in der Zeit der Weimarer Republik. Exemplarisch beziehe ich mich auf ihr Werk "Die Kinder aus Nr. 67" und die darin enthaltenen Bände "Erwin und Paul – Die Geschichte einer Freundschaft" (Band 1) und "Das Mädchen aus dem Vorderhaus" (Band 2).
Die erste Geschichte aus Band 1 bildete den Ausgangspunkt meiner Seminargestaltung, die ich am 29.05.2013 zusammen mit Sören H. gehalten habe. Tiefergehend diskussionswürdig ist die These zur modernen Schreibhaltung der Autorin geblieben, die ich im zweiten Punkt entfalte. Im dritten Punkt folgt die inhaltliche wie formale Untersuchung. Ein Resümee, das über das Werk Tetzners hinausblickt, schließt sich im vierten Punkt an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Erklärung
- Hinreichende Einordnungen
- (Sachliches) Erzählen in der KJL der Weimarer Republik
- Lisa TETZNER als Vertreterin einer modernen Schreibweise?
- Untersuchung zur Schreibweise von Die Kinder aus Nr. 67
- Inhalt oder „Liegt eine sachliche Entwicklungslogik des Geschehens vor?“
- Darstellung oder „Gibt Lisa TETZNER ihre allwissende Schreibperspektive auf?“
- Analyse der Zeitstruktur
- Analyse des Modus
- Analyse des Erzählers
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schreibweise von Lisa Tetzner in ihrem Werk „Die Kinder aus Nr. 67“ im Kontext der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) der Weimarer Republik. Die zentrale Frage ist, ob Tetzners Schreibstil als modern im Vergleich zu traditionellen Erzählweisen der Zeit betrachtet werden kann. Die Arbeit analysiert sowohl die inhaltlichen als auch die formal-erzählerischen Aspekte des Romans.
- Der Einfluss der „Neuen Sachlichkeit“ auf die KJL der Weimarer Republik.
- Vergleich zwischen traditionellen und modernen Erzählweisen in der KJL.
- Analyse der Erzählperspektive und der Zeitstruktur in Tetzners Werk.
- Die Darstellung von kindlicher Selbstorganisation und veränderten Geschlechterrollen.
- Die Frage nach der „sachlichen Entwicklungslogik des Geschehens“ in Tetzners Roman.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Erklärung: Die Arbeit konzentriert sich auf Lisa Tetzners Schreibstil in „Die Kinder aus Nr. 67“, insbesondere in den Bänden „Erwin und Paul“ und „Das Mädchen aus dem Vorderhaus“. Die Autorin untersucht, ob Tetzners Werk eine moderne Schreibhaltung aufweist, und plant dies anhand einer inhaltlichen und formalen Untersuchung zu belegen. Die Arbeit basiert auf einem Seminarvortrag und vertieft die These einer modernen Schreibhaltung.
Hinreichende Einordnungen: Dieses Kapitel bietet einen Kontext für die Analyse von Tetzners Werk. Es diskutiert die Vielseitigkeit der KJL der Weimarer Republik, sowohl inhaltlich als auch formal. Es wird der Begriff der „Neuen Sachlichkeit“ eingeführt und die Merkmale einer modernen Schreibweise in der KJL erläutert, die sich von traditionellen, erzieherisch-moralisierenden Erzählungen unterscheidet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Handlung ausgehend von den Charakteren und deren veränderbaren Konstellationen, im Gegensatz zu statischen oder stereotypen Darstellungen. Die Bedeutung lebensweltlicher Themen wie die Großstadt, veränderte Generationsrollen und die Rolle von Mädchen in der modernen KJL wird hervorgehoben. Es wird der Übergang von traditionellem, moralisierendem Erzählen hin zu realitätsnaher Literatur beschrieben.
Untersuchung zur Schreibweise von Die Kinder aus Nr. 67: Dieses Kapitel analysiert Tetzners Roman, indem es die Frage nach einer „sachlichen Entwicklungslogik des Geschehens“ und nach dem Verzicht auf eine allwissende Erzählperspektive untersucht. Es wird die Zeitstruktur, der Modus und der Erzähler analysiert, um die Modernität von Tetzners Schreibstil zu belegen. Die Analyse untersucht, ob die Wertungen im Text inhärent sind oder von der Autorin vorgegeben werden. Die Analyse befasst sich mit den Inhalten und der formalen Gestaltung des Romans im Licht der zuvor diskutierten Merkmale der modernen KJL.
Schlüsselwörter
Lisa Tetzner, Die Kinder aus Nr. 67, Kinder- und Jugendliteratur, Weimarer Republik, Neue Sachlichkeit, Moderne Schreibweise, Erzählperspektive, Zeitstruktur, kindliche Selbstorganisation, Geschlechterrollen, Handlungslogik.
Häufig gestellte Fragen zu: „Die Kinder aus Nr. 67“ - Lisa Tetzner
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Schreibstil von Lisa Tetzner in ihrem Werk „Die Kinder aus Nr. 67“ im Kontext der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) der Weimarer Republik. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Tetzners Schreibstil als modern im Vergleich zu traditionellen Erzählweisen der Zeit betrachtet werden kann.
Welche Aspekte von „Die Kinder aus Nr. 67“ werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl inhaltliche als auch formal-erzählerische Aspekte des Romans. Dazu gehören die Analyse der Erzählperspektive, der Zeitstruktur, des Modus und des Erzählers. Es wird auch die Frage nach einer „sachlichen Entwicklungslogik des Geschehens“ und der Darstellung von kindlicher Selbstorganisation und veränderten Geschlechterrollen untersucht.
Wie wird die Modernität von Tetzners Schreibstil bewertet?
Die Modernität des Schreibstils wird im Vergleich zu traditionellen, erzieherisch-moralisierenden Erzählungen der Zeit beurteilt. Es wird untersucht, ob Tetzner eine allwissende Erzählperspektive aufgibt und ob die Wertungen im Text inhärent sind oder von der Autorin vorgegeben werden. Der Einfluss der „Neuen Sachlichkeit“ auf die KJL der Weimarer Republik spielt dabei eine wichtige Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was beinhalten diese?
Die Arbeit gliedert sich in: Eine einleitende Erklärung, ein Kapitel mit hinreichenden Einordnungen (Kontextualisierung der KJL der Weimarer Republik und der „Neuen Sachlichkeit“), ein Kapitel mit der Untersuchung der Schreibweise in „Die Kinder aus Nr. 67“ (Analyse von Inhalt, Erzählperspektive, Zeitstruktur, Modus und Erzähler) und ein Resümee.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lisa Tetzner, Die Kinder aus Nr. 67, Kinder- und Jugendliteratur, Weimarer Republik, Neue Sachlichkeit, Moderne Schreibweise, Erzählperspektive, Zeitstruktur, kindliche Selbstorganisation, Geschlechterrollen, Handlungslogik.
Welche Werke von Lisa Tetzner werden betrachtet?
Der Fokus liegt auf „Die Kinder aus Nr. 67“, insbesondere auf den Bänden „Erwin und Paul“ und „Das Mädchen aus dem Vorderhaus“.
Welchen Kontext bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet einen Kontext durch die Diskussion der Vielseitigkeit der KJL der Weimarer Republik, des Begriffs der „Neuen Sachlichkeit“ und der Merkmale einer modernen Schreibweise in der KJL im Vergleich zu traditionellen Erzählungen.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Die zentrale Frage ist, ob Tetzners Schreibstil als modern im Vergleich zu traditionellen Erzählweisen der Zeit betrachtet werden kann. Weiterhin wird untersucht, ob in „Die Kinder aus Nr. 67“ eine „sachliche Entwicklungslogik des Geschehens“ vorliegt und ob Tetzner ihre allwissende Schreibperspektive aufgibt.
- Citar trabajo
- Master of Education Katharina Preuth (Autor), 2013, Die Kinder aus Nr. 67 (Band 1 und 2). Zeugnis einer modernen Schreibhaltung in der KJL?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370972