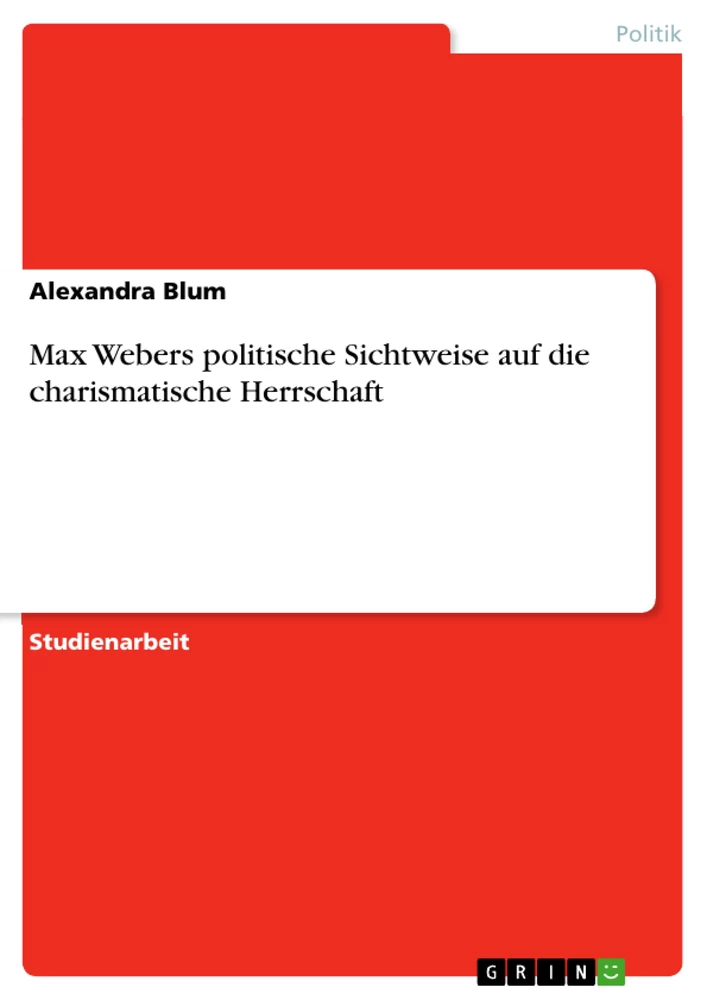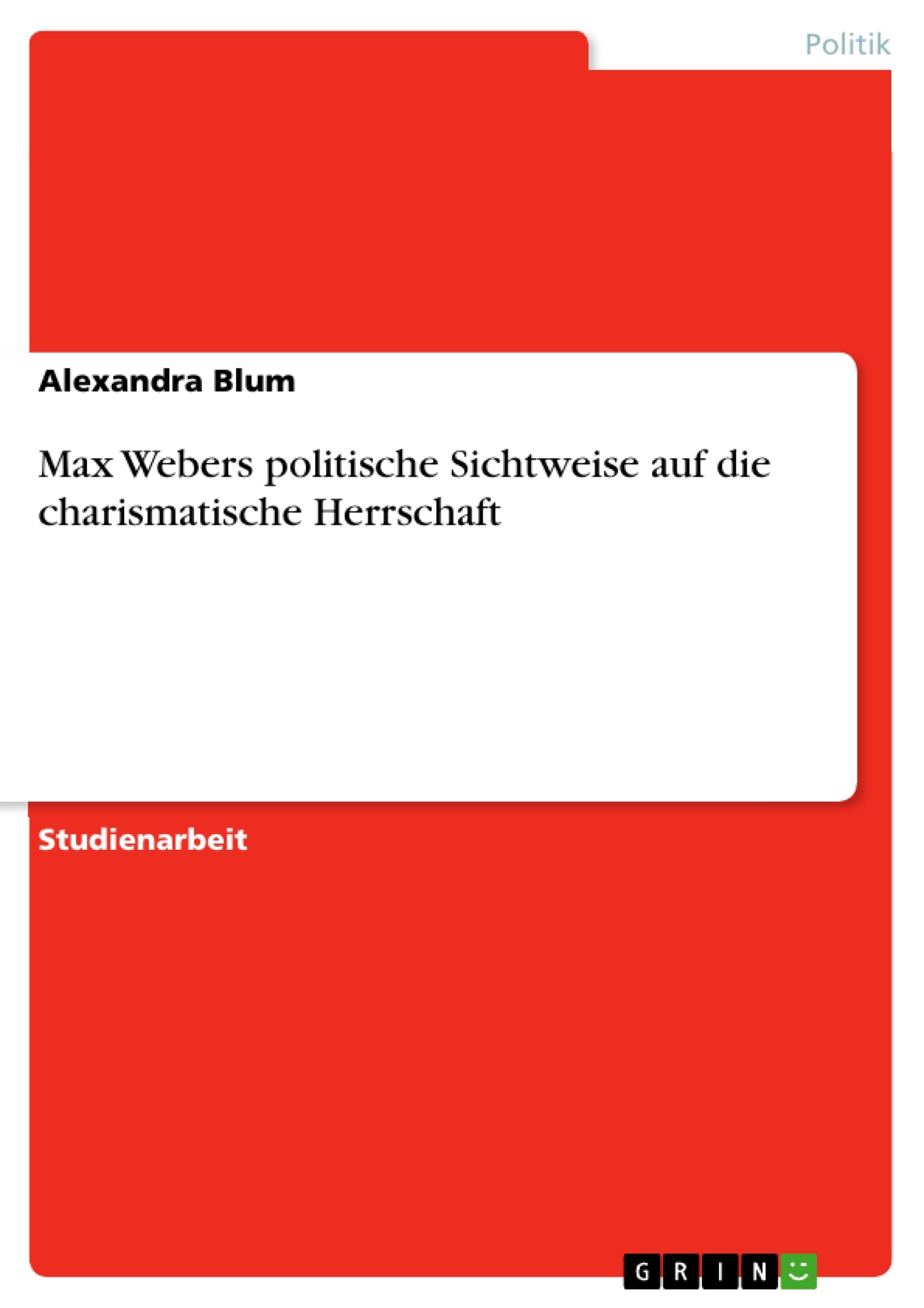"Es steht geschrieben, ich aber sage euch" wurde schon einst von Jesus gesagt und findet in Max Webers charismatischer Herrschaftsform einen bedeutsamen Stellenwert. Weber analysierte schon Anfang der 20er Jahre die Definition von Macht, Herrschaft und die Unterscheidung von Herrschaftstypen. Oftmals wird aufgrund historischer Interpretationsansätze auf Webers drei reine Typen der legitimen Herrschaft zurückgegriffen. Er differenziert zwischen der legalen, traditionalen und charismatischen Herrschaft und betrachtet hierbei Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Herrschaftstypen.
In Anbetracht dieser Unterscheidungen der Herrschaftsformen ist die folgende Arbeit unterteilt in die Erklärung bestimmter Begrifflichkeiten wie Legitimität, Macht, Herrschaft und Verwaltungsstab, das Beschreiben der drei Herrschaftstypen und anschließend eine Analyse der charismatischen Herrschaft. Ziel dieser Arbeit ist es, die Entstehung der charismatischen Herrschaft von Weber zu erläutern. Hierfür ist die politische Situation in der Vergangenheit Deutschlands ein wichtiger Faktor.
Es werden Webers Sichtweisen auf die Politik in Deutschland und die politische Führung aufgeführt und Bezug auf seine Herrschaftsformen genommen. Anschließend erfolgt ein kurzer historischer Exkurs zum Nationalsozialismus. Hierbei wird Hitlers Persönlichkeit, sein Führungsstil und seine Wirkung beschrieben. Es soll aufgezeigt werden, dass Webers charismatische Herrschaft auch anhand eines historischen Beispiels anwendbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. KONSTRUKTIONSPRINZIPIEN
- 2.1. LEGITIMITÄTSGRÜNDE
- 2.2 MACHT UND HERRSCHAFT
- 2.3 DER VERWALTUNGSSTAB
- 3. DIE DREI REINEN TYPEN DER LEGITIMEN HERRSCHAFT
- 3.1 LEGALE HERRSCHAFT
- 3.2 TRADITIONALE HERRSCHAFT
- 3.3 CHARISMATISCHE HERRSCHAFTSFORM
- 3.3.1 DEFINITION VON CHARISMA
- 3.3.2 BEDINGUNGEN ZUR ENTSTEHUNG EINER CHARISMATISCHEN HERRSCHAFT
- 3.3.3 CHARISMATISCHE HERRSCHAFT
- 3.4 WEBERS DEUTSCHE POLITIK
- 3.5 WEBERS POLITISCHE FÜHRUNG
- 3.6 HISTORISCHES BEISPIEL NATIONALSOZIALISMUS
- 4. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Max Webers Analyse der charismatischen Herrschaft und untersucht, wie sie entsteht und sich entwickelt. Sie beleuchtet Webers Definitionen von Macht und Herrschaft sowie seine Unterscheidung verschiedener Herrschaftstypen. Der Fokus liegt dabei auf den Faktoren, die zur Entstehung charismatischer Herrschaft führen, und analysiert die Rolle der Politik in Deutschland aus Webers Perspektive. Zudem wird die historische Entwicklung des Nationalsozialismus im Lichte der charismatischen Herrschaft beleuchtet.
- Die Konstruktionsprinzipien von Max Webers Herrschaftssoziologie
- Die drei Typen der legitimen Herrschaft: legale, traditionelle und charismatische Herrschaft
- Die Bedingungen für die Entstehung charismatischer Herrschaft
- Webers Sicht auf die deutsche Politik und politische Führung
- Der Nationalsozialismus als historisches Beispiel für charismatische Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den Fokus der Arbeit. Sie betont die Bedeutung von Max Webers Analyse der charismatischen Herrschaft im Kontext der deutschen Geschichte und Politik. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Konstruktionsprinzipien von Webers Herrschaftssoziologie, wobei insbesondere die Legitimitätsgründe, Macht und Herrschaft sowie der Verwaltungsstab beleuchtet werden. Kapitel 3 definiert die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft: die legale, die traditionelle und die charismatische Herrschaft. Es wird ein besonderer Schwerpunkt auf die charismatische Herrschaft gelegt, inklusive der Definition von Charisma, den Bedingungen für ihre Entstehung und ihren Eigenschaften. Kapitel 3 behandelt zudem Webers Sicht auf die deutsche Politik und seine Analyse der politischen Führung. Schließlich wird der Nationalsozialismus als historisches Beispiel für die charismatische Herrschaft untersucht.
Schlüsselwörter
Max Weber, Herrschaftssoziologie, Legitimität, Macht, Herrschaft, Verwaltungsstab, legale Herrschaft, traditionelle Herrschaft, charismatische Herrschaft, Charisma, deutsche Politik, politische Führung, Nationalsozialismus.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Blum (Autor:in), 2017, Max Webers politische Sichtweise auf die charismatische Herrschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370974