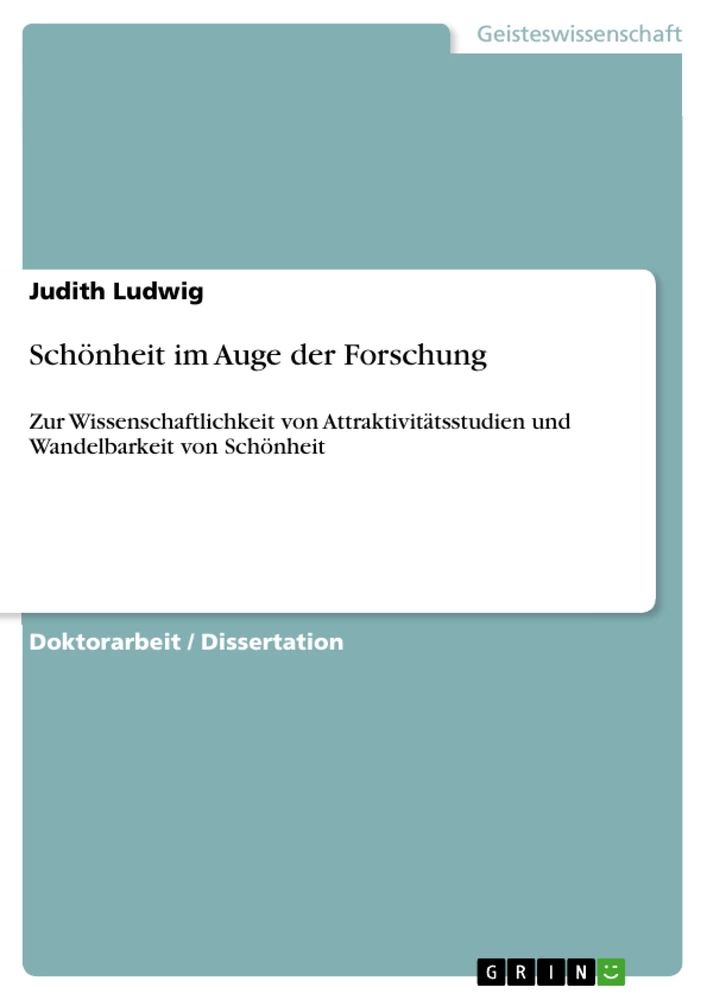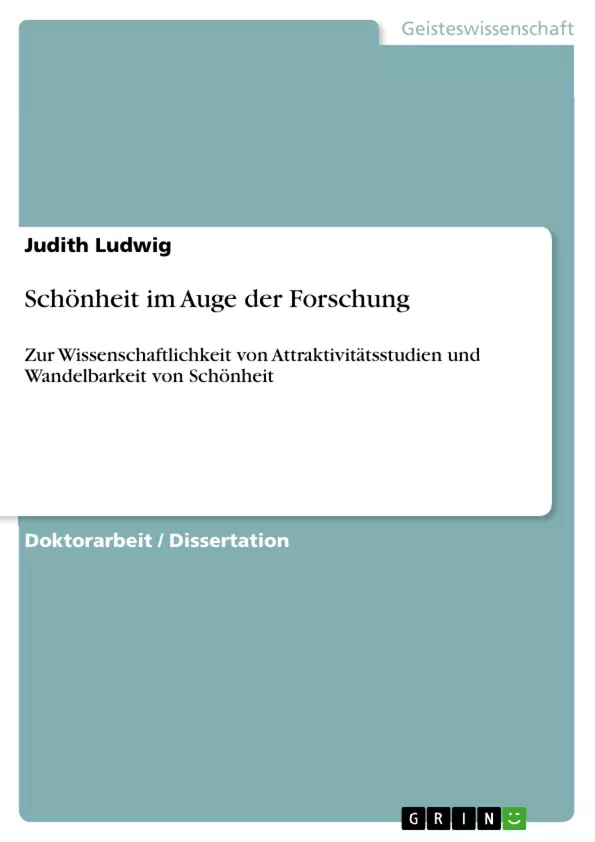Für bestimmte Berufszweige, wie etwa die plastische Chirurgie und die Kosmetikindustrie, erscheint es wichtig, eine genaue, mathematisch berechenbare Form der Schönheit zu definieren. Das Schönheitsideal ist jedoch nicht universal und Schönheit kein Indikator evolutionärer Fitness. Es wird gezeigt, daß die sogenannten wissenschaftlichen Studien durch die Form ihrer Untersuchung das Ergebnis schon mitbestimmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Teil: Einleitung
- 1.1 Forschungsüberblick
- 1.2 Eigenschaften
- 1.3 Operationalisierung von Attraktivitätsmerkmalen
- 1.3.1 Testgesichter
- 1.3.2 Merkmalsfestlegung
- 1.3.3 Wittgensteinsche Begriffsbestimmung
- 1.3.4 Problematik durch Korrelationsmessung
- 1.4 Universales Ideal
- 1.5 Warum gibt es Schönheit?
- 1.6 Wandelbarkeit des Schönheitsideals
- 1.7 Ziel dieser Arbeit
- 2. Teil: Studien
- 2.1 Die Messung - Auswahl der Testpersonen und Studienaufbau
- 2.1.1 Über Statistik im Allgemeinen
- 2.2 Kulturvergleich in Cross-cultural Studies
- 2.2.1 Iliffe
- 2.2.2 Cross
- 2.2.3 Jones
- 2.2.4 Buss
- 2.2.5 Cunningham
- 2.3 Studien an Kindern
- 2.4 Thornhill, gute Gene und die Symmetrie
- 2.4.1 Merkmale
- 2.4.2 Symmetrie
- 2.4.2.1 Exkurs Symmetrieformen
- 2.4.2.2 Schwierigkeiten bei der Symmetriemessung
- 2.4.2.2.1 Messfehler
- 2.4.2.2.2 Meta-Analysen
- 2.4.2.3 Symmetriestudien
- 2.4.2.3.1 Symmetrie und Gesundheit
- 2.4.2.3.2 Asymmetrie und psychische Gesundheit
- 2.4.3 Sensorische Diskriminierung als alternative Erklärung für die Attraktivität von Symmetrie und Jugend- und Reifemerkmalen bei Menschen
- 2.5 Zusammenfassung
- 3. Teil: Darwin, Parental Investment und das Handicap Prinzip
- 3.1 Interkulturelles Ideal
- 3.2 Ursprung der Rassen
- 3.2.1 Natürliche und sexuelle Selektion bei Darwin
- 3.2.2 Genaue Unterscheidung natürlicher und sexueller Selektion
- 3.3 Female Choice
- 3.4 Ästhetischer Sinn
- 3.5 Parental Investment und das Handicap Prinzip
- 3.5.1 Parental Investment
- 3.5.2 Zahavis Handicap Prinzip
- 4. Teil: Wandelbarkeit des Schönheitsideals
- 4.1 Antike
- 4.1.1 Die antiken Regeln für ein schönes Gesicht
- 4.2 Mittelalter
- 4.3 Übergang des Mittelalters in die Renaissance
- 4.3 Renaissance
- 4.4 Manierismus
- 4.5 Rokoko
- 4.6 Neoklassizismus und Klassizismus
- 4.7 Realismus
- 4.8 Präraffaeliten
- 4.9 Symbolismus
- 4.10 Moderne und Postmoderne
- 4.11 Merkwürdige Schönheit
- 4.12 Zusammenfassung
- Methodische Kritik an Attraktivitätsstudien (Operationalisierung, Stichproben, statistische Verfahren)
- Bewertung der "Guten Gene"-Theorie und des Handicap-Prinzips
- Analyse interkultureller Studien und Studien an Kindern
- Kunstgeschichtliche Untersuchung der Wandelbarkeit von Schönheitsidealen
- Diskussion der sozialen und kulturellen Faktoren bei der Wahrnehmung von Schönheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wissenschaftlichkeit von Attraktivitätsstudien und die Wandelbarkeit von Schönheitsidealen. Sie analysiert die Methoden und Ergebnisse existierender Studien kritisch und hinterfragt die Interpretationen im Hinblick auf ein angeborenes, universelles Schönheitsempfinden.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Teil: Einleitung: Dieser Teil liefert einen einführenden Überblick über die wissenschaftliche Forschung zum Thema Schönheit und Attraktivität, beleuchtet die unterschiedliche Verwendung der Begriffe „Schönheit“ und „Attraktivität“ in der Literatur und benennt zentrale Forschungsfragen der Arbeit. Es werden die wichtigsten Merkmale (Symmetrie, Durchschnittlichkeit, Jugendlichkeit, Reife) genannt, die in den folgenden Kapiteln detailliert untersucht werden. Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeiten bei der Operationalisierung dieser Merkmale und die Problematik der Interpretation von Korrelationsmessungen.
2. Teil: Studien: Dieser Abschnitt präsentiert und analysiert diverse Studien zur Wahrnehmung von Schönheit und Attraktivität. Er untersucht kritisch die Methoden der Studien (Stichprobenauswahl, Bewertungskriterien, statistische Auswertung) und deren Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf die Behauptung eines universalen Schönheitsideals. Die Kapitel behandeln interkulturelle Studien (Iliffe, Cross, Jones, Buss, Cunningham) und Studien zu Kleinkindern, sowie die Rolle der Symmetrie und die "Guten Gene"-Theorie (Thornhill).
3. Teil: Darwin, Parental Investment und das Handicap Prinzip: Dieser Teil beleuchtet Darwins Theorien zur sexuellen Selektion im Kontext von "Parental Investment" (Trivers) und dem "Handicap-Prinzip" (Zahavi). Es wird diskutiert, inwiefern diese Theorien die Wahrnehmung von Schönheit erklären können und wie diese Theorien kritisch zu bewerten sind. Die Kapitel analysieren Darwins Konzept der sexuellen Selektion und die Rolle der "female choice", sowie die Anwendung der Theorien von Trivers und Zahavi auf das menschliche Verhalten.
4. Teil: Wandelbarkeit des Schönheitsideals: Dieser Abschnitt demonstriert anhand kunstgeschichtlicher Beispiele (Gemälde, Skulpturen, Fotografien) die Wandelbarkeit von Schönheitsidealen über verschiedene Epochen und Kulturen hinweg. Die Kapitel analysieren die unterschiedlichen Schönheitsideale der Antike, des Mittelalters, der Renaissance, des Manierismus, des Rokoko, des Neoklassizismus, des Klassizismus, des Realismus, der Präraffaeliten, des Symbolismus, der Moderne und der Postmoderne, und zeigen die Variabilität der bevorzugten Gesichts- und Körpermerkmale auf.
Schlüsselwörter
Schönheit, Attraktivität, Attraktivitätsforschung, Symmetrie, Durchschnittlichkeit, „Gute Gene“-Theorie, Handicap-Prinzip, sexuelle Selektion, kulturelle Einflüsse, Parental Investment, Wandelbarkeit des Schönheitsideals, Methodenkritik, statistische Auswertung, Interkulturelle Studien, Kleinkinderstudien, Kunstgeschichte, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wissenschaftlichkeit von Attraktivitätsstudien und die Wandelbarkeit von Schönheitsidealen
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Wissenschaftlichkeit von Attraktivitätsstudien und die Wandelbarkeit von Schönheitsidealen. Sie analysiert kritisch Methoden und Ergebnisse bestehender Studien und hinterfragt die Interpretationen bezüglich eines angeborenen, universellen Schönheitsempfindens.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt methodische Kritik an Attraktivitätsstudien (Operationalisierung, Stichproben, statistische Verfahren), die Bewertung der "Guten Gene"-Theorie und des Handicap-Prinzips, die Analyse interkultureller Studien und Studien an Kindern, eine kunstgeschichtliche Untersuchung der Wandelbarkeit von Schönheitsidealen und die Diskussion sozialer und kultureller Faktoren bei der Wahrnehmung von Schönheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Einleitung, Studien, Darwin, Parental Investment und das Handicap Prinzip, und Wandelbarkeit des Schönheitsideals. Die Einleitung gibt einen Forschungsüberblick und definiert zentrale Begriffe und Forschungsfragen. Der zweite Teil analysiert verschiedene Attraktivitätsstudien. Der dritte Teil beleuchtet Darwins Theorien zur sexuellen Selektion im Kontext von Parental Investment und dem Handicap-Prinzip. Der vierte Teil zeigt anhand kunstgeschichtlicher Beispiele die Wandelbarkeit von Schönheitsidealen auf.
Welche Studien werden im zweiten Teil analysiert?
Der zweite Teil analysiert verschiedene Studien zur Wahrnehmung von Schönheit und Attraktivität, einschließlich interkultureller Studien (Iliffe, Cross, Jones, Buss, Cunningham) und Studien an Kleinkindern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Symmetrie und der "Guten Gene"-Theorie (Thornhill), inklusive einer kritischen Betrachtung der Methoden und Ergebnisse.
Welche Rolle spielen Darwin, Parental Investment und das Handicap-Prinzip?
Der dritte Teil untersucht Darwins Theorien zur sexuellen Selektion im Kontext von Trivers' Parental Investment und Zahavis Handicap-Prinzip. Es wird diskutiert, inwiefern diese Theorien die Wahrnehmung von Schönheit erklären können und wie diese Theorien kritisch zu bewerten sind. Die Rolle der "female choice" wird ebenfalls analysiert.
Wie wird die Wandelbarkeit des Schönheitsideals dargestellt?
Der vierte Teil zeigt anhand von kunstgeschichtlichen Beispielen (aus Antike, Mittelalter, Renaissance, Manierismus, Rokoko, Neoklassizismus, Klassizismus, Realismus, Präraffaeliten, Symbolismus, Moderne und Postmoderne) die Wandelbarkeit von Schönheitsidealen über verschiedene Epochen und Kulturen hinweg auf. Die Variabilität der bevorzugten Gesichts- und Körpermerkmale wird analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schönheit, Attraktivität, Attraktivitätsforschung, Symmetrie, Durchschnittlichkeit, „Gute Gene“-Theorie, Handicap-Prinzip, sexuelle Selektion, kulturelle Einflüsse, Parental Investment, Wandelbarkeit des Schönheitsideals, Methodenkritik, statistische Auswertung, interkulturelle Studien, Kleinkinderstudien, Kunstgeschichte, Identität.
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeiten bei der Operationalisierung von Attraktivitätsmerkmalen (Symmetrie, Durchschnittlichkeit, Jugendlichkeit, Reife), die Problematik der Interpretation von Korrelationsmessungen und die kritische Bewertung der Methoden in den untersuchten Attraktivitätsstudien (Stichprobenauswahl, Bewertungskriterien, statistische Auswertung).
- Quote paper
- Judith Ludwig (Author), 2013, Schönheit im Auge der Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370986