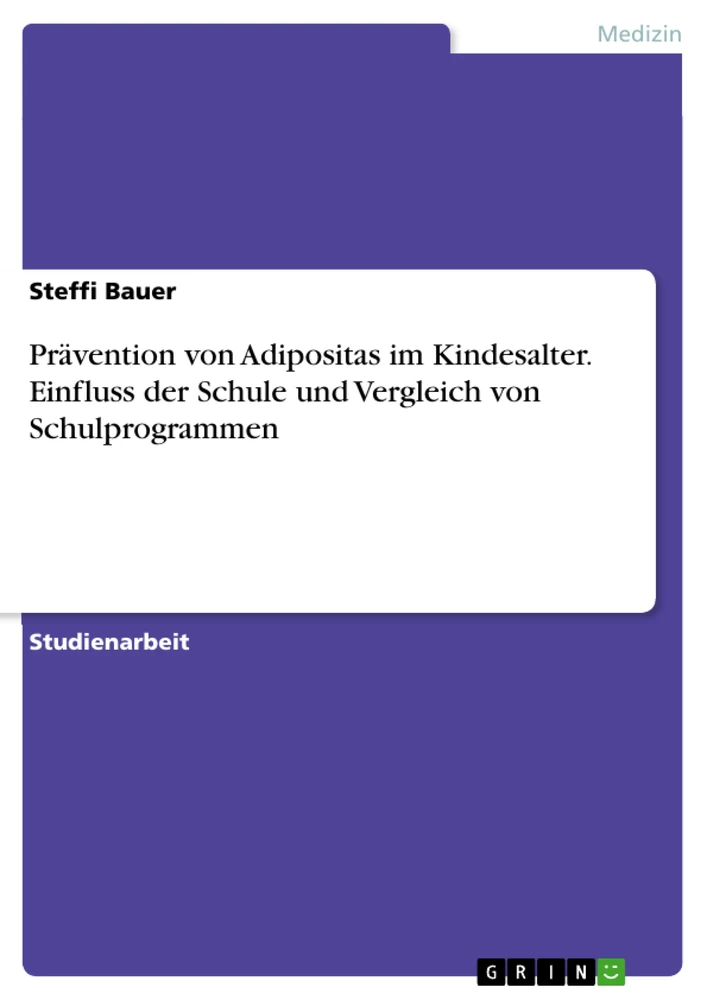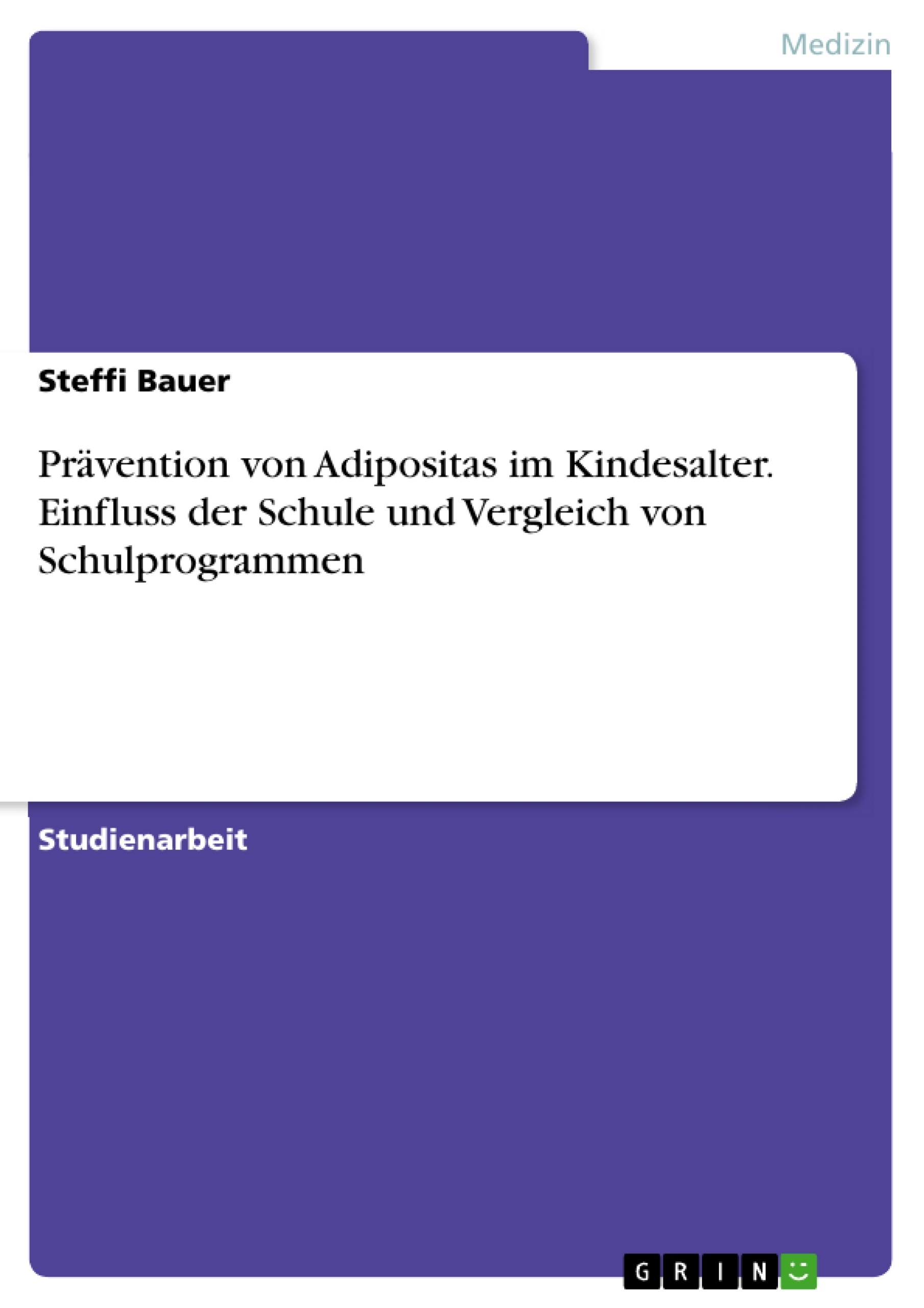Die aktuelle Zahl der übergewichtigen und adipösen Kinder in Deutschland ist besonders hoch und steigt stetig weiter an. Besonders, wenn Kinder bereits in jungen Jahren an Übergewicht oder Adipositas leiden, ist es für sie schwer, wieder ein Normalgewicht zu erlangen. Die Gefahr, im höheren Lebensalter an Begleiterkrankungen und Folgeerkrankungen des Übergewichts zu erkranken, ist dadurch zusätzlich erhöht. Dieses Problem gilt es zu lösen, indem man durch Ernährungsaufklärung und -bildung bereits bei Kindern im jungen Alter ansetzt und sie zu einer gesunden Ernährung in Kombination mit ausreichend Bewegung motiviert.
In dieser Arbeit wird in diesem Zusammenhang die Ernährungsaufklärung von Kindern in Grundschulen durch zwei spezielle Schulprogramme hinsichtlich der Fragestellungen „Welches Schulprogramm eignet sich zur Prävention von Adipositas im Kindesalter? Welche Vor- und Nachteile weisen die Schulprogramme beim Vergleich miteinander auf?“ untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Zielsetzung und Vorgehensweise
- Übergewicht und Adipositas im Kindesalter
- Definition
- Prävalenz
- Ätiologie
- Wie kann die Grundschule Einfluss auf die Prävention von Adipositas bei Kindern nehmen?
- Vorstellung des Programms „Ernährungsführerschein“
- Programmbeschreibung
- Inhalte
- Vorstellung des Programms „Klasse 2000“
- Programmbeschreibung
- Inhalte
- Entwickeln von Vergleichskriterien
- Vergleich beider Programme
- Vergleich hinsichtlich Bewegung
- Vergleich hinsichtlich Zeitaufwand und Wiederholung
- Vergleich hinsichtlich Partizipation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Untersuchung des Einflusses von Schulprogrammen auf die Prävention von Adipositas im Kindesalter. Der Fokus liegt dabei auf dem Vergleich der Programme „Ernährungsführerschein“ und „Klasse 2000“.
- Definition und Prävalenz von Übergewicht und Adipositas im Kindesalter
- Mögliche Einflussfaktoren und Ursachen für Adipositas bei Kindern
- Rolle der Grundschule bei der Prävention von Adipositas
- Detaillierte Beschreibung der Programme „Ernährungsführerschein“ und „Klasse 2000“
- Vergleich der Programme hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Eignung zur Adipositasprävention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Problematik des Übergewichts und der Adipositas bei Kindern in Deutschland dar. Außerdem werden die Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit erläutert.
Das zweite Kapitel definiert die Begriffe Übergewicht und Adipositas im Kindesalter und beleuchtet die Prävalenz sowie mögliche Ursachen dieser Problematik.
Im dritten Kapitel wird die Rolle der Grundschule bei der Prävention von Adipositas beleuchtet. Hier werden Möglichkeiten zur Einflussnahme der Schule auf die Lebensweise der Kinder aufgezeigt.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Schulprogramm „Ernährungsführerschein“. Es werden Inhalte, Zielgruppen, Zeitrahmen und weitere relevante Aspekte des Programms beschrieben.
Das fünfte Kapitel beschreibt das Schulprogramm „Klasse 2000“ und geht dabei auf seine Inhalte, Zielgruppen und Umsetzung ein.
Kapitel sechs beleuchtet die Entwicklung von Vergleichskriterien für die beiden Schulprogramme.
Im siebten Kapitel erfolgt ein detaillierter Vergleich der Programme „Ernährungsführerschein“ und „Klasse 2000“ in Bezug auf Bewegung, Zeitaufwand, Wiederholung und Partizipation.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen Themen wie Adipositasprävention, Ernährungsaufklärung, Schulprogramme, „Ernährungsführerschein“, „Klasse 2000“, Vergleich, Grundschule, Übergewicht, Bewegung, Zeitaufwand und Partizipation.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Adipositasprävention bereits im Grundschulalter wichtig?
Da die Zahl übergewichtiger Kinder steigt und es im Alter schwerer ist, Normalgewicht zu erreichen, ist frühzeitige Prävention entscheidend, um Folgeerkrankungen zu vermeiden.
Was ist das Ziel des Programms „Ernährungsführerschein“?
Der „Ernährungsführerschein“ vermittelt Kindern praktisches Wissen über gesunde Ernährung und motiviert sie zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln.
Wie unterscheidet sich „Klasse 2000“ von anderen Programmen?
„Klasse 2000“ ist ein umfassendes Programm, das neben Ernährung auch Themen wie Bewegung, Suchtvorbeugung und psychosoziale Gesundheit abdeckt.
Welche Rolle spielt die Schule bei der Vermeidung von Übergewicht?
Schulen können die Lebensweise von Kindern durch Ernährungsbildung, tägliche Bewegungseinheiten und die Gestaltung des Schulumfelds maßgeblich beeinflussen.
Nach welchen Kriterien werden Schulprogramme zur Adipositasprävention verglichen?
Vergleichskriterien sind unter anderem der Anteil an Bewegung, der zeitliche Aufwand, die Regelmäßigkeit der Wiederholung und die aktive Partizipation der Kinder.
Was sind die Ursachen für Adipositas im Kindesalter?
Die Ätiologie umfasst genetische Faktoren, mangelnde Bewegung und eine unausgewogene Ernährung, oft beeinflusst durch das soziale Umfeld.
- Arbeit zitieren
- Steffi Bauer (Autor:in), 2015, Prävention von Adipositas im Kindesalter. Einfluss der Schule und Vergleich von Schulprogrammen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371054