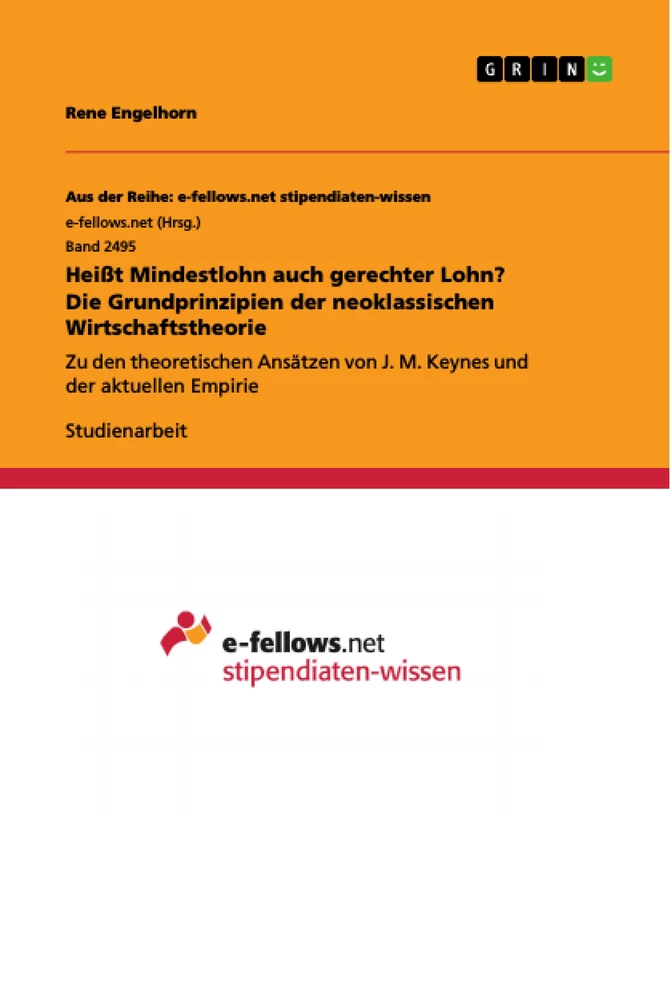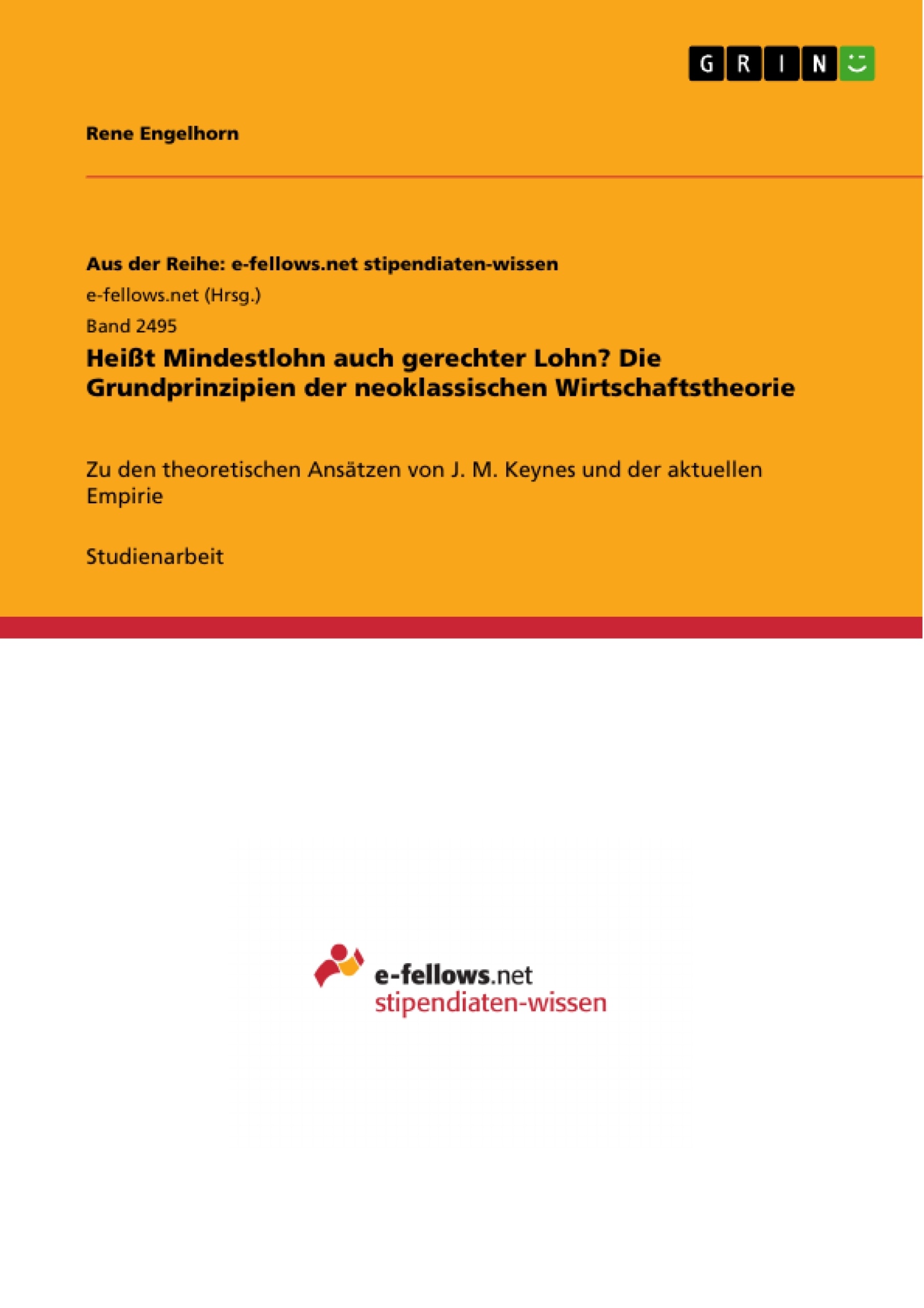Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, die gängigen ökomischen Argumente in der Debatte um die Sinnhaftigkeit eines Mindestlohns zu untersuchen. Das Ergebnis soll hierbei ausdrücklich nicht sein, einen Mindestlohn ausschließlich aufgrund eines theoretischen Konstrukts zu bewerten. Vielmehr sollen die beiden gängigen Denkschulen der Ökonomik zu einer Aussage gebracht werden. Die Ergebnisse dieser Analyse werden im letzten Kapitel mit den Erkenntnissen der Realität verglichen. Konkret widmet sich daher die vorliegende Arbeit dem Ablauf der Lohnfindung in der neoklassischen Wirtschaftstheorie in einem vollkommenen Markt mit vollständiger Konkurrenz, dem Prozess der Lohnfindung nach J. M. Keynes und der Anwendung dieser beiden Denkschulen auf das Konstrukt eines gesetzlichen Mindestlohns. Zum Ende folgt ein Vergleich der vorherigen Kapitel mit der Veränderung des Grades der Beschäftigung in Deutschland seit der Einführung des Mindestlohns.
Ist es die Aufgabe des Staates, in einer Gesellschaft mit freiheitlich demokratischer Grundordnung trotz der Privatautonomie als elementarer Mechanismus dieser, im Bereich des Privatrechts für ein Mindesteinkommen einzelner Bürger zu sorgen und zumindest partiell, entgegen aller Grundsätze in das freie Spiel konkret gegenüberliegender Interessen zugunsten einer Partei einzugreifen?
Die seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 in der Bundesrepublik Deutschland oftmals emotional geführte Debatte offenbart die Komplexität der Thematik und verneint die Möglichkeit, eine einfache Antwort auf die Sinnhaftigkeit eines gesetzlichen Mindestlohns zu geben. Vielmehr, so scheint es, kann ein gesetzlicher Mindestlohn nur Ergebnis einer Abwägung der verschiedenen Argumente sein. Inwiefern die einzelnen Argumente aber von belastbarer Struktur sind, muss anhand einer jeweils isoliert geführten Analyse erfolgen. Neben eher philosophischen Fragen, wie der nach Gerechtigkeit, nehmen insbesondere ökonomisch begründete Ansichten ein breites Feld im öffentlichen Diskurs ein. Besonders von Seiten der Gegner eines gesetzlichen Mindestlohns wurde vor dessen Einführung vor einer nachhaltigen Schädigung der deutschen Wirtschaft gewarnt. Obwohl die hierbei vorhergesagten Szenarien bisher nicht eingetreten sind, hat die öffentliche Beachtung für die dieser Warnungen zugrunde liegenden Argumente nicht abgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Lohnfindung in der neoklassischen Wirtschaftstheorie
- Die Lohnfindung nach J. M. Keynes
- Der gesetzliche Mindestlohn: Eine Gegenüberstellung der neoklassischen Theorie und des Keynesianischen Ansatzes
- Empirische Überprüfung: Beschäftigung in Deutschland seit Einführung des Mindestlohns
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die ökonomischen Argumente in der Debatte um die Sinnhaftigkeit eines gesetzlichen Mindestlohns. Ziel ist es nicht, den Mindestlohn allein auf Basis theoretischer Konstrukte zu bewerten, sondern die neoklassische Theorie und den Keynesianischen Ansatz gegenüberzustellen und die Ergebnisse mit der Realität zu vergleichen.
- Lohnfindung in der neoklassischen Wirtschaftstheorie
- Lohnfindung nach Keynes
- Anwendung beider Theorien auf den gesetzlichen Mindestlohn
- Vergleich der theoretischen Ansätze mit der empirischen Entwicklung der Beschäftigung in Deutschland nach Einführung des Mindestlohns
- Bewertung der ökonomischen Argumente im Diskurs um den Mindestlohn
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beleuchtet die kontroverse Debatte um den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland und betont die Notwendigkeit einer differenzierten Analyse der ökonomischen Argumente, um die Sinnhaftigkeit des Mindestlohns abzuwägen. Es werden sowohl philosophische als auch ökonomische Perspektiven angesprochen, insbesondere die Warnungen vor negativen wirtschaftlichen Folgen, die vor der Einführung geäußert wurden. Das Vorwort legt den Grundstein für die folgende Untersuchung, die sich auf die neoklassische Theorie, den Keynesianischen Ansatz und den empirischen Vergleich konzentriert.
Die Lohnfindung in der neoklassischen Wirtschaftstheorie: Dieses Kapitel untersucht den Mechanismus der Lohnfindung in einem neoklassischen Modell mit vollständiger Konkurrenz und vollkommenem Markt. Es analysiert die Interaktion von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und die Bestimmung des Gleichgewichtslohns. Die Analyse berücksichtigt die Annahmen der neoklassischen Theorie wie rationale Akteure, vollkommene Information und die Anpassungsfähigkeit von Preisen und Löhnen. Die Bedeutung dieses Kapitels liegt in der Bereitstellung eines theoretischen Bezugsrahmens für die spätere Beurteilung der Auswirkungen eines Mindestlohns.
Die Lohnfindung nach J. M. Keynes: Im Gegensatz zur neoklassischen Sichtweise präsentiert dieses Kapitel Keynes' Theorie der Lohnfindung. Hierbei wird der Fokus auf die Rolle von Nachfrage und gesamtwirtschaftlichen Faktoren gelegt, im Gegensatz zur neoklassischen Betonung des Angebots. Der Einfluss von Arbeitslosigkeit und der Bedeutung von aggregierten Nachfragefaktoren auf den Lohn wird detailliert erläutert. Die Gegenüberstellung zur neoklassischen Theorie bildet die Grundlage für einen umfassenden Vergleich im Kontext der Mindestlohn-Debatte.
Der gesetzliche Mindestlohn: Eine Gegenüberstellung der neoklassischen Theorie und des Keynesianischen Ansatzes: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen eines gesetzlichen Mindestlohns unter Berücksichtigung der neoklassischen und der Keynesianischen Perspektive. Es vergleicht die vorherigen Kapitel und bewertet die Vorhersagen beider Theorien bezüglich der Folgen eines Mindestlohns für Beschäftigung und Löhne. Die unterschiedlichen Annahmen und Schlussfolgerungen der beiden Schulen werden gegenübergestellt, um ein umfassendes Bild der theoretischen Debatte zu liefern. Die Bedeutung liegt in der konzeptionellen Klärung der unterschiedlichen Positionen und ihrer Implikationen für die Politikgestaltung.
Schlüsselwörter
Mindestlohn, neoklassische Wirtschaftstheorie, Keynesianischer Ansatz, Lohnfindung, Beschäftigung, Arbeitsmarkt, vollständige Konkurrenz, vollkommener Markt, Empirie, Deutschland, ökonomische Argumente, öffentlicher Diskurs.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Mindestlohn – Neoklassische und Keynesianische Perspektive
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die ökonomischen Argumente für und gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Sie vergleicht die neoklassische und die keynesianische Wirtschaftstheorie hinsichtlich der Lohnfindung und bewertet die Auswirkungen eines Mindestlohns auf Beschäftigung und Löhne in Deutschland. Die theoretischen Erkenntnisse werden mit empirischen Daten verglichen.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die neoklassische Theorie der Lohnfindung (basierend auf Angebot und Nachfrage in einem vollkommenen Markt) mit dem keynesianischen Ansatz, der die Bedeutung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und die Rolle von Arbeitslosigkeit stärker betont.
Wie wird der Mindestlohn in den beiden Theorien betrachtet?
Die neoklassische Theorie prognostiziert potenziell negative Auswirkungen eines Mindestlohns auf die Beschäftigung, da er über dem markträumenden Lohn liegen könnte. Der keynesianische Ansatz hingegen sieht möglicherweise positive Effekte auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Kaufkraft, die die negativen Beschäftigungseffekte kompensieren könnten.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Beschäftigung in Deutschland seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, um die theoretischen Vorhersagen zu überprüfen und zu bewerten, inwieweit die Realität den theoretischen Modellen entspricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet ein Vorwort, Kapitel zur Lohnfindung in der neoklassischen Theorie und nach Keynes, ein Kapitel zum Vergleich beider Ansätze im Kontext des Mindestlohns, sowie ein Kapitel zur empirischen Überprüfung der Auswirkungen des Mindestlohns in Deutschland. Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die ökonomischen Argumente in der Mindestlohndebatte differenziert darzustellen und die theoretischen Modelle mit der empirischen Realität zu konfrontieren. Es geht nicht um eine reine Beurteilung des Mindestlohns, sondern um den Vergleich und die Anwendung verschiedener ökonomischer Theorien.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Text selbst dargestellt. Die Arbeit präsentiert einen Vergleich der theoretischen Ansätze und deren Übereinstimmung mit den empirischen Daten zur Beschäftigung in Deutschland nach der Einführung des Mindestlohns. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung der neoklassischen und keynesianischen Perspektiven.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Mindestlohn, neoklassische Wirtschaftstheorie, Keynesianischer Ansatz, Lohnfindung, Beschäftigung, Arbeitsmarkt, vollständige Konkurrenz, vollkommener Markt, Empirie, Deutschland, ökonomische Argumente und öffentlicher Diskurs.
- Quote paper
- Rene Engelhorn (Author), 2016, Heißt Mindestlohn auch gerechter Lohn? Die Grundprinzipien der neoklassischen Wirtschaftstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371167