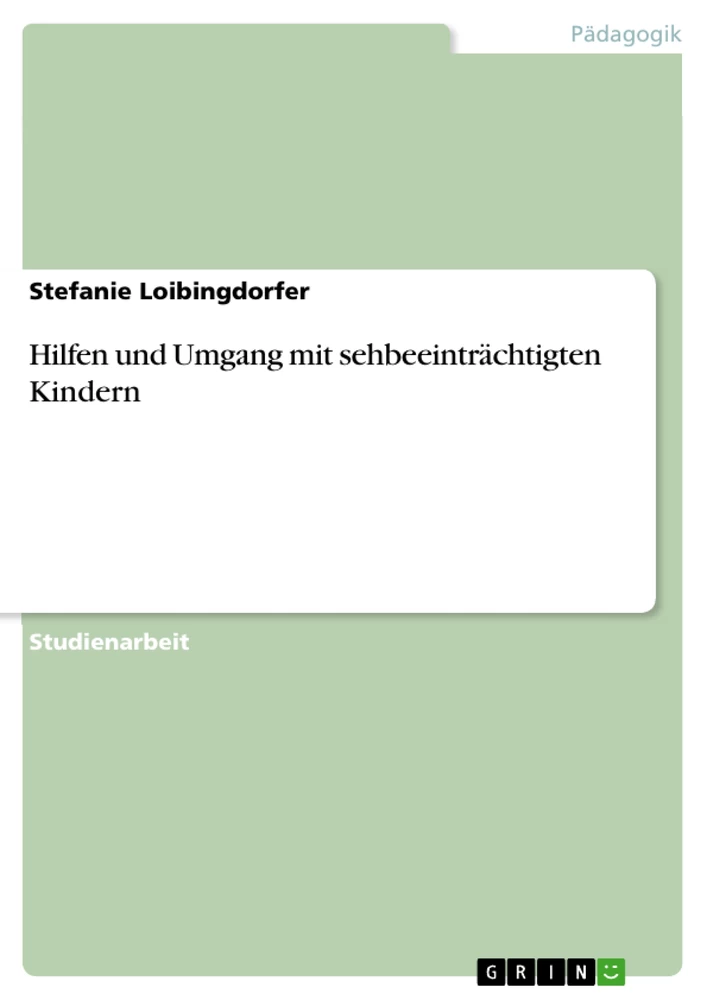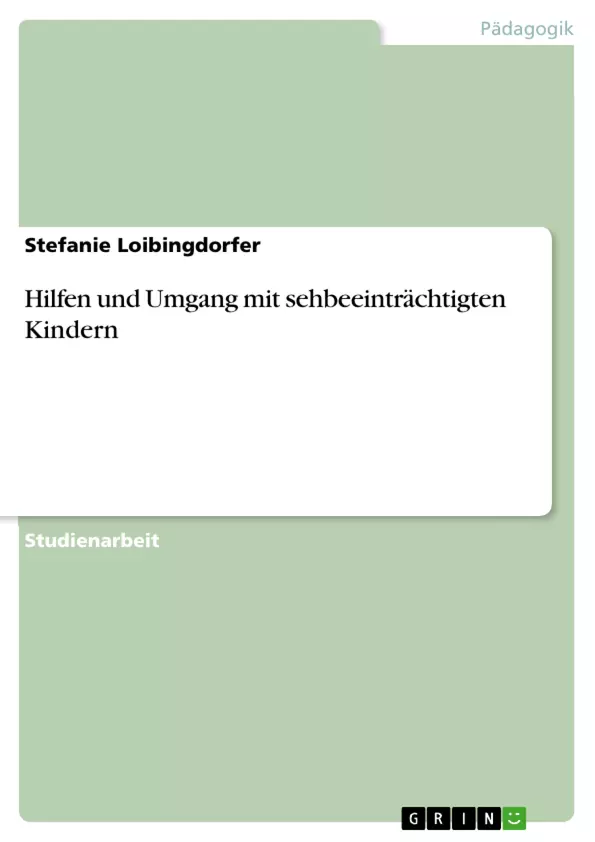In dieser Arbeit werden grundlegende Informationen zu Sehbeeinträchtigungen bei Kindern gegeben. Weiters wird explizit auf diverse Entwicklungsbereiche eingegangen, die sich von jenen normal sehender Kinder unterscheiden. Außerdem werden zahlreiche Möglichkeiten angeführt, die das Leben mit einer Sehbeeinträchtigung erleichtern, sowie pädagogische Hilfestellungen beleuchtet.
Fast vier Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher sind laut einer 2008 erhobenen Statistik von einer Form der Sehbeeinträchtigung betroffen, das sind circa 318 000 Personen (vgl. Hietzinger o.J.). Im Bereich der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in Österreich wird die Zahl der Betroffenen in Bezug auf Sehbeeinträchtigungen auf 0,1 % geschätzt (vgl. Bernitzke und Tupi 2015).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeines über Sehbeeinträchtigungen
- 1.1 Was ist eine Sehbeeinträchtigung?
- 1.2 Häufigkeit in Österreich
- 1.3 Ursachen
- 1.4 Merkmale zur Erkennung von Sehbeeinträchtigungen bei Kindern
- 2. Entwicklungsauffälligkeiten bei sehbeeinträchtigen Kindern
- 2.1 Grobmotorische Entwicklung
- 2.2 Sprachliche Entwicklung
- 2.3 Auswirkungen einer Sehbeeinträchtigung auf das kindliche Spiel
- 3. Hilfen und Umgang mit sehbeeinträchtigten Kindern
- 3.1 Pädagogische Hilfen
- 3.2 Optische Hilfen
- 3.3 Taktile Hilfen
- 3.4 Akustische und sonstige Hilfen
- 3.5 Medizinische Hilfen
- 3.6 Schulische Hilfen und Konzepte
- 4. Resümee
- 5. Persönliche Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Umgang mit sehbeeinträchtigten Kindern. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen Aspekte von Sehbeeinträchtigungen im Kindesalter zu entwickeln, von der Definition und Häufigkeit bis hin zu den Auswirkungen auf die Entwicklung und den notwendigen Hilfestellungen.
- Definition und Klassifizierung von Sehbeeinträchtigungen
- Auswirkungen auf die Entwicklung (motorisch, sprachlich, spielerisch)
- Pädagogische, optische, taktile und akustische Hilfen
- Medizinische und schulische Unterstützungsmöglichkeiten
- Herausforderungen und Chancen im Umgang mit sehbeeinträchtigten Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemeines über Sehbeeinträchtigungen: Dieses Kapitel definiert Sehbeeinträchtigungen, differenziert zwischen Blindheit und verschiedenen Graden der Sehbehinderung anhand der Sehschärfe. Es beleuchtet die Häufigkeit in Österreich, differenziert die Ursachen in vererbbare, unfallbedingte und krankheitsbedingte Faktoren (pränatal, perinatal, postnatal) und beschreibt erkennbare Merkmale bei Kindern, die auf eine Sehbeeinträchtigung hindeuten können. Die Definition der Sehbeeinträchtigung nach Bernitzke und Tupi (2015) bildet den zentralen Ausgangspunkt. Die detaillierte Darstellung der Ursachen verdeutlicht die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit einer frühzeitigen Diagnose.
2. Entwicklungsauffälligkeiten bei sehbeeinträchtigen Kindern: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen von Sehbeeinträchtigungen auf die kindliche Entwicklung. Es beleuchtet Beeinträchtigungen der grobmotorischen Entwicklung, die sich in Stolpern, unsicherem Gang und Schwierigkeiten im Umgang mit der räumlichen Umgebung zeigen können. Die sprachliche Entwicklung kann ebenfalls betroffen sein, da die visuelle Wahrnehmung für den Spracherwerb essentiell ist. Schließlich wird der Einfluss auf das kindliche Spielverhalten untersucht, wobei die Notwendigkeit von angepassten Spielmaterialien und Spielformen hervorgehoben wird. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der spezifischen Herausforderungen, denen sehbeeinträchtigte Kinder in den verschiedenen Entwicklungsbereichen gegenüberstehen.
3. Hilfen und Umgang mit sehbeeinträchtigten Kindern: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die verschiedenen Hilfestellungen für sehbeeinträchtigte Kinder. Es werden pädagogische Maßnahmen, wie individuelle Lernmethoden und die Nutzung alternativer Medien, detailliert beschrieben. Der Überblick über optische, taktile, akustische und sonstige Hilfsmittel zeigt die Bandbreite der verfügbaren Unterstützungsmöglichkeiten auf. Die Bedeutung medizinischer und schulischer Hilfen wird ebenfalls hervorgehoben, inklusive der Vorstellung verschiedener Konzepte für inklusive Bildung. Die Zusammenfassung betont die Interdisziplinarität des Ansatzes und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Unterstützung.
Schlüsselwörter
Sehbeeinträchtigung, Blindheit, Sehbehinderung, Entwicklungsauffälligkeiten, Pädagogische Hilfen, Optische Hilfen, Taktile Hilfen, Akustische Hilfen, Inklusive Bildung, Österreich
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Umgang mit sehbeeinträchtigten Kindern
Was ist der allgemeine Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Sehbeeinträchtigungen bei Kindern. Sie behandelt Definitionen, Häufigkeit in Österreich, Ursachen, Auswirkungen auf die Entwicklung (grobmotorisch, sprachlich, spielerisch), sowie verschiedene Arten von Hilfestellungen (pädagogisch, optisch, taktil, akustisch, medizinisch und schulisch).
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Allgemeines über Sehbeeinträchtigungen; 2. Entwicklungsauffälligkeiten bei sehbeeinträchtigen Kindern; 3. Hilfen und Umgang mit sehbeeinträchtigten Kindern; 4. Resümee; 5. Persönliche Stellungnahme. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeschlüsselt.
Wie werden Sehbeeinträchtigungen in der Arbeit definiert und klassifiziert?
Die Arbeit definiert Sehbeeinträchtigungen und differenziert zwischen Blindheit und verschiedenen Graden der Sehbehinderung anhand der Sehschärfe. Die Definition von Bernitzke und Tupi (2015) dient als zentraler Ausgangspunkt. Die Klassifizierung berücksichtigt verschiedene Schweregrade der Sehbeeinträchtigung.
Welche Ursachen für Sehbeeinträchtigungen werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen vererbbaren, unfallbedingten und krankheitsbedingten Ursachen (pränatal, perinatal, postnatal) von Sehbeeinträchtigungen.
Welche Auswirkungen haben Sehbeeinträchtigungen auf die kindliche Entwicklung?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen auf die grobmotorische Entwicklung (z.B. Stolpern, unsicherer Gang), die sprachliche Entwicklung (visuelle Wahrnehmung ist essentiell für den Spracherwerb) und das kindliche Spielverhalten (Notwendigkeit angepasster Spielmaterialien und Spielformen).
Welche Arten von Hilfen werden für sehbeeinträchtigte Kinder vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt pädagogische Maßnahmen (individuelle Lernmethoden, alternative Medien), optische, taktile, akustische und sonstige Hilfsmittel. Sie betont außerdem die Bedeutung medizinischer und schulischer Hilfen und inklusive Bildungskonzepte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sehbeeinträchtigung, Blindheit, Sehbehinderung, Entwicklungsauffälligkeiten, Pädagogische Hilfen, Optische Hilfen, Taktile Hilfen, Akustische Hilfen, Inklusive Bildung, Österreich.
Was ist die Zielsetzung der Seminararbeit?
Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen Aspekte von Sehbeeinträchtigungen im Kindesalter zu entwickeln. Dies umfasst die Definition und Häufigkeit, die Auswirkungen auf die Entwicklung und die notwendigen Hilfestellungen.
Wie werden die Kapitel der Seminararbeit zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel fasst die wichtigsten Inhalte jedes Kapitels prägnant zusammen und hebt die Kernaussagen hervor. Sie bietet einen schnellen Überblick über den gesamten Inhalt der Arbeit.
- Quote paper
- Stefanie Loibingdorfer (Author), 2016, Hilfen und Umgang mit sehbeeinträchtigten Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371280