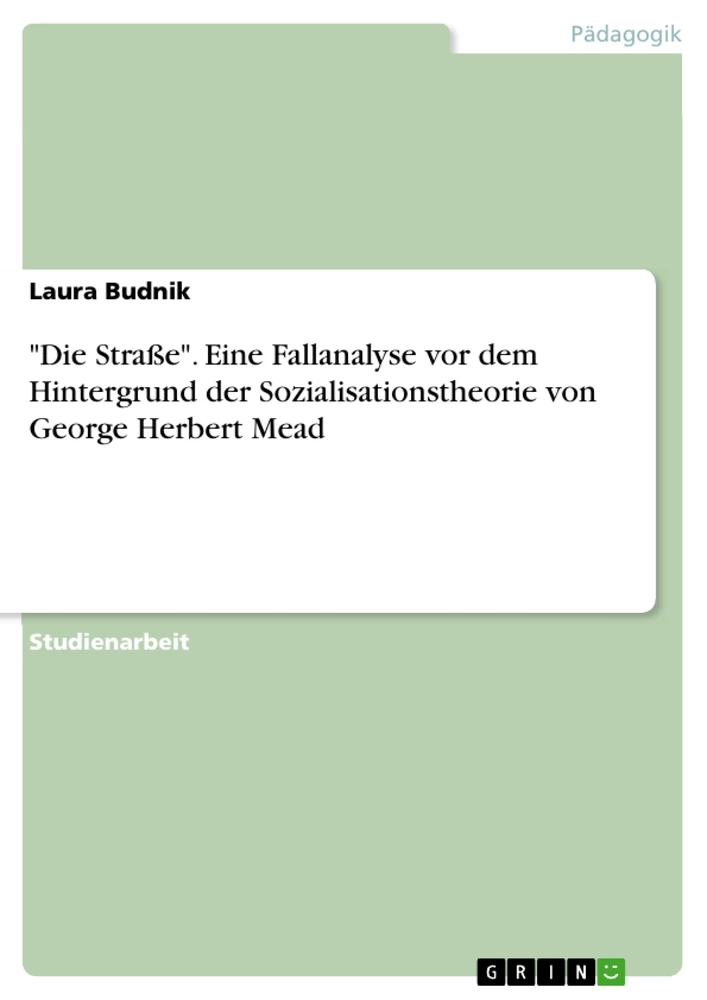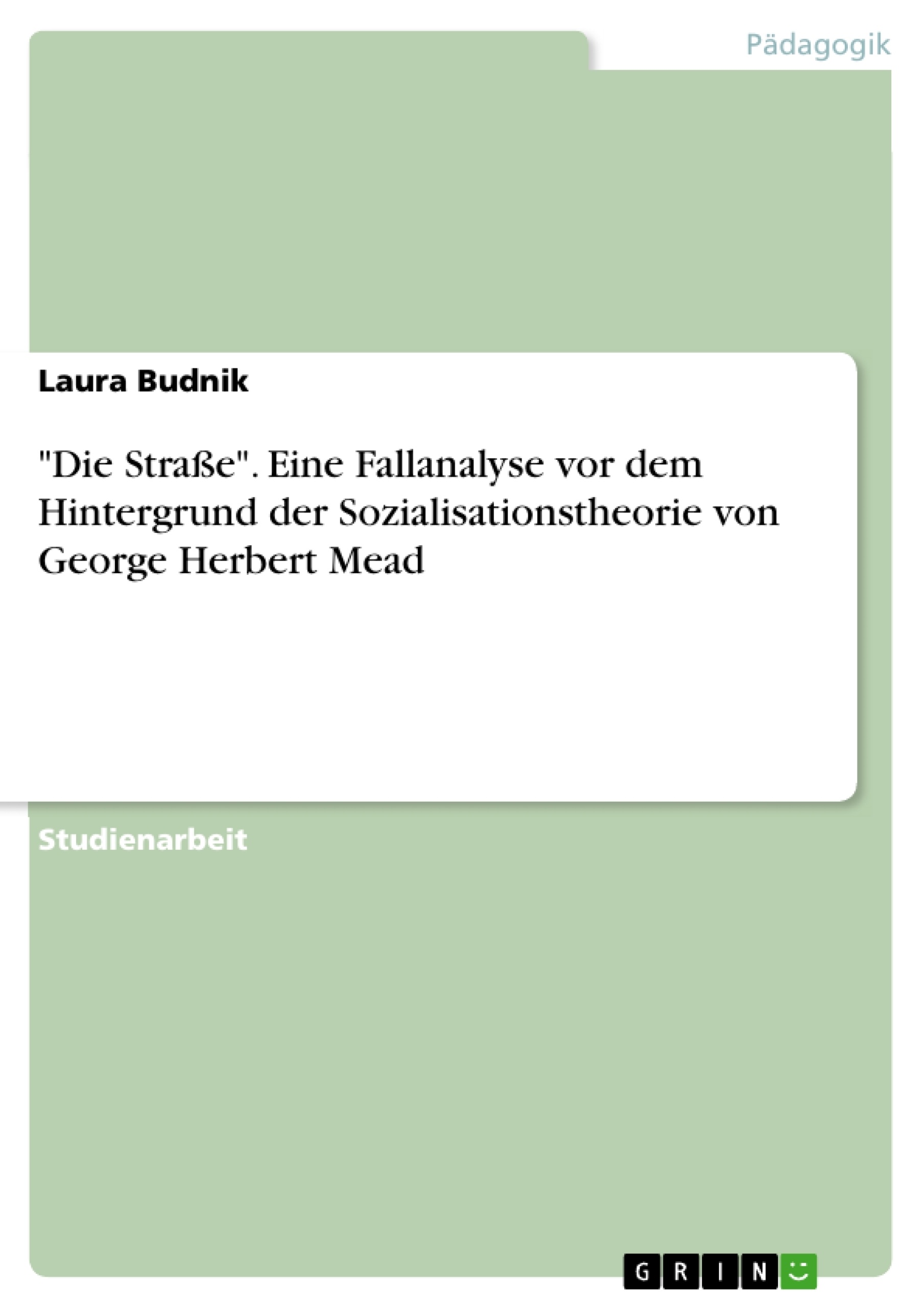Der Fokus dieser Analyse liegt auf einem Abschnitt im letzten Drittel des Werkes "Die Straße", der eine der Schlüsselszenen des Romanes darstellt. Die Beziehung zwischen den beiden Hauptprotagonisten, Vater und Sohn, soll im Laufe der Arbeit näher beleuchtet werden, sowie die Veränderungen und Wechselwirkungen dieser in der Szene selbst.
Im Mittelpunkt der Betrachtung, steht dabei vor allem die Frage nach der adäquaten Entwicklung der Individualität des Sohnes vor dem Hintergrund der Mead’schen Sozialisationstheorie, sowie den Einfluss des Vaters auf denselbigen.
Um diese Fragen beantworten zu können, wird zu Beginn der Arbeit zunächst die Sozialisationstheorie von George Herbert Mead näher ausgeführt und differenziert beschrieben. Daraufhin folgt zum besseren Verständnis der Fallsituation ein bündiger Abriss des Buches sowie eine kurze Vorstellung der Protagonisten. Anschließend werden zentrale Momente der Szene ausgewählt und vor dem Hintergrund der genannten Sozialisationstheorie näher betrachtet und analysiert. Hierbei wird versucht, auf die anfangs gestellten Fragen, mögliche Antworten oder Hypothesen zu finden und diese zu begründen. Den Abschluss bildet danach einerseits eine Darstellung der Möglichkeiten und Grenzen der vorgestellten Theorie, sowie ein kurzes Fazit, welches die zentralen Momente der Arbeit wiedergibt und die Ergebnisse zusammenfasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Sozialisationstheorie von G. H. Mead
- „Doch das bin ich“ - Analytischer Teil
- Einbettung des Falls
- Szene aus „Die Straße“
- Analyse
- Möglichkeiten und Grenzen der Theorie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Beziehung zwischen Vater und Sohn im Roman „Die Straße“ von Cormac McCarthy vor dem Hintergrund der Sozialisationstheorie von George Herbert Mead. Ziel ist es, die Entwicklung der Individualität des Sohnes im Kontext der postapokalyptischen Welt zu untersuchen und den Einfluss des Vaters auf diese Entwicklung zu beleuchten.
- Entwicklung der Individualität in einer postapokalyptischen Welt
- Einfluss des Vaters auf die Sozialisation des Sohnes
- Bedeutung der Sprache und des Symbolsystems in der Sozialisation
- Möglichkeiten und Grenzen der Theorie von George Herbert Mead
- Die Beziehung zwischen „I“ und „Me“ im Kontext der Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und erläutert den wissenschaftlichen Kontext sowie die Relevanz der gewählten Themen. Das zweite Kapitel widmet sich der Sozialisationstheorie von George Herbert Mead und beleuchtet zentrale Elemente wie die Rolle der Sprache, des Spiels und des verallgemeinerten Anderen in der Entwicklung der menschlichen Identität. Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse einer konkreten Szene aus dem Roman „Die Straße“ und betrachtet die Interaktion zwischen Vater und Sohn vor dem Hintergrund der Meadschen Sozialisationstheorie. Es wird untersucht, welche Momente der Szene exemplarisch für die Entwicklung der Individualität des Sohnes sind und wie der Vater diese Entwicklung beeinflusst. Im vierten Kapitel werden die Möglichkeiten und Grenzen der Sozialisationstheorie von George Herbert Mead im Kontext der Analyse diskutiert. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse heraus.
Schlüsselwörter
Sozialisationstheorie, George Herbert Mead, Symbolischer Interaktionismus, „Die Straße“, Cormac McCarthy, Vater-Sohn-Beziehung, postapokalyptische Welt, Identität, „I“, „Me“, Sprache, Spiel, verallgemeinerter Anderer.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Cormac McCarthys "Die Straße"?
Der Roman beschreibt die Reise eines Vaters und seines Sohnes durch eine postapokalyptische, zerstörte Welt.
Was besagt die Sozialisationstheorie von George Herbert Mead?
Mead erklärt die Identitätsbildung durch soziale Interaktion und die Unterscheidung zwischen dem impulsiven "I" und dem gesellschaftlich geprägten "Me".
Wie entwickelt der Sohn im Roman seine Individualität?
Die Arbeit analysiert, wie der Sohn trotz der lebensfeindlichen Umwelt durch die Interaktion mit dem Vater ein moralisches Bewusstsein und eine Identität entwickelt.
Was ist der "verallgemeinerte Andere"?
Ein Konzept von Mead, das die Übernahme der Erwartungen der gesamten Gesellschaft beschreibt – eine Herausforderung in einer Welt, in der die Gesellschaft kaum noch existiert.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Analyse?
Sprache ist laut Mead das zentrale Symbolsystem für die Sozialisation; im Roman dient sie dem Erhalt der Menschlichkeit unter extremen Bedingungen.
- Arbeit zitieren
- Laura Budnik (Autor:in), 2017, "Die Straße". Eine Fallanalyse vor dem Hintergrund der Sozialisationstheorie von George Herbert Mead, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371492