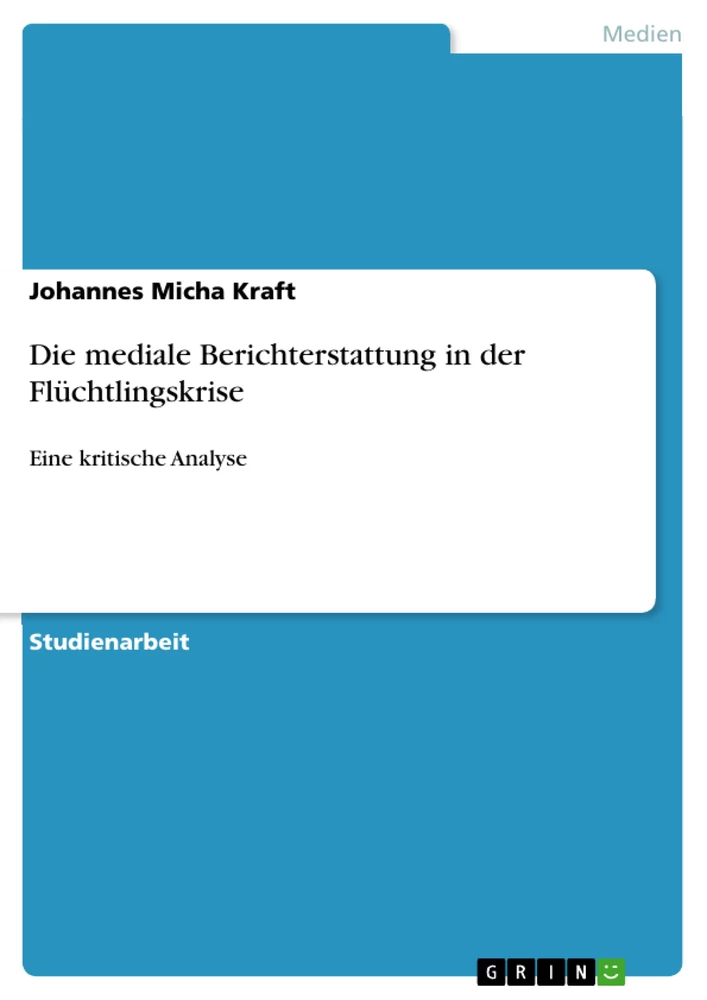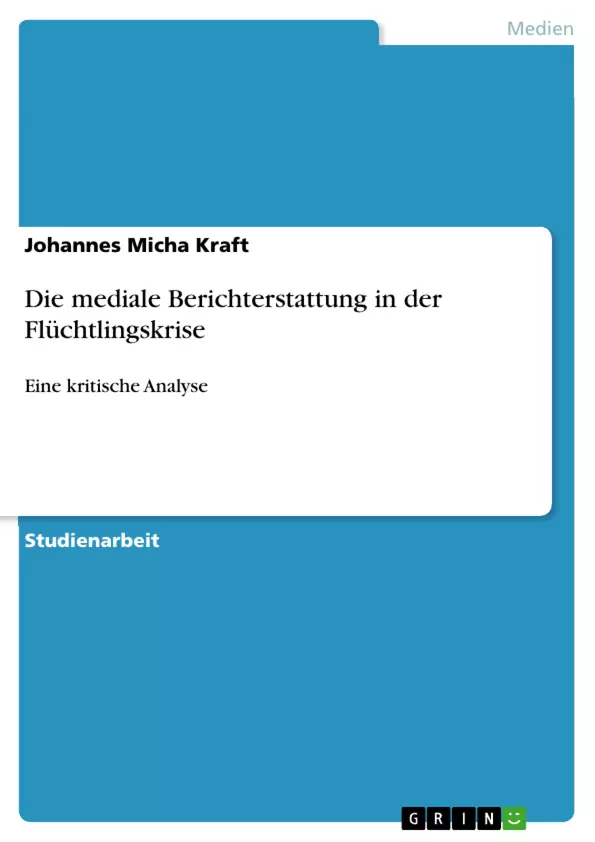Seit vielen Jahrzehnten ist die Europäische Union betroffen von krisenbedingten Migrationsbewegungen. Die größten Bewegungen unseres Jahrhunderts fanden bisher in den Jahren 2015 und 2016 statt. Das Thema Migration und deren Ursachen bestimmen quantitativ die Themen der deutschen Medienlandschaft. Zu sehen sind Bilder von Menschenmassen, welche europäische Grenzen passieren, untergehende und überfüllte Boote an Europäischen Seegrenzen, sowie frierende Menschen vor Flüchtlingsunterkünften und Erstaufnahmestellen. Diese Bilder und Berichterstattungen weckten Mitgefühl, Ängste und Reaktionen bei den Rezipienten aus.
In dieser Arbeit werden die relevanten Berichterstattungen nach latenten medialen Narrativen untersucht. Dabei geht sie der Frage nach, ob solche Narrative tatsächlich in der Berichterstattung Einzug fanden und inwiefern die Wahrnehmung der Rezipienten über ihre Lebensrealität verzerrt werden kann. Hierfür wird das Konzept des 'Framings' herangezogen, um so signifikante Berichterstattungen zu analysieren. Die Analyse beschränkt sich auf zwei Artikel der deutschen Medienhäuser Spiegel und Focus. Dabei geht es um die Flüchtlingsbewegungen vor der italienischen Insel Lampedusa. Hierfür werden im empirischen Teil einerseits die im Artikel verwendeten Bilder und Videos, sowie andererseits problematische Begriffe und Phrasen im Text, analysiert. Vorgegangen wird mit einem Methodenmix aus Makro-Mikro-Methode (vom Allgemeinen ins Spezielle), sowie mit einer Inhaltsanalyse auf Basis des Framing-Konzeptes der Kommunikationswissenschaft. Die kritisch-analytischen-Methode zur Analyse des empirischen Materials (kritische, objektive, systematische Untersuchung des Korpus) wird zudem angewendet.
Als Literaturbasis des theoretischen Teils wurde auf Hoffmanns 'Das Märchen vom überkochenden Brei', sowie auf Scheufeles 'Journalismus und Framing' zurückgegriffen. Für den empirischen Teil wurden zwei Texte von Matthias Thiele herangezogen. Thiele beschreibt die aktuellen Probleme zwischen Flüchtlingsbewegungen und Journalismus treffend und wissenschaftlich. Die ausgewählten Quellen decken einen Bereich des aktuellen Wissenschaftsdiskurses ab und bilden einen adäquaten Rahmen für diese Arbeit. Im theoretischen Teil wird nun mit der grundlegenden Beschreibung von Narrativen in der medialen Berichterstattung über die Flüchtlingsbewegungen in Europa fortgefahren.
Inhaltsverzeichnis
- Exposé
- Theoretischer Teil
- Narrative in der medialen Berichterstattung
- Journalistisches Framing
- Empirischer Teil
- Bootsunglücke von Lampedusa - Bilder und dessen Symbolwert
- Symbolisch Narrative Schemata
- Resumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die mediale Berichterstattung über die Flüchtlingskrise und untersucht, ob und inwiefern latente Narrative in der Berichterstattung Einzug gefunden haben, welche die Wahrnehmung der Rezipienten über ihre Lebensrealität verzerrt haben könnten. Dabei wird das Konzept des Framings verwendet, um zwei Artikel des Spiegels und des Focus zu analysieren, die sich mit Flüchtlingsbewegungen vor der italienischen Insel Lampedusa befassen.
- Analyse von Narrativen in der medialen Berichterstattung über die Flüchtlingskrise
- Untersuchung des Einflusses von Framing auf die Wahrnehmung der Rezipienten
- Kritische Analyse von Bildern und Texten in zwei Artikeln des Spiegels und des Focus
- Beurteilung des symbolischen Werts von Bildern in Bezug auf die Berichterstattung über Bootsunglücke
- Identifizierung problematischer Begriffe und Phrasen im Text
Zusammenfassung der Kapitel
Das Exposé führt in die Thematik der medialen Berichterstattung über die Flüchtlingskrise ein und skizziert die Forschungsfrage und die Methode der Arbeit. Im theoretischen Teil wird zunächst der Begriff des Narrativs im Kontext der medialen Berichterstattung erläutert. Dabei wird auf die Arbeit von Herrmann Friederike zurückgegriffen, die beschreibt, wie Narrative in der medialen Berichterstattung über die Flüchtlingskrise zur Kreation von Gefühlen der Überforderung und Ohnmacht beitragen können. Im Anschluss wird das Konzept des Journalistischen Framings vorgestellt und dessen Bedeutung für die Analyse der medialen Berichterstattung erläutert.
Schlüsselwörter
Flüchtlingskrise, mediale Berichterstattung, Narrative, Framing, Symbolwert, Bilder, Textanalyse, Rezeption, Lebensrealität, Überforderung, Ohnmacht, Flüchtlingsbewegungen, Lampedusa, Spiegel, Focus.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Arbeit zur medialen Berichterstattung in der Flüchtlingskrise?
Die Arbeit analysiert latente mediale Narrative und das Konzept des "Framings", um zu prüfen, wie die Wahrnehmung der Flüchtlingskrise durch Medien verzerrt werden kann.
Was bedeutet "Framing" in der Kommunikationswissenschaft?
Framing bezeichnet den Prozess, bei dem Medien bestimmte Aspekte einer Realität hervorheben und andere ausblenden, um eine spezifische Interpretation oder Problemdefinition nahezulegen.
Welche Medien wurden für die Analyse ausgewählt?
Die empirische Analyse beschränkt sich auf zwei Artikel der deutschen Medienhäuser "Spiegel" und "Focus", die über die Flüchtlingsbewegungen vor Lampedusa berichteten.
Welchen Symbolwert haben die Bilder von Lampedusa?
Bilder von überfüllten Booten und Rettungsaktionen fungieren als starke Symbole, die beim Rezipienten Gefühle wie Mitgefühl, aber auch Ängste und Überforderung auslösen können.
Welche problematischen Begriffe werden im Text analysiert?
Die Arbeit untersucht Phrasen und Begriffe, die Narrative der "Bedrohung" oder "Naturkatastrophe" (z.B. Flüchtlingsstrom) unterstützen und so die Realitätswahrnehmung beeinflussen.
Welche Methoden wurden für die Untersuchung angewendet?
Es wurde ein Methodenmix aus Inhaltsanalyse, der Makro-Mikro-Methode sowie einer kritisch-analytischen Untersuchung des empirischen Materials verwendet.
- Quote paper
- Johannes Micha Kraft (Author), 2017, Die mediale Berichterstattung in der Flüchtlingskrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371534