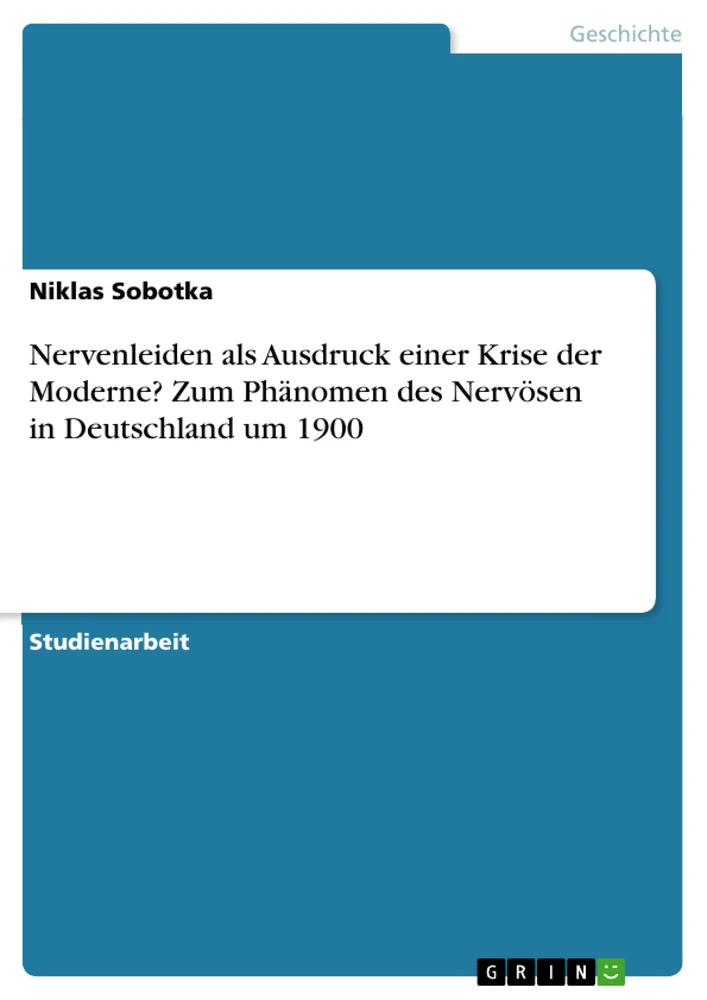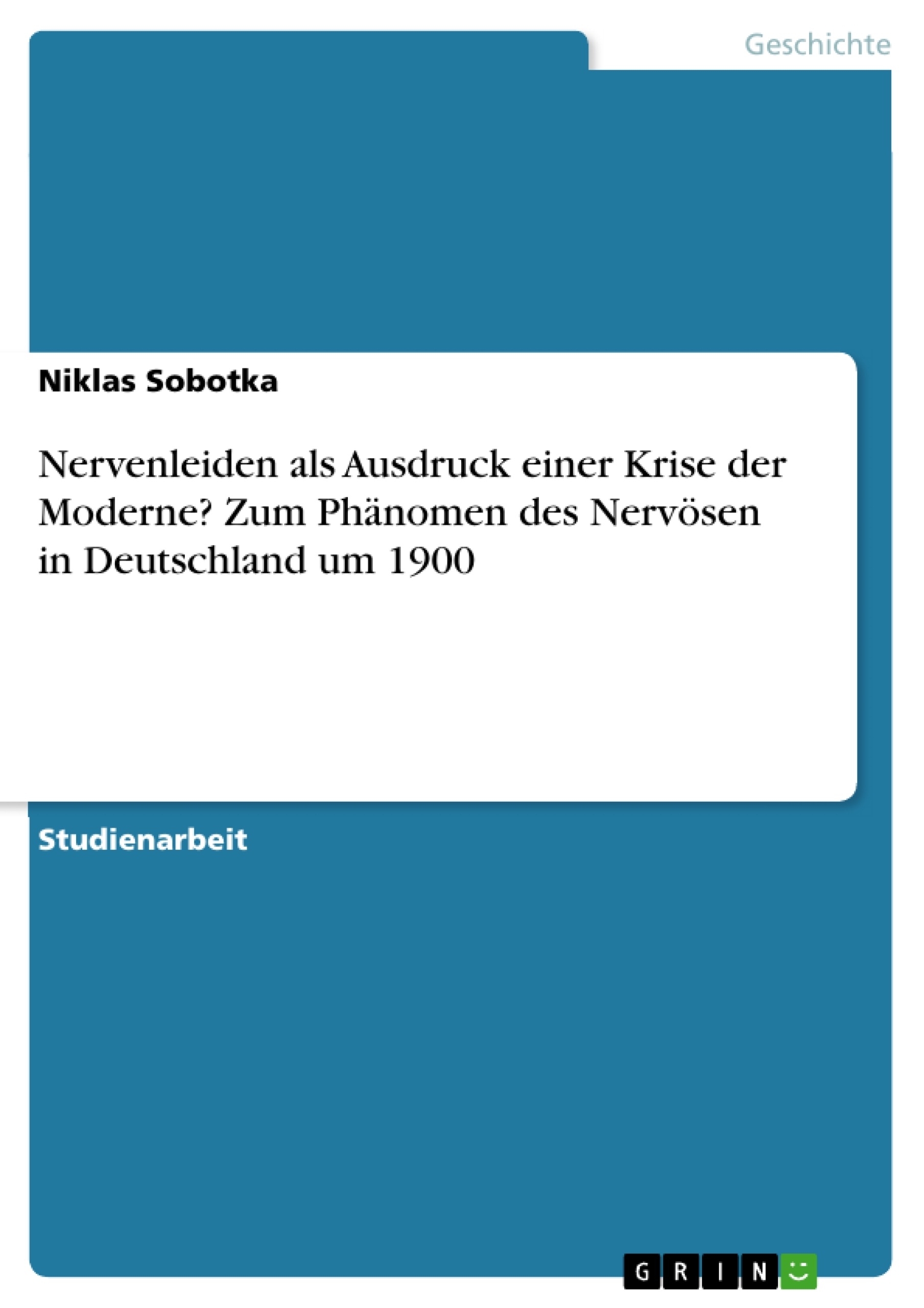Die Arbeit gibt einen Überblick sowohl über die Neurasthenie als Krankheitsbild als auch einen Einblick in die für die Alltagserfahrung jener Zeit paradigmatische Erfahrung einer allgemein empfundenen Nervosität. Was damals schon Realität war, kann in vielen Dingen auch für heute gelten.
Es war der New Yorker Nervenarzt George Miller Beard (1839-1883), der erstmals 1880 von einer allgemeinen Nervenschwäche sprach, die im Amerika seiner Zeit überall hervorbreche. Sein Konzept der Neurasthenie machte ihn berühmt und gelangte auch ins Deutsche Reich, wo viele Ärzte ähnliche Beobachtungen machten. Die Neurasthenie wurde zur Mode und für Viele war sie Sinnbild eines Kulturzustandes, der, bedingt durch Beschleunigung, Technik, Lärm und Reizüberflutung, allenthalben krisenhaft war und zugleich faszinierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Vorgehensweise und Fragestellung
- 1. Die Neurasthenie (Nervenschwäche) als unspezifisches Krankheitsbild
- 1.1 Vom Werden einer konstruierten Krankheit. Leidensdruck, Leidenserfahrung und Selbstvergewisserung
- 1.2 Die akute Neurasthenie
- 1.3 Die chronische Neurasthenie
- 2. Nervosität als ein Zeitgeist der Moderne
- 2.1 Allgemeines zur modernen Nervosität
- 2.2 Neue Erfahrungen, neues Bewusstsein: Tempo, Technik, Lärm und Reizüberflutung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen der Nervosität im Deutschland um 1900 und betrachtet die Neurasthenie als Ausdruck einer möglichen Krise der Moderne. Dabei wird die Relevanz der Nervosität für verschiedene gesellschaftliche Schichten beleuchtet, sowie die Ambivalenz ihrer Bewertung als Ausdruck des Fortschritts und gleichzeitig als Zeichen von Ängsten und Unsicherheiten.
- Die Neurasthenie als unspezifisches Krankheitsbild und ihre Entwicklung im Kontext der Moderne
- Die Rolle der Nervosität als Zeitgeist der Moderne und ihre Ursachen in den neuen Erfahrungen von Tempo, Technik und Reizüberflutung
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf Nervosität und Neurasthenie, von medizinischen Ansätzen bis hin zu gesellschaftlichen Diskursen
- Die Ambivalenz der Moderne und die Rolle der Neurasthenie als Artikulation eines Zeitgeistes
- Die Bedeutung der Nervosität in der wilhelminischen Epoche und ihr Verhältnis zu den Innovationen und Herausforderungen der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt den Forschungsansatz sowie die Fragestellung. Kapitel 1 konzentriert sich auf die Neurasthenie als unspezifisches Krankheitsbild. Es beleuchtet die Entstehung der "konstruierten Krankheit" im Kontext des Nervendiskurses und der gesellschaftlichen Relevanz des Phänomens. Kapitel 2 befasst sich mit der Nervosität als Zeitgeist der Moderne. Es untersucht die Ursachen der Nervosität in den neuen Erfahrungen von Tempo, Technik und Reizüberflutung und zeigt, wie sich das Verständnis des Nervösen im Laufe der Zeit gewandelt hat.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Neurasthenie, Nervosität, Moderne, wilhelminische Epoche, Zeitgeist, Reizüberflutung, Technik, Fortschritt, Ambivalenz, Krankheit, Kulturgeschichte, Gesellschaft, Leidenserfahrung, Selbstvergewisserung, .
Häufig gestellte Fragen
Was war die Neurasthenie um 1900 in Deutschland?
Die Neurasthenie, auch Nervenschwäche genannt, war ein unspezifisches Krankheitsbild, das um 1900 als Ausdruck einer Krise der Moderne und des Zeitgeistes galt.
Wer prägte den Begriff der Neurasthenie?
Der New Yorker Nervenarzt George Miller Beard sprach 1880 erstmals von dieser allgemeinen Nervenschwäche, woraufhin das Konzept auch im Deutschen Reich populär wurde.
Welche Ursachen hatte die moderne Nervosität in dieser Epoche?
Als Hauptursachen galten die Beschleunigung des Lebens, technischer Fortschritt, Lärm und die allgemeine Reizüberflutung in der wilhelminischen Zeit.
Warum wurde die Krankheit als "konstruiert" bezeichnet?
Die Arbeit beleuchtet die Neurasthenie als ein Phänomen, das im Kontext gesellschaftlicher Diskurse und medizinischer Beobachtungen als Krankheitsbild geformt wurde.
Was unterscheidet akute von chronischer Neurasthenie?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Verlaufsformen der Krankheit, um die individuelle Leidenserfahrung der Patienten zu analysieren.
- Quote paper
- Niklas Sobotka (Author), 2013, Nervenleiden als Ausdruck einer Krise der Moderne? Zum Phänomen des Nervösen in Deutschland um 1900, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371749