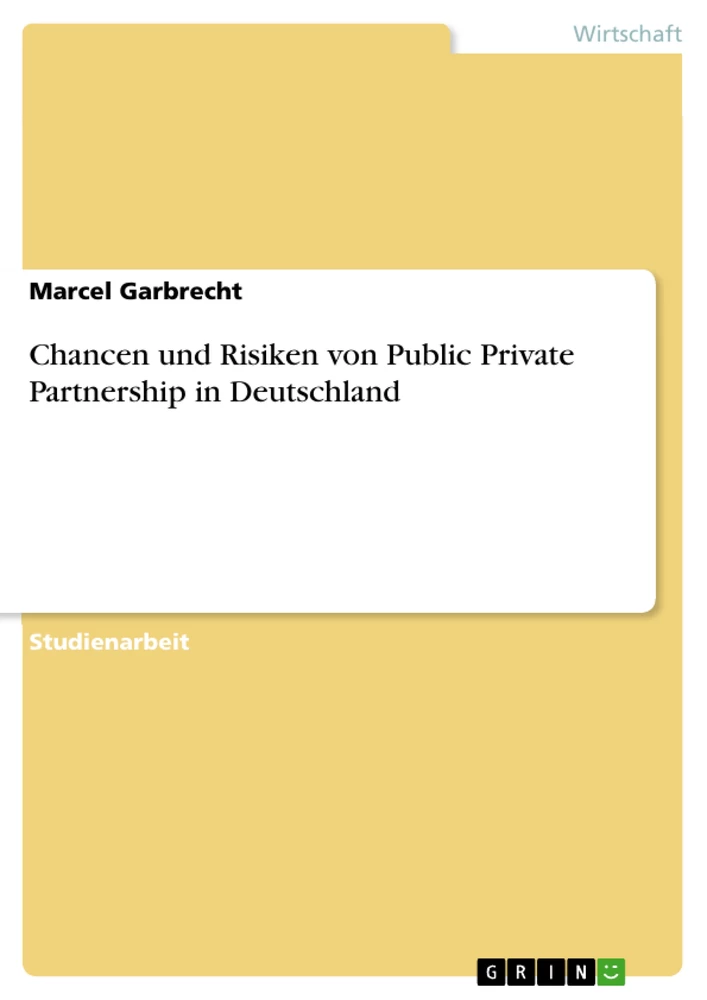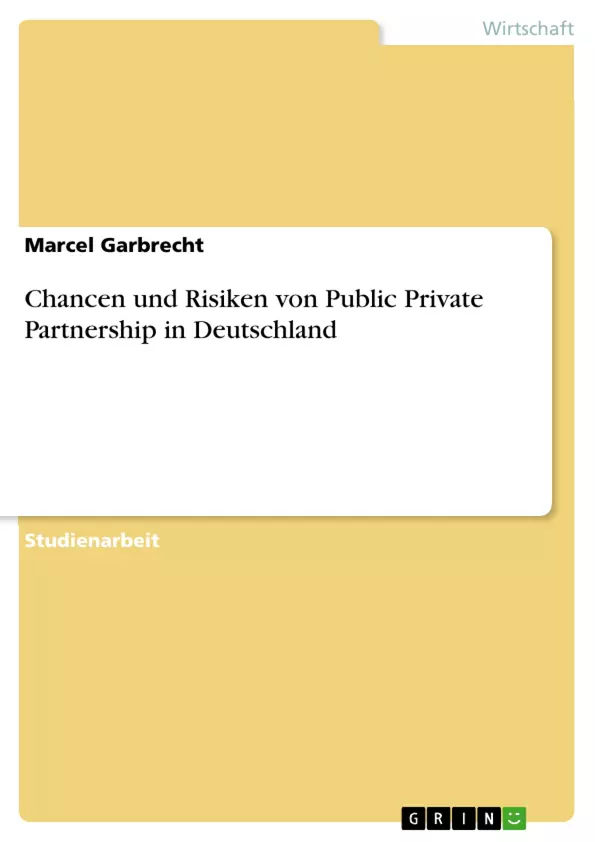Die Meinungen zum Nutzen von Public Private Partnership (PPP) sind sehr kontrovers und zwiespältig. Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit soll das Modell PPP vorgestellt und im Anschluss die Chancen und Risiken der Zusammenarbeit skizziert werden. Der erste Teil widmet sich der Annäherung an den Begriff, damit dieser einzugrenzen ist. Anschließend soll zwischen den beiden Grundformen von PPP differenziert und Motive für eine Zusammenarbeit aus privater bzw. öffentlicher Sicht dargestellt werden. Nachdem die thematischen Grundlagen vermittelt wurden, soll darauf folgend der aktuelle PPP Ist-Zustand in Deutschland skizziert werden. Der letzte Teil dieser Arbeit widmet sich der Darstellung von Chancen und Risiken von PPP aus staatlicher Sicht.
Die Arbeit soll mit einer kritischen Rückschau auf die in dieser Ausarbeitung thematisierten Inhalte enden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- AUSGANGSSITUATION
- ZIEL DER HAUSARBEIT
- METHODISCHES VORGEHEN
- DEFINITION DES BEGRIFFS PPP
- PPP-TYPEN
- VERTRAGS PPP
- INSTITUTIONELLE PPP
- MOTIVE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT
- MOTIVE AUS ÖFFENTLICHER SICHT
- MOTIVE AUS PRIVATER SICHT
- PPP IN DEUTSCHLAND
- CHANCEN UND RISIKEN VON PPP
- CHANCEN VON PPP
- RISIKEN VON PPP
- FAZIT
- QUELLEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Modell der Public Private Partnership (PPP) in Deutschland und untersucht die Chancen und Risiken, die diese Form der Zusammenarbeit für öffentliche Projekte bietet.
- Definition und Typologie von PPP
- Motive für PPP aus öffentlicher und privater Sicht
- Aktuelle Situation von PPP in Deutschland
- Chancen und Risiken von PPP im Kontext öffentlicher Projekte
- Kritische Betrachtung der diskutierten Inhalte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der PPP ein und erläutert die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen im öffentlichen Sektor. Das erste Kapitel definiert den Begriff PPP und beschreibt die unterschiedlichen Typen von PPP, insbesondere die Vertrags- und die institutionelle PPP. Im zweiten Kapitel werden die Motive für eine Zusammenarbeit zwischen Staat und privaten Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der aktuellen Situation von PPP in Deutschland. Es werden die Besonderheiten des deutschen PPP-Modells sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für PPP Projekte dargestellt. Der letzte Teil der Arbeit widmet sich der Analyse der Chancen und Risiken von PPP aus staatlicher Sicht. Es werden sowohl die Vorteile von PPP, wie beispielsweise die Möglichkeit zur Kostensenkung und zur Effizienzsteigerung, als auch die potenziellen Risiken, wie z.B. die Gefahr von finanzielle Risiken und die Gefahr einer mangelnden Kontrolle, erörtert.
Schlüsselwörter
Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP), Public Private Partnership (PPP), Vertrags-PPP, institutionelle PPP, Chancen, Risiken, Haushaltskonsolidierung, Kosteneinsparungen, Rechtliche Rahmenbedingungen, Deutschland, Staat, Private Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Public Private Partnership (PPP)?
PPP bezeichnet die langfristige Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und privaten Unternehmen zur Finanzierung und Umsetzung öffentlicher Projekte.
Was unterscheidet eine Vertrags-PPP von einer institutionellen PPP?
Eine Vertrags-PPP basiert auf rein schuldrechtlichen Verträgen, während bei einer institutionellen PPP eine gemeinsame Projektgesellschaft gegründet wird.
Warum entscheidet sich der Staat für PPP-Modelle?
Hauptmotive sind die Haushaltskonsolidierung, Kosteneinsparungen durch Effizienzgewinne der Privaten und die schnellere Realisierung von Infrastrukturprojekten.
Welche Risiken birgt PPP aus staatlicher Sicht?
Risiken sind mangelnde Kontrolle, langfristige finanzielle Bindungen, versteckte Kosten und die Gefahr, dass private Partner bei Insolvenz ausfallen.
Wie ist der aktuelle Stand von PPP in Deutschland?
Die Arbeit skizziert den Ist-Zustand und die rechtlichen Rahmenbedingungen, die PPP-Projekte in Deutschland regulieren und fördern.
- Quote paper
- Marcel Garbrecht (Author), 2017, Chancen und Risiken von Public Private Partnership in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371766