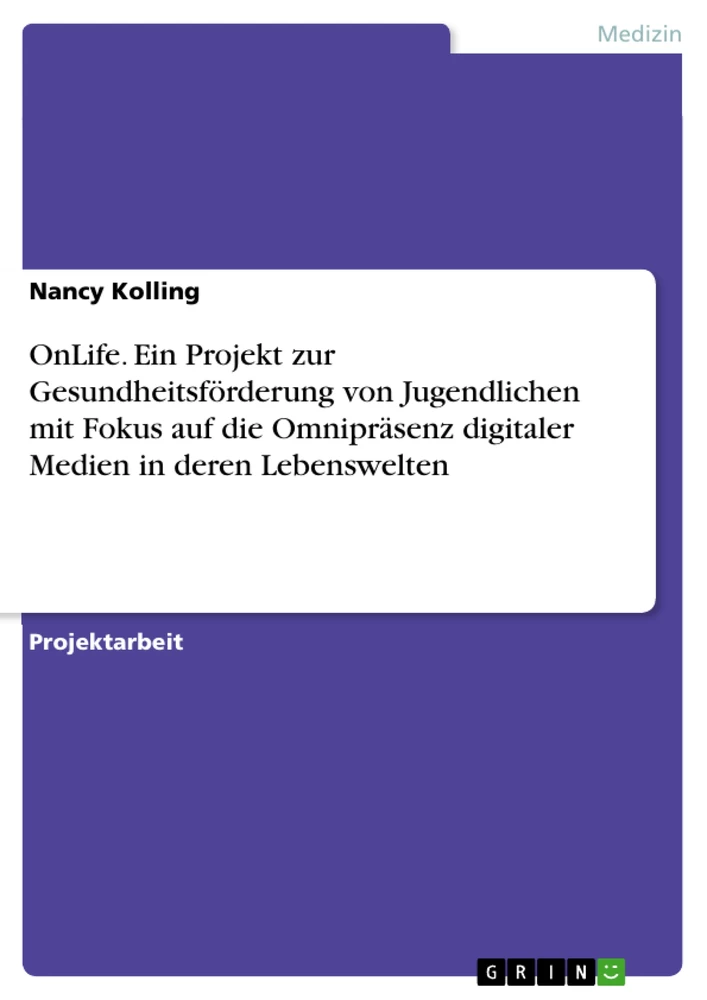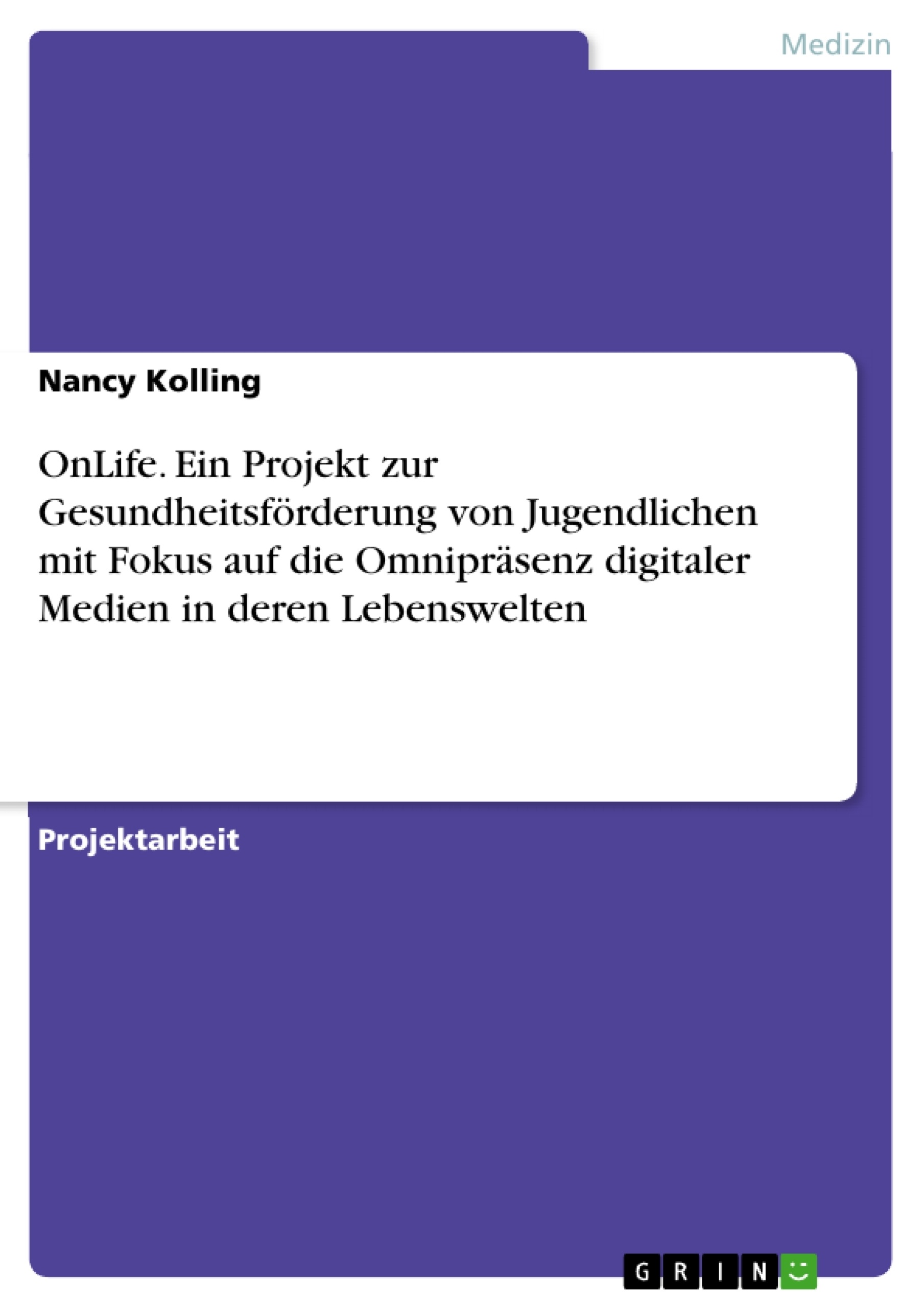In der vorliegenden Arbeit wird ein Projektkonzept beschrieben, welches sich mit dem Medien-Nutzungsverhalten von 12- bis 13-jährigen Schülern auseinandersetzt.
Im Mittelpunkt der gesundheitswissenschaftlichen Betrachtung stehen u. a. die gesundheitlichen Auswirkungen der Medien-Nutzung bei Jugendlichen im allgemeinen, die gesundheitspolitische Relevanz eines solches Projekts, der Stand der Forschung auf diesem Gebiet, mehrere Best Practice Beispiele, aber auch die theoretische Durchführung, eine denkbare Finanzierungs- und Zeitplanung sowie die Projekt-Evaluation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problembetrachtung
- Physische Belastungen
- Psychische Auswirkungen
- Entwicklung der Fragestellung
- In Bezug auf die Eltern und Lehrer
- In Bezug auf die Jugendlichen
- Thema und Ziele ....
- Kurzfristige Ziele..
- Mittelfristige Ziele.....
- Langfristige Ziele
- ,,SMART\"-Kriterien ....
- Gesundheitspolitische Relevanz
- Thematisierung in der Öffentlichkeit.
- Jugendschutz und Politik.
- Stand der Forschung und Entwicklung in der Praxis..
- Begriffsbestimmung …………………..
- Gesundheitsförderung und Setting-Ansatz.
- Der Ansatz der Gesundheitsaufklärung und Gesundheitserziehung.....
- Das Transtheoretische Modell
- Empirische Forschung....
- Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
- Studie,,Jugend 3.0 - abgetaucht nach Digitalien\"\n
- Best Practice Projekte.
- Projekt „Check the web\".
- Präventionstheater „Lauffeuer“
- Begriffsbestimmung …………………..
- Einschätzung der Realisierbarkeit und Strategien zur Akzeptanzsicherung ...
- Durchführung
- Planung und Initialisierung.
- Durchführung Teil 1 .....
- Durchführung Teil 2........
- Evaluation und Abschluss.
- Zeitplanung..
- Finanzierung.....
- Ressourcen und Kompetenzen
- Finanzielle Förderung........
- Kosten- und Finanzplan…........
- Evaluation .....
- Erwartbare Ergebnisse
- Übertragbarkeit.....………………….....
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Projekt zielt darauf ab, die gesundheitlichen Folgen der Internetnutzung bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 13 Jahren zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zur Gesundheitsförderung dieser Zielgruppe zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf der Omnipräsenz digitaler Medien, insbesondere mobiler Endgeräte, in der Lebenswelt von Jugendlichen.
- Analyse der physischen und psychischen Belastungen, die durch die excessive Nutzung digitaler Medien entstehen können.
- Entwicklung von Strategien zur Gesundheitsförderung von Jugendlichen, die den Herausforderungen der digitalen Welt gerecht werden.
- Einbezug relevanter wissenschaftlicher Studien und Best-Practice-Projekte zur Verbesserung der Projektkonzeption.
- Bewertung der Realisierbarkeit des Projekts und Sicherung der Akzeptanz bei Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften.
- Entwicklung eines umfassenden Finanzierungsplans und einer zeitlichen Planung des Projekts.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation dar und erläutert die Relevanz des Projekts im Kontext der allgegenwärtigen digitalen Medien. Die Problembetrachtung beleuchtet die physischen und psychischen Belastungen, die durch die Nutzung digitaler Medien bei Jugendlichen entstehen können. Die Entwicklung der Fragestellung analysiert die Situation aus der Perspektive von Eltern, Lehrern und Jugendlichen. Das Thema und die Ziele des Projekts werden klar definiert, wobei sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Ziele formuliert werden. Die gesundheitspolitische Relevanz wird durch die Thematisierung in der Öffentlichkeit und die Relevanz für den Jugendschutz beleuchtet.
Der Stand der Forschung und Entwicklung in der Praxis präsentiert relevante Begriffsbestimmungen im Kontext der Gesundheitsförderung, wie z. B. den Setting-Ansatz und das Transtheoretische Modell. Zudem werden relevante empirische Forschungsstudien und Best Practice Projekte vorgestellt, die wichtige Erkenntnisse für die Projektentwicklung liefern.
Die Einschätzung der Realisierbarkeit und Strategien zur Akzeptanzsicherung beschreibt die notwendigen Schritte zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Die Kapitel über Durchführung, Zeitplanung und Finanzierung bieten einen detaillierten Einblick in die praktische Umsetzung des Projekts. Die erwarteten Ergebnisse und die Übertragbarkeit des Projekts auf andere Lebensbereiche werden ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Gesundheitsförderung, digitale Medien, Internetnutzung, Jugendliche, Lebenswelt, physische Belastungen, psychische Auswirkungen, Setting-Ansatz, Gesundheitsaufklärung, Gesundheitserziehung, Transtheoretisches Modell, empirische Forschung, Best Practice, Realisierbarkeit, Akzeptanzsicherung, Zeitplanung, Finanzierung, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Projekt „OnLife“?
OnLife ist ein Projekt zur Gesundheitsförderung von 12- bis 13-jährigen Jugendlichen, das sich mit den Auswirkungen der omnipräsenten Nutzung digitaler Medien befasst.
Welche gesundheitlichen Folgen hat exzessive Mediennutzung bei Jugendlichen?
Sie kann zu physischen Belastungen (z. B. Haltungsschäden, Schlafmangel) und psychischen Auswirkungen (z. B. Stress, Konzentrationsstörungen) führen.
Was ist der Setting-Ansatz in der Gesundheitsförderung?
Dieser Ansatz zielt darauf ab, gesundheitsfördernde Maßnahmen direkt im Lebensumfeld der Zielgruppe (z. B. in der Schule oder im Verein) zu verankern.
Welche Rolle spielt das Transtheoretische Modell im Projekt?
Es dient dazu, die Bereitschaft der Jugendlichen zur Verhaltensänderung einzuschätzen und die Interventionen entsprechend dem jeweiligen Stadium anzupassen.
Wie wird die Akzeptanz des Projekts bei Eltern und Lehrern gesichert?
Durch Einbeziehung in die Planung, Aufklärung über die Risiken der Mediennutzung und die Entwicklung gemeinsamer Strategien zur Förderung der Medienkompetenz.
- Quote paper
- Nancy Kolling (Author), 2017, OnLife. Ein Projekt zur Gesundheitsförderung von Jugendlichen mit Fokus auf die Omnipräsenz digitaler Medien in deren Lebenswelten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371782