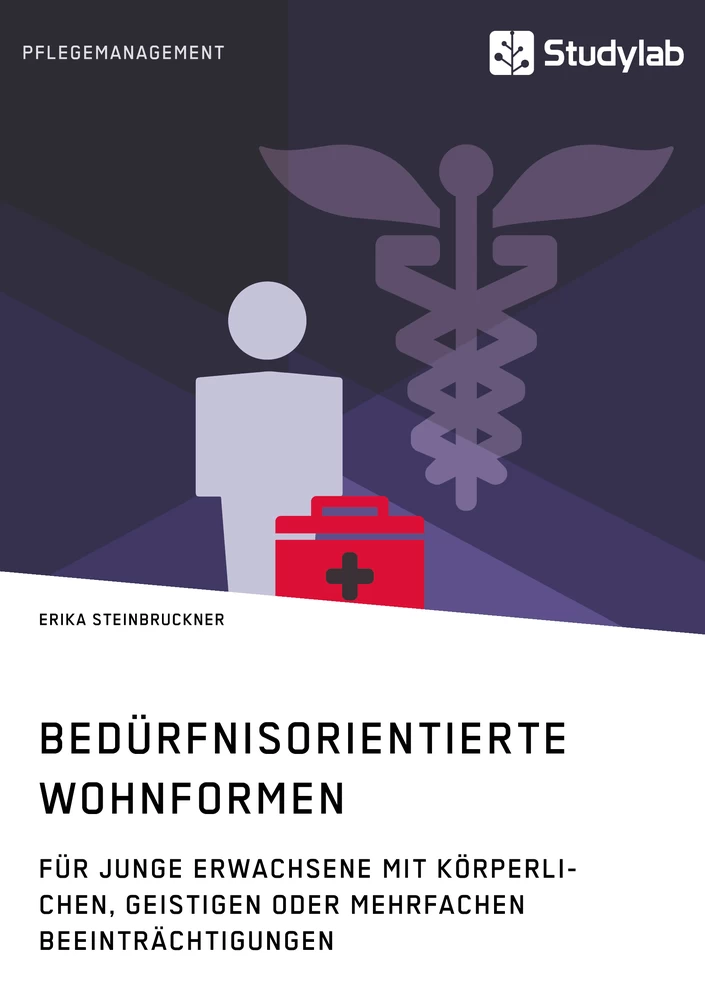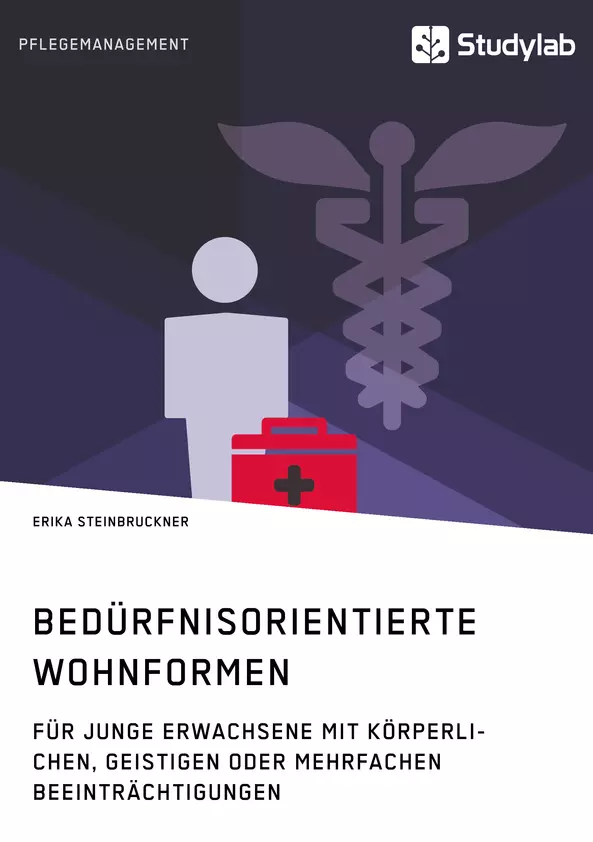Die englische Sprache definiert das Wort „Wohnen" mit „to live" also „leben" und ist damit unmittelbar mit menschlicher Existenz verbunden. ,,Wohnen" heißt auch, bleiben zu können. ,,Wohnen" definiert auch ein Grundbedürfnis nach Schutz und Hülle, nach einem Zuhause als einem sicheren Ort des Rückzugs und der Ruhe. Wohnen meint aber auch ein „Dach über dem Kopf zu haben" und wird oftmals auch definiert mit „mein Zuhause". So unterschiedlich die Beschreibungen und Definitionen zu dem Begriff „Wohnen" auch sind, gleich ist jedoch der Umstand, dass Wohnen ein menschliches Grundbedürfnis für alle Menschen - unabhängig mit oder ohne Beeinträchtigung - darstellt.
Primäres Ziel im Rahmen des Dö. Chancengleichheitsgesetzes 2008 soll sein, Menschen mit Beeinträchtigungen, speziell junge Erwachsene, ein möglichstlanges selbstbestimmtes und selbstständiges Leben bzw. Wohnen zu ermöglichen.
Die Autorin dieser Publikation gibt einen allgemeinen Überblick über die IST-Situation im Bereich der vorhandenen Wohnformen im Rahmen des Dö. Chancengleichheitsgesetzes 2008. Ihre Darstellung fußt auf einer Literaturanalyse sowie auf einer empirischen Untersuchung [qualitativ). Ihre Expertenauswahl konzentriert sich dabei auf unterschiedliche Zielgruppen wie z.B. beeinträchtigte Personen, Angehörige, Verwaltungsmitarbeiter, Trägerorganisation etc. Basierend auf den erhobenen Ergebnissen und deren Auswertungen leitet die Autorin Handlungsempfehlungen für Wohnformen für junge Erwachsene mit körperlichen, geistigen und/oder mehrfachen Beeinträchtigungen ab.
Aus dem Inhalt:
- Beeinträchtigung;
- Behinderung;
- Unterstützungsmodelle;
- Handlungsempfehlungen;
- Wohnmodelle
Inhaltsverzeichnis
- Anmerkung
- Danksagung
- Kurzfassung
- Executive Summary
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zentrale Problemstellung
- 1.2 Ziele und Forschungsfragen
- 1.3 Methodik
- 1.4 Aufbau und Struktur
- 2 Einführung in das Thema der Beeinträchtigungen
- 2.1 Historische Entwicklung des Begriffes der Behinderung
- 2.2 Definitionen von Beeinträchtigungen
- 2.3 Formen und Arten von Beeinträchtigungen
- 3 Rechtliche Grundlagen
- 3.1 UN-Behindertenkonvention 2008
- 3.2 Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz 2005
- 3.3 Oö. Chancengleichheitsgesetz 2008
- 3.4 Mitwirkungsformen des Oö. ChG 2008
- 4 Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigungen
- 4.1 Begriffsdefinition Wohnen
- 4.2 Wohnqualität
- 4.3 Leistungsbeschreibung „Wohnen“ gemäß Oö. ChG 2008
- 4.4 Wohnformen in Oberösterreich
- 5 Betreuungs- und Unterstützungsleistungen
- 5.1 Mobile Dienste
- 5.2 Ergänzende Unterstützungssysteme
- 5.3 Die 24-Stunden-Betreuung
- 6 Finanzstruktur von Wohnformen und Unterstützungsleistungen
- 6.1 Oö. ChG-Beitrags- und Richtsatzverordnung
- 6.2 Arten von finanziellen Sozialleistungen
- 7 Best-Practice-Beispiele anderer Länder
- 7.1 Personengebundenes Budget in den Niederlanden
- 7.2 Lebensweltorientierte Integrative Wohngemeinschaften Reutlingen
- 8 Empirische Erhebung
- 8.1 Vorgehensweise
- 8.2 Darstellung der Forschungsmethode
- 8.3 Auswahl und Beschreibung der Experten
- 8.4 Durchführung der Interviews
- 8.5 Datenerfassung
- 8.6 Auswertungsmethode der qualitativen Interviews
- 9 Ergebnisse der empirischen Erhebung
- 9.1 Allgemeines
- 9.2 Überblick zum Thema „Beeinträchtigungen“
- 9.3 Derzeitige Wohnsituation
- 9.4 Wohnangebote
- 9.5 Unterstützungssysteme
- 9.6 Künftige Wohnformen
- 9.7 Zusätzliche Anforderungen
- 9.8 Abschließende wichtige Impulse der Interviewpartner
- 9.9 Vergleich der Ergebnisse: Unterschiede und wichtige Aspekte
- 10 Zusammenfassung und Empfehlungen
- 10.1 Beantwortung der Forschungsfragen
- 10.2 Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung bedürfnisorientierter Wohnformen für junge Erwachsene mit körperlichen, geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigungen. Ziel der Untersuchung ist es, den aktuellen Stand der Wohnformen und Unterstützungssysteme in Oberösterreich zu analysieren, die Bedürfnisse dieser Personengruppe zu beleuchten und Empfehlungen für die Gestaltung zukünftiger Wohnangebote zu formulieren.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Menschen mit Beeinträchtigungen
- Bedürfnisse und Lebensqualität in Wohnformen
- Betreuungs- und Unterstützungssysteme
- Finanzierungsmöglichkeiten
- Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: In diesem Kapitel werden die Problemstellung, Ziele und Forschungsfragen der Arbeit definiert. Die Methodik der Untersuchung sowie der Aufbau und die Struktur der Arbeit werden vorgestellt.
- Kapitel 2: Einführung in das Thema der Beeinträchtigungen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die historische Entwicklung des Begriffs der Behinderung, Definitionen von Beeinträchtigungen sowie Formen und Arten von Beeinträchtigungen.
- Kapitel 3: Rechtliche Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, insbesondere die UN-Behindertenkonvention, das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz und das Oö. Chancengleichheitsgesetz.
- Kapitel 4: Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Wohnen, der Bedeutung von Wohnqualität und der Leistungsbeschreibung „Wohnen“ gemäß Oö. ChG 2008. Außerdem werden verschiedene Wohnformen in Oberösterreich vorgestellt.
- Kapitel 5: Betreuungs- und Unterstützungsleistungen: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Betreuungs- und Unterstützungssysteme, darunter mobile Dienste, ergänzende Unterstützungssysteme und die 24-Stunden-Betreuung.
- Kapitel 6: Finanzstruktur von Wohnformen und Unterstützungsleistungen: Dieses Kapitel behandelt die Finanzierung von Wohnformen und Unterstützungsleistungen, insbesondere die Oö. ChG-Beitrags- und Richtsatzverordnung und verschiedene Arten von finanziellen Sozialleistungen.
- Kapitel 7: Best-Practice-Beispiele anderer Länder: Dieses Kapitel stellt Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern vor, darunter das Personengebundene Budget in den Niederlanden und lebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaften in Reutlingen.
- Kapitel 8: Empirische Erhebung: In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise bei der empirischen Erhebung beschrieben, die Forschungsmethode erläutert, die Auswahl der Experten dargestellt und die Durchführung und Auswertung der Interviews erklärt.
- Kapitel 9: Ergebnisse der empirischen Erhebung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Erhebung, die sich mit den Themen Beeinträchtigungen, derzeitiger Wohnsituation, Wohnangeboten, Unterstützungssystemen, zukünftigen Wohnformen, zusätzlichen Anforderungen und wichtigen Impulsen der Interviewpartner befassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen bedürfnisorientierte Wohnformen, junge Erwachsene, körperliche, geistige und multiple Beeinträchtigungen, rechtliche Grundlagen, Wohnqualität, Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, Finanzierung, Best-Practice-Beispiele, empirische Forschung, qualitative Interviews, Oberösterreich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Oö. Chancengleichheitsgesetzes 2008?
Das Gesetz zielt darauf ab, Menschen mit Beeinträchtigungen ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges Leben sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Welche Wohnformen gibt es für junge Erwachsene mit Behinderung?
Es gibt stationäre Wohnheime, teilbetreutes Wohnen, integrative Wohngemeinschaften sowie mobile Unterstützungsdienste für das Wohnen in den eigenen vier Wänden.
Was versteht man unter „bedürfnisorientiertem Wohnen“?
Es bedeutet, dass die Wohnform und die Betreuungsleistung individuell an die körperlichen, geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigungen des Bewohners angepasst werden.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenkonvention?
Sie bildet die völkerrechtliche Grundlage für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, insbesondere das Recht auf freie Wahl des Wohnorts und der Wohnform.
Was ist ein „Personengebundenes Budget“?
Es ist ein Finanzierungsmodell (z.B. aus den Niederlanden), bei dem Betroffene Geldmittel erhalten, um sich notwendige Assistenz- und Wohnleistungen selbst einzukaufen.
- Citar trabajo
- Erika Steinbruckner (Autor), 2017, Bedürfnisorientierte Wohnformen für junge Erwachsene mit körperlichen, geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371786