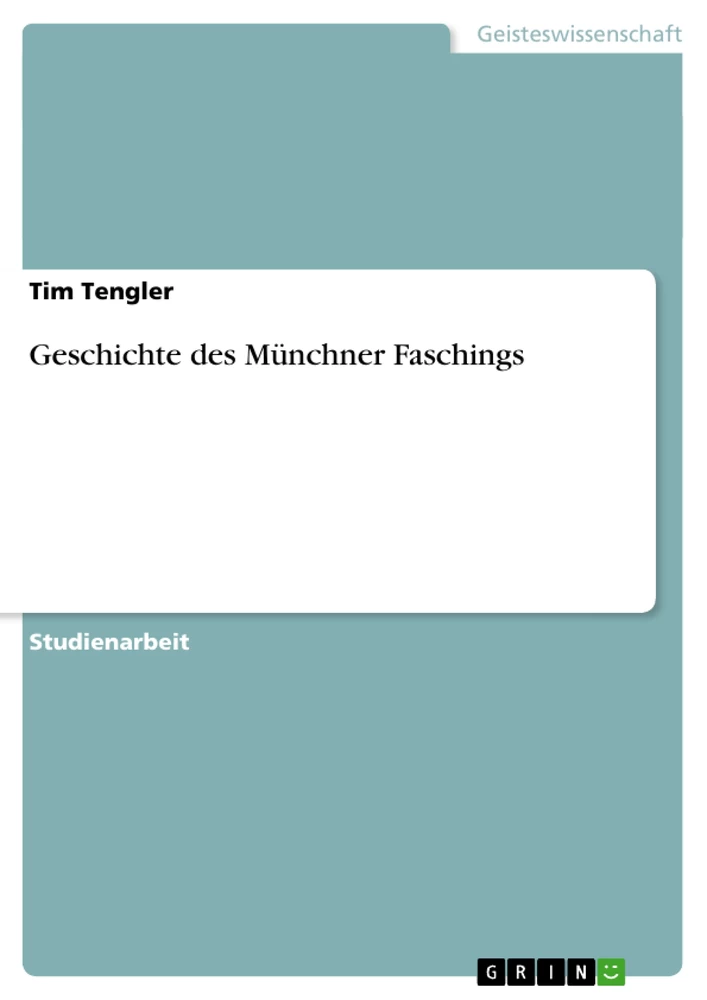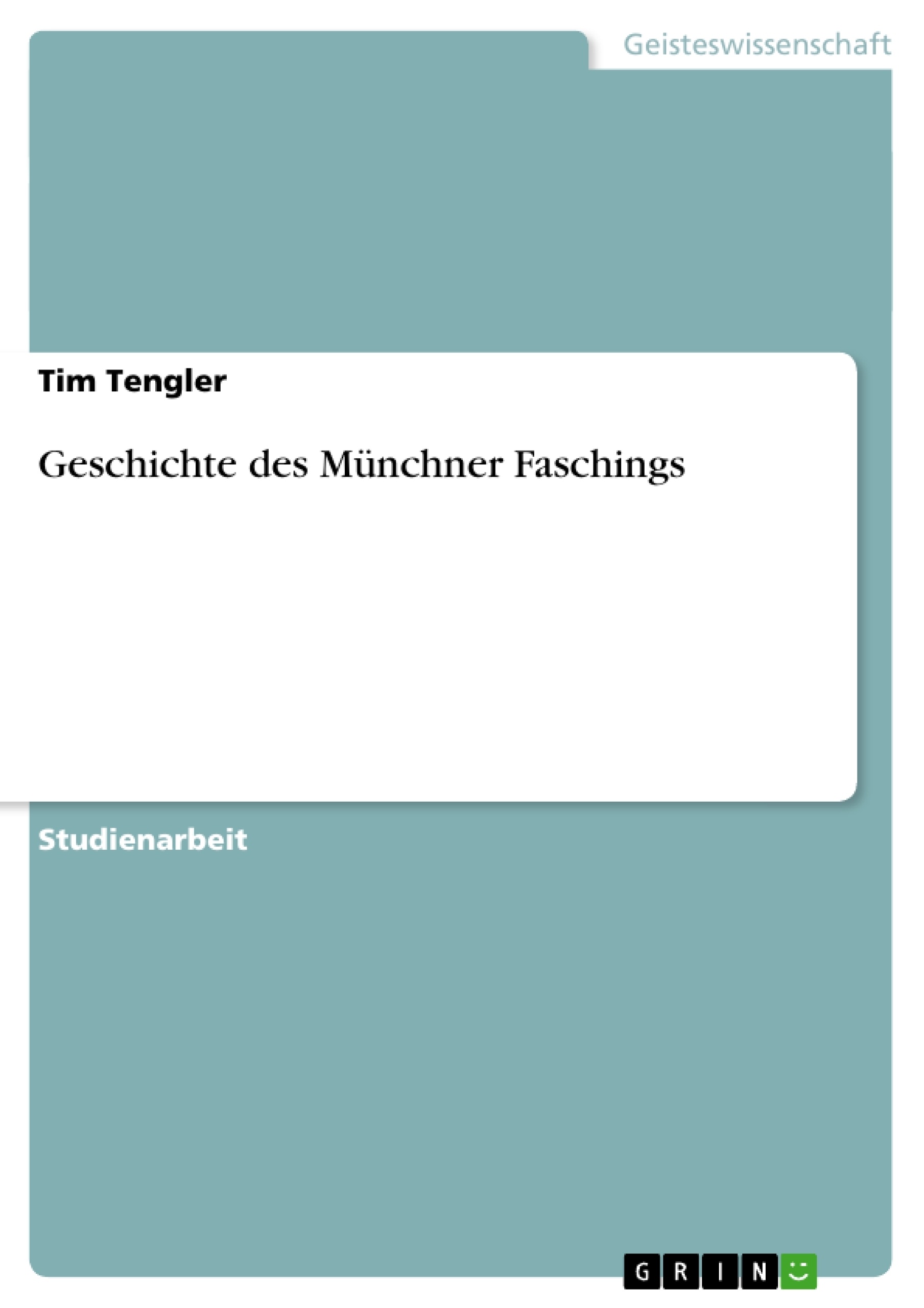Der Februar gilt im allgemeinen als der Faschingsmonat - wenn nicht ein besonders früh liegender Aschermittwoch dem lustigen Treiben ein frühzeitiges Ende bereitet. Die Lage von Aschermittwoch im Kalender und damit auch die Dauer des Faschings, wird von der Lage des Osterfestes diktiert. Ostern fällt immer auf einen Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühjahrsanfang. Das kann frühestens der 22. März, spätestens der 25. April sein. Dem Osterfest ist eine Fastenzeit vorgeschalten, die ur-sprünglich 40 tage umfasst, seit Anfang des 7. Jahrhunderts jedoch mit dem Mittwoch nach Quinqua-gesima (= Aschermittwoch) beginnt.
Die Entwicklung der Münchner Fasnacht lässt sich durch reichliche Zeugnisse aus alter Zeit über 700 Jahre zurückverfolgen und macht eine beinahe lückenlose chronologische Aufreihung über die Bedeu-tungsgewinnung des Faschings in München möglich. Im Folgenden sollen einige wichtige Ereignisse kurz dargestellt werden und der Fasching in München von der Stadtgründung bis in die heutige Zeit beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frühe urkundliche Erwähnungen des Faschings
- Erste Formen des Faschings
- Konflikte durch Kirche, Obrigkeit, Krieg und Krankheiten
- Erste Faschingsspektakel nach der Krisenzeit
- Die Rückkehr des Faschings
- Die Blütezeit des Münchner Faschings
- Veränderungen der Faschingsbräuche
- Fasching in der heutigen Zeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit verfolgt das Ziel, die Geschichte des Münchner Faschings von seinen frühen urkundlichen Erwähnungen bis in die Gegenwart zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Faschingsbräuche, ihre Bedeutungswandel und die Einflüsse von Kirche, Obrigkeit, Kriegen und Krankheiten.
- Entwicklung des Münchner Faschings über sieben Jahrhunderte
- Einfluss von Kirche und Obrigkeit auf die Faschingsfeierlichkeiten
- Die Rolle von Kriegen und Krankheiten auf die Faschingstradition
- Veränderungen der Faschingsbräuche im Laufe der Zeit
- Der Münchner Fasching im Vergleich zu anderen Karnevalsfeiern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Faschingsmonat Februar und die Abhängigkeit der Faschingsdauer von der Lage des Osterfestes. Sie skizziert den langen Zeitraum der Münchner Fasnacht und kündigt die chronologische Darstellung wichtiger Ereignisse an.
Frühe urkundliche Erwähnungen des Faschings: Dieses Kapitel behandelt die ersten schriftlichen Erwähnungen des Faschings in München, beginnend mit dem Jahr 1295 in einer herzoglichen Urkunde. Es wird die Entwicklung der Bezeichnung „Fasching“ und die Annahme diskutiert, dass die Fastnacht bereits vor 1295 ein fester Bestandteil des städtischen Lebens war, unter anderem als beliebter Hochzeitstermin. Die Analyse von alten Rechnungen zeigt Ausgaben für Fastmähler in der Faschingszeit, ohne jedoch einen direkten Bezug zur Fasnacht selbst aufzuweisen.
Erste Formen des Faschings: Dieses Kapitel beschreibt die ersten Formen des Faschings in München Mitte des 14. Jahrhunderts, insbesondere im Kontext sozialer Unruhen zwischen Patriziat und Volk. Trotz der Revolution von 1397 finden sich Zeugnisse von Festmählern, Turnieren und Tänzen zur Fasnacht. Das Kapitel betont die Kontinuität der Feierlichkeiten selbst während kriegerischer Auseinandersetzungen und den Übergang zu öffentlichen Festen mit Beteiligung der gesamten Bürgerschaft. Die Einführung des Salzsendermahls als Brauch ab 1406 wird detailliert erläutert.
Konflikte durch Kirche, Obrigkeit, Krieg und Krankheiten: Hier wird der Einfluss von Kirche, Obrigkeit, Kriegen und Krankheiten auf den Münchner Fasching untersucht. Das Kapitel hebt hervor, dass selbst ein kirchlicher Aufruf gegen weltliche Freuden im Jahr 1454 den Münchner Fasching nicht wesentlich beeinträchtigte, was seine Resilienz und Popularität unterstreicht. Der Abschnitt legt den Grundstein für die weitere Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Kontinuitäten der Faschingstradition.
Schlüsselwörter
Münchner Fasching, Geschichte, Volkskunde, Brauchtum, Fastnacht, Kirche, Obrigkeit, Krieg, Krankheit, Entwicklung, Tradition, soziale Unruhen, Festlichkeiten, Stadtgeschichte München.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Geschichte des Münchner Faschings
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Geschichte des Münchner Faschings, von seinen ersten schriftlichen Erwähnungen bis in die Gegenwart. Sie untersucht die Entwicklung der Faschingsbräuche, ihren Bedeutungswandel und den Einfluss von Kirche, Obrigkeit, Kriegen und Krankheiten.
Welche Zeitspanne umfasst die Arbeit?
Die Arbeit betrachtet die Geschichte des Münchner Faschings über einen Zeitraum von sieben Jahrhunderten.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Entwicklung des Münchner Faschings, den Einfluss von Kirche und Obrigkeit auf die Feierlichkeiten, die Rolle von Kriegen und Krankheiten auf die Faschingstradition, Veränderungen der Faschingsbräuche im Laufe der Zeit und einen Vergleich des Münchner Faschings mit anderen Karnevalsfeiern.
Wann wird der Münchner Fasching erstmals urkundlich erwähnt?
Die ersten schriftlichen Erwähnungen des Faschings in München finden sich ab dem Jahr 1295 in einer herzoglichen Urkunde. Die Arbeit diskutiert jedoch die Annahme, dass die Fastnacht bereits vor diesem Zeitpunkt ein fester Bestandteil des städtischen Lebens war.
Wie sahen die ersten Formen des Faschings in München aus?
Die ersten Formen des Faschings in München Mitte des 14. Jahrhunderts sind im Kontext sozialer Unruhen zwischen Patriziat und Volk zu sehen. Trotz kriegerischer Auseinandersetzungen gab es Festmähler, Turniere und Tänze. Ab 1406 wurde das Salzsendermahl als Brauch eingeführt.
Wie wirkten sich Kirche, Obrigkeit, Krieg und Krankheiten auf den Münchner Fasching aus?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Kirche, Obrigkeit, Kriegen und Krankheiten auf den Münchner Fasching. Es wird gezeigt, dass selbst kirchliche Aufrufe gegen weltliche Freuden den Fasching nicht wesentlich beeinträchtigten, was seine Resilienz und Popularität unterstreicht.
Welche Kapitel beinhaltet die Seminararbeit?
Die Seminararbeit beinhaltet Kapitel zu Einleitung, frühen urkundlichen Erwähnungen des Faschings, ersten Formen des Faschings, Konflikten durch Kirche, Obrigkeit, Krieg und Krankheiten, ersten Faschingsspektakeln nach der Krisenzeit, der Rückkehr des Faschings, der Blütezeit des Münchner Faschings, Veränderungen der Faschingsbräuche, dem Fasching in der heutigen Zeit und einem Schlusskapitel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Münchner Fasching, Geschichte, Volkskunde, Brauchtum, Fastnacht, Kirche, Obrigkeit, Krieg, Krankheit, Entwicklung, Tradition, soziale Unruhen, Festlichkeiten, Stadtgeschichte München.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit verfolgt das Ziel, die Geschichte des Münchner Faschings von seinen frühen urkundlichen Erwähnungen bis in die Gegenwart zu beleuchten und die Entwicklung der Faschingsbräuche, ihren Bedeutungswandel und die Einflüsse von Kirche, Obrigkeit, Kriegen und Krankheiten zu untersuchen.
- Citation du texte
- Tim Tengler (Auteur), 2003, Geschichte des Münchner Faschings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37184