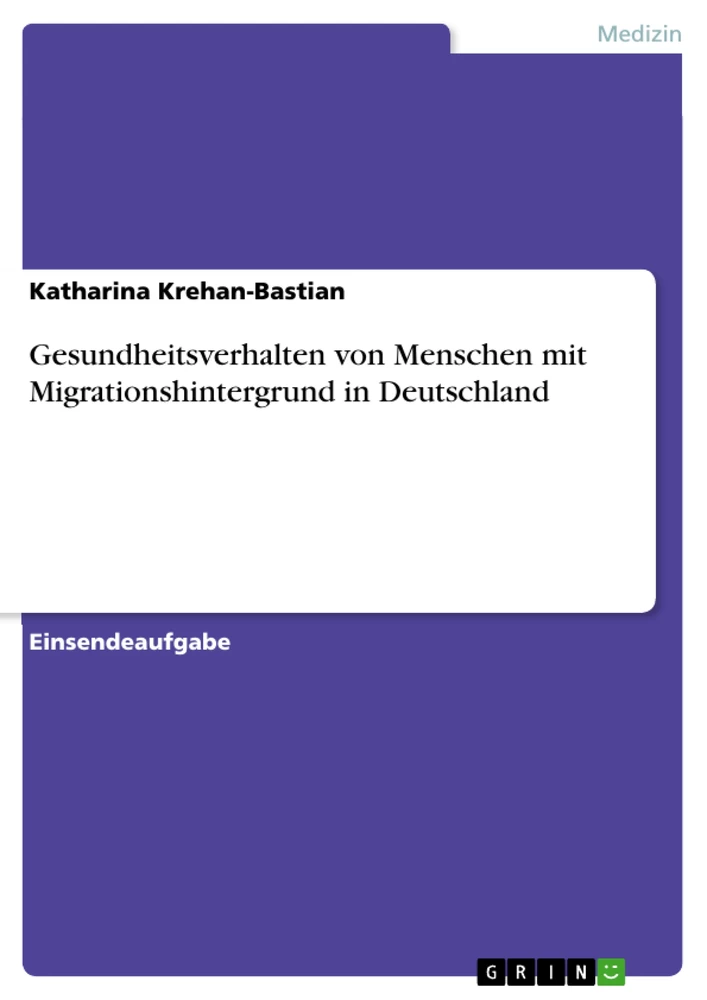Seit Jahrzehnten ist Deutschland Ziel von Migrantinnen und Migranten, welche aus unterschiedlichen Gründen ihr Heimatland verlassen. Dabei bleiben viele dieser Menschen und ihre Nachkommen dauerhaft in Deutschland. Für das Gesundheitswesen stellt dies erhebliche Herausforderungen für eine optimale Gesundheitsversorgung dar. So wird die Gesundheit der Menschen mit Migrationshintergrund sowohl durch ihr Herkunftsland als auch das Zuwanderungsland beeinflusst.
Einerseits kann Migration neue Lebenschancen eröffnen, andererseits auch gesundheitliche Belastungen aufgrund von Informationsdefiziten, kulturspezifischen Besonderheiten beim Gesundheits- und Krankheitsverhalten oder Sprachschwierigkeiten fördern, so dass diese Menschen häufig von Einrichtungen der gesundheitlichen Förderung unzureichend erreicht werden. Viele Einflüsse begründen eine uneinheitliche gesundheitliche Lage von Menschen mit Migrationshintergrund.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Migrantinnen und Migranten in Deutschland
2.2 Gesundheits- und Krankheitsverhalten
2.3 Gesundheitskompetenz – als theoretisches Modell
2.4 Forschungsfrage
3 Methodik
4 Ergebnisse
5 Diskussion
6 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Seit Jahrzehnten ist Deutschland Ziel von Migrantinnen und Migranten, welche aus unterschiedlichen Gründen ihr Heimatland verlassen. Dabei bleiben viele dieser Menschen und ihre Nachkommen dauerhaft in Deutschland. Für das Gesundheitswesen stellt dies erhebliche Herausforderungen für eine optimale Gesundheitsversorgung dar. So wird die Gesundheit der Menschen mit Migrationshintergrund sowohl durch ihr Herkunftsland als auch das Zuwanderungsland beeinflusst. Einerseits kann Migration neue Lebenschancen eröffnen, andererseits auch gesundheitliche Belastungen aufgrund von Informationsdefiziten, kulturspezifischen Besonderheiten beim Gesundheits- und Krankheitsverhalten oder Sprachschwierigkeiten fördern, so dass diese Menschen häufig von Einrichtungen der gesundheitlichen Förderung unzureichend erreicht werden. Viele Einflüsse begründen eine uneinheitliche gesundheitliche Lage von Menschen mit Migrationshintergrund (RKI, 2015, S. 176).
Die vorliegende Arbeit analysiert das Gesundheitsverhalten mit dem Fokus auf bisher weniger berücksichtigte Risikogruppen von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Migrantinnen und Migranten in Deutschland
Mit einem Bevölkerungsanteil von ca. 17,1 Mill. im Jahr 2015 leben mehr Menschen mit Migrationshintergrund als je zuvor in Deutschland (DESTATIS, 2015). Eine Betrachtung dieser Bevölkerungsgruppe wird durch unterschiedliche Definitionen des Migrationshintergrundes erschwert. In einigen Bereichen sind Aussagen zur gesundheitlichen Lage möglich, aber insgesamt ist die Datenlage unvollständig (RKI, 2015, S. 177).
2.2 Gesundheits- und Krankheitsverhalten
Im Mittel sind diese Menschen jünger als die heimische Bevölkerung, unterscheiden sich in ihrer gesundheitlichen sowie schlechteren sozialen Lage. Das Armutsrisiko ist im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung für Migranten deutlich höher. So weisen beispielsweise Menschen mit türkischem Migrationshintergrund die höchsten Armutsquoten auf (RKI, 2015, S. 177). Mit zunehmender Aufenthaltsdauer in Deutschland werden auch gesundheitliche Nachteile sichtbar. Menschen mit Migrationshintergrund nehmen Gesundheitsleistungen seltener wahr und bewerten ihren Gesundheitszustand subjektiv schlechter. Ein niedriger sozioökonomischer Status assoziiert oftmals mit einem schlechteren Gesundheitszustand. Studiendaten, die die soziale sowie gesundheitliche Lage und den Migrationshintergrund abbilden, so dass gesundheitsbezogene Informationen zur Verfügung stehen, sind in Deutschland wenig vorhanden (Rommel, Sass, Born & Ellert, 2015, S. 544).
2.3 Gesundheitskompetenz – als theoretisches Modell
Charakteristisch für Menschen mit Defiziten in ihrem Gesundheitsverhalten ist, dass diese Gesundheitsvorsorgeangebote oder Zusammenhänge wie z. B. Rauchen und Krebserkrankung nicht verstehen (Franke, 2012, S. 266). So wird aus den Modellen des Gesundheits- und Krankheitsverhaltens die Gesundheitskompetenz nach Kickbusch ausgewählt. Hiernach wird Gesundheitskompetenz in fünf Teilbereiche untergliedert. Dazu zählen die persönliche Gesundheit (förderliches Verhalten), Systemorientierung (Sich-Zurechtfinden im Gesundheitssystem), das Konsumverhalten (Befähigung Konsumentscheidungen unter gesundheitlichen Aspekten zu treffen), um chancengleiche Zugangsvoraussetzung für diese Bevölkerungsgruppe zu schaffen. Weitere Teilaspekte sind die Gesundheitspolitik (Fähigkeit informiert zu handeln) und der Arbeitsweltbereich (Franke, 2012, S. 265).
2.4 Forschungsfrage
Aus dem Vorbeschriebenen ergeben sich folgende Fragen, welche zur Forschungsfrage führen.
- Ist Migration ein Risikofaktor für die Gesundheit?
- Unterscheiden sich Männer und Frauen mit Migrationshintergrund in ihrem Gesundheitsverhalten in der 1. und 2. Generation?
Welchen Einfluss haben kulturspezifische Besonderheiten auf die Gesundheit von Migrantinnen und Migranten in der 1. und 2. Generation im Zuwanderungsland Deutschland?
3 Methodik
Zur Literaturrecherche wird die Datenbank „BASE Bielefeld“ genutzt und die Suche wird am 25.2.2017 durchgeführt.
So erbringt die Eingabe „Gesundheit, Migration“ 665 Treffer, welche thematisch sehr differieren. Eine erneute Sucheingabe der Begriffe „Gesundheit „UND“ Migration“ generiert 632 Treffer. Mit der Eingabe „Gesundheit „UND“ Migrationshintergrund „UND“ soziökonomischer Status“ sind 9 Treffer verfügbar.
Nach Eingrenzung „Sprache – nur deutsch“ sind 6 Treffer verbleibend. Eine zusätzliche Selektion wird über das Auswahlkriterium „Artikel in einer Zeitschrift“ erreicht. Als Ergebnis verbleiben 2 Treffer, wobei das 2. Suchergebnis sich nicht für die oben genannte Themenauswahl eignet und 1 Ergebnis mit dem Titel „Die gesundheitliche Lage von Menschen mit Migrationshintergrund und die Bedeutung des sozioökonomischen Status – Erste Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener (DEGS1)“ des Bundesgesundheitsblattes 2015 berücksichtigt wird.
4 Ergebnisse
In der nachfolgenden Tabelle ist die ausgewählte Studie zusammengefasst.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wie die Autoren anmerken, ist die Rekrutierung von Untersuchungspersonen mit Migrationshintergrund im DEGS1 nur teilweise gelungen und in Bezug auf wichtige Merkmale keine Repräsentativität erreicht. Dies impliziert, dass besser integrierte Menschen mit Migrationshintergrund tendenziell überrepräsentiert und schlechter integrierte Personen unterpräsentiert sind.
Es zeigen sich chronische Erkrankungen in der 1. Generation geringer, liegt die Chance einer depressiven Symptomatik bei Männern beider Generationen fast doppelt so hoch. Für Personen der 2. Generation findet sich ein Zusammenhang zwischen dem täglichen Tabakkonsum, auch nach Adjustierung nach sozioökonomischen Status. Frauen der 1. Generation neigen häufiger zu körperlicher Inaktivität. Männer beider Generationen und Frauen der 1. Generation sind häufiger nicht über Programme zur Früherkennung informiert oder nutzen diese nur unregelmäßig. Insbesondere Frauen der 1. Generation zeigen eine hohe Nichtteilnahme an Maßnahmen zur Verhaltensprävention. Im Vergleich finden sich Unterschiede bei Frauen fast ausnahmslos für Migrantinnen der ersten Generation. Die aufgeführten Ergebnisse sind im Vergleich zu Personen ohne Migrationshintergrund betrachtet.
5 Diskussion
Migrantinnen und Migranten stellen eine sehr heterogene Untersuchungsgruppe in Bezug auf die Migrationserfahrungen (eigene, in Deutschland geboren) dar (Rommel et al., 2015, S 549). Jedoch scheinen die eigene Migrationserfahrung sowie das kulturspezifische Verständnis von Gesundheit und Krankheit, insbesondere bei den Frauen der 1. Generation, ein wesentlicher Einflussfaktor auf das individuelle Gesundheitsverhalten zu sein. Die Ergebnisse der vorbeschriebenen Studie zeigen Unterschiede in Abhängigkeit von der Aufenthaltsdauer und dem Geschlecht. Es deutet darauf hin, dass ein Migrationshintergrund in der Bevölkerungsgesundheit als eine eigenständige Determinante und nicht als Risikofaktor anzusehen ist. Die Aufenthaltsdauer im Zuwandererland scheint das Gesundheitsverhalten zu beeinflussen. Als künftige methodische Schwierigkeit sind der Einfluss von Kultur und Sprachbarrieren innerhalb der 1. Generation anzusehen.
6 Fazit
Zur Nutzung der Gesundheitsleistungen stellt insbesondere die Sprachbarriere ein Problem dar. Die generationsspezifischen Unterschiede deuten auf verschiedene Informationsbeschaffungstechniken (Internet, Gesprächskreis) hin. Eine Ausweitung mehrsprachiger Informationsangebote in Arztpraxen, der Krankenkassen oder die Vermittlung von z. B. Vorsorgeangeboten durch vertraute Personen (Ehemänner der Frauen der 1. Generation) können Zugangsförderer für einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsleistungen sein. Ansätze für diese Maßnahmen können auch bekannte, bereits angenommene Treffpunkte (Migrantenvereine) in Form von migrantensensiblen Schulungen mit der Fokussierung auf Risikogruppen bieten.
Literaturverzeichnis
DESTATIS. (2015). Bevölkerung: Migration & Intergrund. Abgerufen am 25.02.2017 von https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung /MigrationIntegration/MigrationIntegration.html
Franke, A. (2012). Modelle von Gesundheit und Krankheit (3., überarb. Aufl.). Programmbereich Gesundheit. Bern: Huber.
Robert-Koch-Institut. (RKI) (2015). Gesundheit in Deutschland. Gesundheitsberichterstattung des Bundes - Gemeinsam getragen von RKI und Destatis. Berlin.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Der Text analysiert das Gesundheitsverhalten von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, wobei der Fokus auf bisher weniger berücksichtigte Risikogruppen gelegt wird.
Welche theoretischen Grundlagen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt den theoretischen Hintergrund von Migrantinnen und Migranten in Deutschland, ihr Gesundheits- und Krankheitsverhalten sowie das Konzept der Gesundheitskompetenz.
Welche Forschungsfragen werden im Text aufgeworfen?
Die Forschungsfragen umfassen die Frage, ob Migration ein Risikofaktor für die Gesundheit ist, ob sich Männer und Frauen mit Migrationshintergrund in ihrem Gesundheitsverhalten unterscheiden und welchen Einfluss kulturspezifische Besonderheiten auf die Gesundheit haben.
Welche Methodik wurde für die Literaturrecherche verwendet?
Für die Literaturrecherche wurde die Datenbank „BASE Bielefeld“ genutzt, wobei verschiedene Suchbegriffe wie „Gesundheit, Migration“ und „Gesundheit „UND“ Migrationshintergrund „UND“ soziökonomischer Status“ verwendet wurden.
Welche Ergebnisse werden im Text vorgestellt?
Die Ergebnisse basieren auf einer Studie, die zeigt, dass chronische Erkrankungen in der 1. Generation geringer sind, aber die Wahrscheinlichkeit depressiver Symptome bei Männern beider Generationen höher ist. Es gibt auch Zusammenhänge zwischen Tabakkonsum und körperlicher Inaktivität bei bestimmten Gruppen.
Welche Schlussfolgerungen werden im Text gezogen?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass ein Migrationshintergrund nicht zwangsläufig ein Risikofaktor ist, sondern eher eine eigenständige Determinante für die Bevölkerungsgesundheit darstellt. Die Aufenthaltsdauer im Zuwanderungsland scheint das Gesundheitsverhalten zu beeinflussen. Sprachbarrieren stellen ein wesentliches Problem bei der Nutzung von Gesundheitsleistungen dar.
Welche Empfehlungen werden im Text gegeben?
Es werden Empfehlungen gegeben, mehrsprachige Informationsangebote in Arztpraxen und Krankenkassen auszuweiten und Vorsorgeangebote durch vertraute Personen zu vermitteln. Auch migrantensensible Schulungen an bekannten Treffpunkten (Migrantenvereine) werden vorgeschlagen.
Welche Studie wird im Text ausführlich zitiert?
Die Studie „Die gesundheitliche Lage von Menschen mit Migrationshintergrund und die Bedeutung des sozioökonomischen Status – Erste Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener (DEGS1)“ des Bundesgesundheitsblattes 2015 wird ausführlich zitiert.
- Quote paper
- Katharina Krehan-Bastian (Author), 2017, Gesundheitsverhalten von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371869