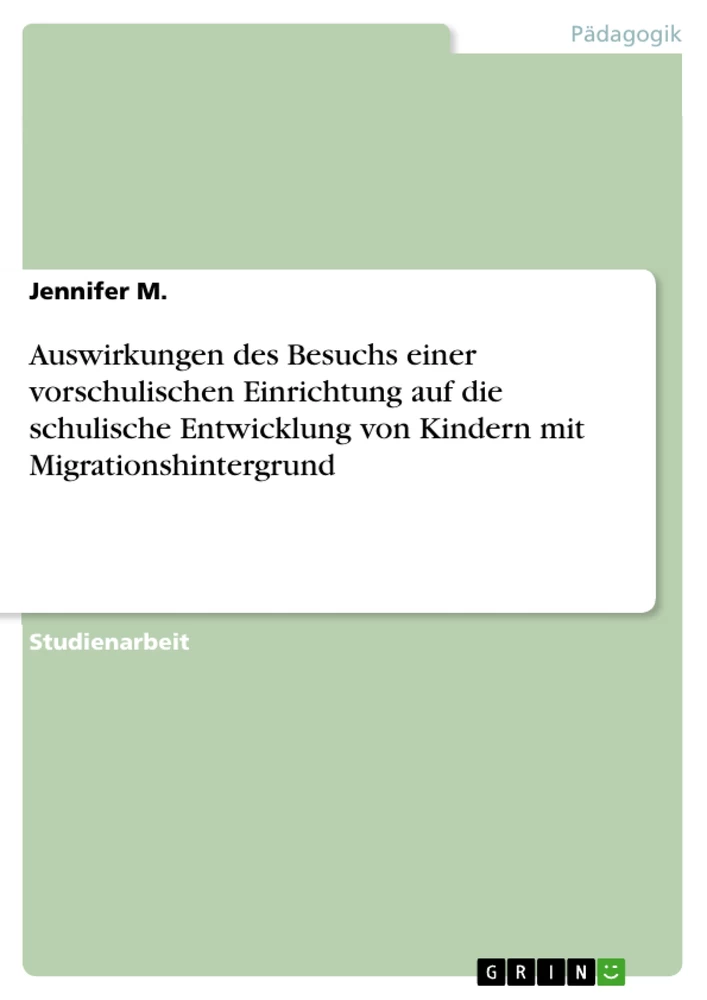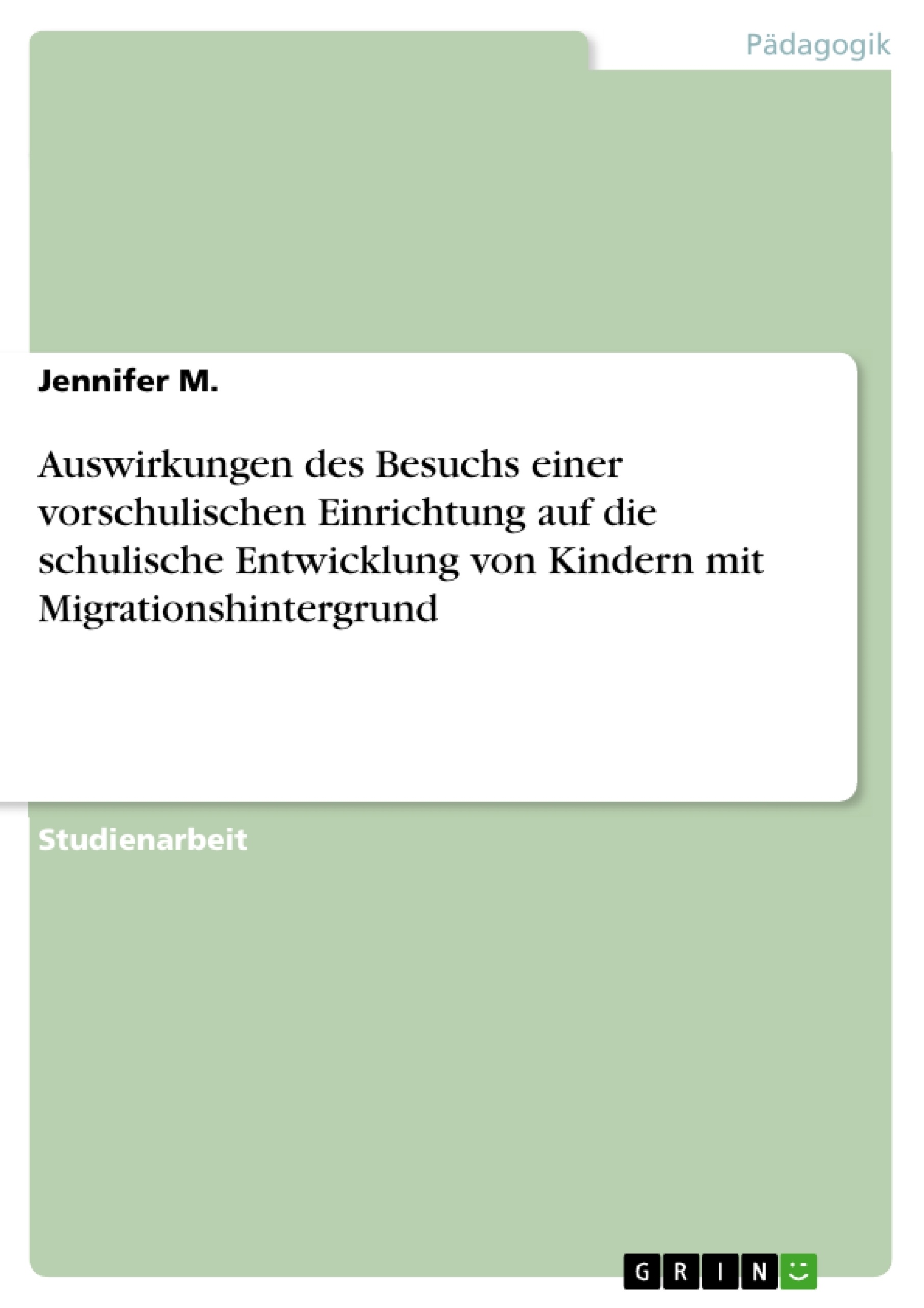Die Hausarbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in das Thema Migration und schließt mit allgemeinen Erklärungsansätzen der Bildungsbenachteiligung, die Aufschluss über den aktuellen Forschungsstand geben, daran an. Es folgt eine Erläuterung der Funktion vorschulischer Einrichtungen sowie von Faktoren, die die Wahl einer vorschulischen Einrichtung beeinflussen. Im Anschluss folgt der Hauptteil der Hausarbeit, der einen Zusammenhang zwischen Besuchsdauer einer vorschulischen Einrichtung und Entwicklung eines Kindes setzt. Darauffolgend wird die Sprachentwicklung des Kindes durch den Besuch einer vorschulischen Einrichtung thematisiert, wonach, in einem weiteren Abschnitt, Unterschiede zwischen den vorschulischen Einrichtungen erläutert werden. Im Anschluss werden weitere Auswirkungen auf das Kind angesprochen. Das letzte Kapitel fasst alle wesentlichen Aspekte der Arbeit noch einmal kurz zusammen und schließt sie mit einem Fazit ab.
Dieses Thema zeigt, wie bereits frühkindliche Förderung zu unterschiedlichen Bildungschancen beiträgt. Es hilft zudem, Stereotype zu vermeiden, und durch mehr Wissen Bildungsentscheidungen von Migranten leichter nachvollziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Migration
- Erklärungsansätze zur Bildungsbenachteiligung von Migranten
- Auswirkungen des Besuchs einer vorschulischen Einrichtung
- Die Dauer des Kindergartenbesuchs
- Die Sprachentwicklung von Kindern
- Die Qualität des Kindergartens
- Weitere Auswirkungen
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen des Besuchs einer vorschulischen Einrichtung auf die schulische Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit der Besuch einer vorschulischen Einrichtung die schulische Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund fördert, welche Unterschiede zwischen verschiedenen Kindergärten bestehen und welche Faktoren die Wahl eines Kindergartens beeinflussen.
- Der Einfluss des Besuchs einer vorschulischen Einrichtung auf die schulische Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund
- Die Rolle der Dauer des Kindergartenbesuchs für die kindliche Entwicklung
- Der Zusammenhang zwischen Kindergartenbesuch und Sprachentwicklung
- Die Bedeutung der Qualität vorschulischer Einrichtungen
- Weitere Faktoren, die die schulische Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Zusammenhang zwischen vorschulischer Bildung und der schulischen Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund in den Fokus. Es werden die Forschungsfragen und die Gliederung der Hausarbeit vorgestellt.
- Forschungsstand: Dieses Kapitel definiert den Begriff Migration und beleuchtet die aktuelle Migrationslage in Deutschland. Es werden verschiedene Erklärungsansätze zur Bildungsbenachteiligung von Migranten vorgestellt, die Aufschluss über den meist niedrigeren sozioökonomischen Status von Migranten geben.
- Auswirkungen des Besuchs einer vorschulischen Einrichtung: Dieser Teil der Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen der Dauer des Kindergartenbesuchs und der Entwicklung eines Kindes, analysiert die Sprachentwicklung von Kindern im Zusammenhang mit dem Besuch einer vorschulischen Einrichtung und beleuchtet die Unterschiede zwischen verschiedenen vorschulischen Einrichtungen. Zudem werden weitere Auswirkungen des Kindergartenbesuchs auf die kindliche Entwicklung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Migrationshintergrund, vorschulische Bildung, Bildungsbenachteiligung, Sprachentwicklung, Kindergartenqualität und schulische Entwicklung.
- Arbeit zitieren
- Jennifer M. (Autor:in), 2017, Auswirkungen des Besuchs einer vorschulischen Einrichtung auf die schulische Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372012