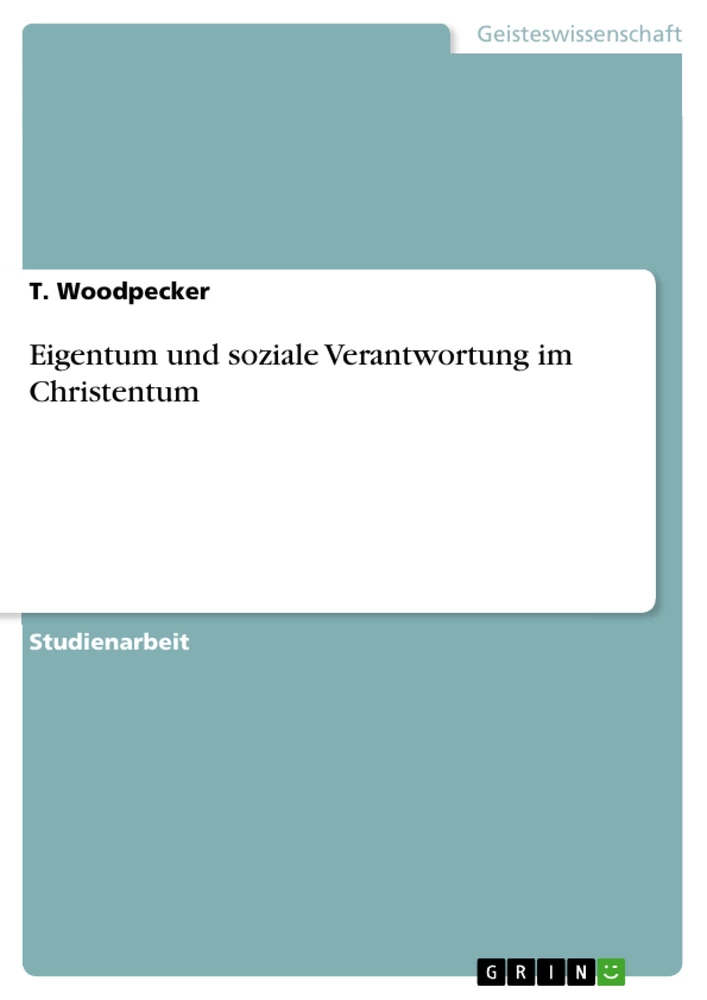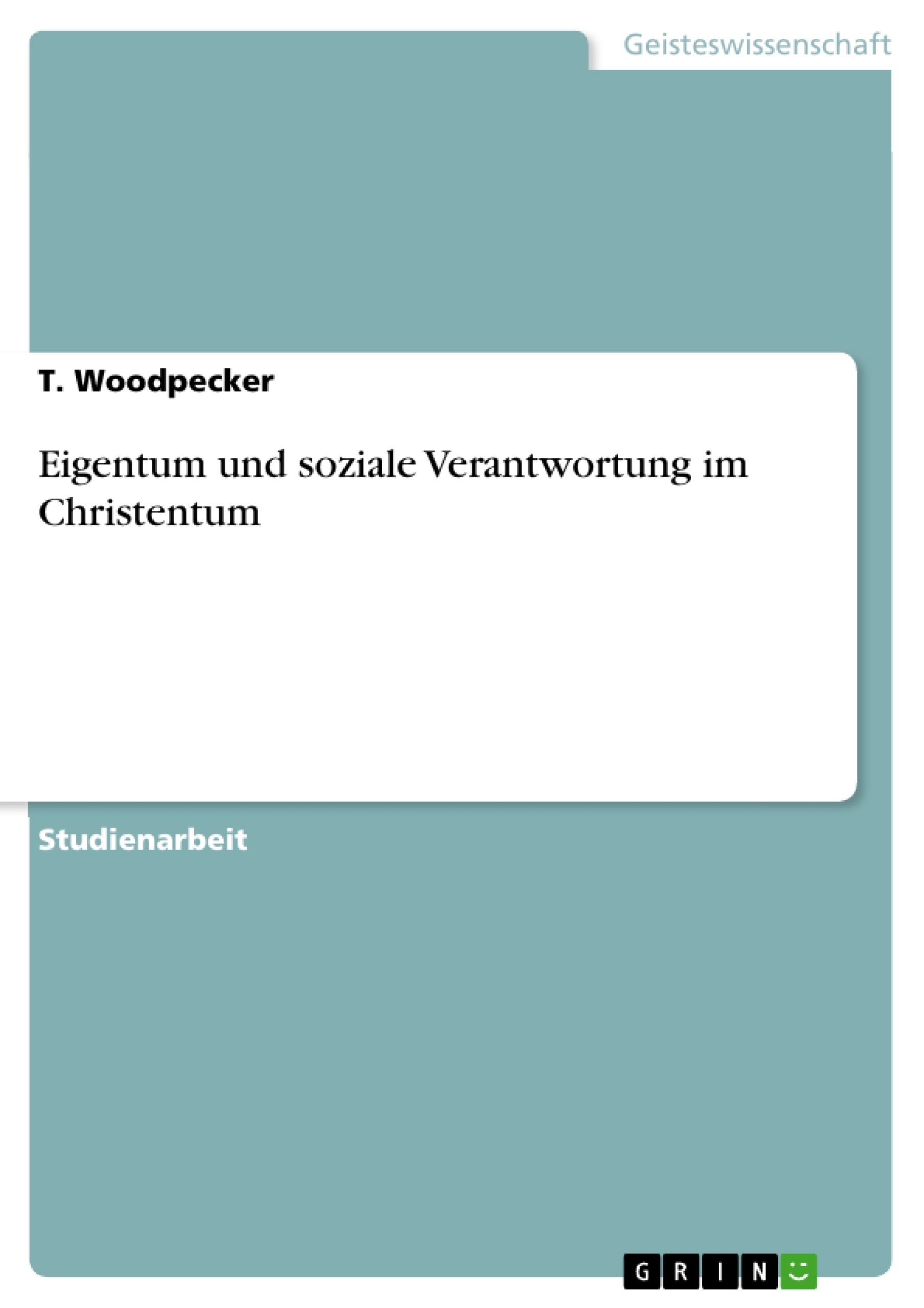Die vorliegende Arbeit untersucht das Eigentum und die daraus resultierende soziale Verantwortung im Christentum. Dabei ist eine Eingrenzung des Themenbereichs notwendig, um dem Rahmen der Arbeit gerecht zu werden. Es wird speziell auf den persönlichen Besitz und die Verantwortlichkeit von Eigentum bezogen. Aus christlicher Sicht stellt sich zunächst die Frage, inwieweit es überhaupt ein vom biblischen Standpunkt her erstrebenswertes Ziel ist, persönliches Eigentum anzuhäufen. Die Frage nach dem Besitz von Eigentum steht dabei also noch vor der Frage, inwieweit sich aus dem persönlichen Besitz auch eine persönliche soziale Verantwortung des Einzelnen ergibt.
Im Januar 2016 veröffentlichte die Organisation Oxfam eine Studie über die Ungleichheit von Armut und Reichtum in der Welt, die in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgte. Laut dieser Studie besaßen im Jahr 2015 die 62 reichsten Personen der Welt genauso viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Die Kluft zwischen Armen und Reichen ist dabei in den letzten fünf Jahren extrem gewachsen. So wuchs das Vermögen der reichsten 62 Personen in diesem Zeitraum um 45 Prozent, während es sich bei der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung um 38 Prozent reduzierte. In Deutschland besitzen die reichsten 10 Prozent der Haushalte 63 Prozent des gesamten Vermögens. Auch in Deutschland geht dabei die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander.
Die Ungleichverteilung führt dabei dazu, dass Gesellschaften auseinanderdriften und der soziale Zusammenhalt verloren geht. Die Folge sind Politikverdrossenheit, Spannungen und Gewalt, sowie ein schlechteres Wirtschaftswachstum. Jene Menschen, die in Armut leben, haben außerdem einen geringen oder gar keinen Zugang zu Schulbildung und Gesundheitsversorgung. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt und seine Bürger verfügen im Vergleich zum Durchschnitt der Weltbevölkerung über eine hohes Pro-Kopf-Vermögen. Im HDI (Human Development Index) von 2013 wird Deutschland auf Rang 6 der Welt geführt. Dieser Index berücksichtigt neben dem Bruttoinlandsprodukt auch Faktoren wie Bildung, Gesundheit und Ernährung eines Landes. Aufgrund der Tatsache, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, ist es wichtig, sich näher mit der Frage des Umgangs mit Vermögen und Eigentum zu beschäftigen. Dabei stellt sich zunächst die Frage, wie man persönlich zu meinem Eigentum stehe und damit haushalten sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Abgrenzung der ethischen Thematik
- Persönliche Erfahrung mit dem Thema
- Relevanz des Themas/ Abgrenzung der Thematik
- Begriffsklärung: Eigentum
- Eigentum in der Bibel
- Eigentum im Alten Testament
- Eigentum im Neuen Testament
- Eigentum in nachbiblischer Zeit
- Eigentum im deutschen Rechtssystem
- Eigentum in der Bibel
- Darstellung des Fragenkomplexes
- Thesenhafte Auseinandersetzung mit den ethischen Standpunkten der Thematik
- These: Menschen haben ein gottgegebenes Anrecht auf privates Eigentum über das sie frei verfügen können
- These: Privates Eigentum unterliegt immer auch Sozialpflichtigkeit
- These: Der Mensch ist immer nur Besitzer seines Eigentums, welches er in der Verantwortung vor Gott verwalten soll
- Thesen: Umgang mit Eigentum
- These: Die maßlose Vermehrung von Eigentum kann kein Ziel eines Christen sein. (Lk. 18,24)
- These: Gemeinschaftsbesitz- Als Christ, der Teil einer christlichen Gemeinschaft ist, sollte das persönliche Eigentum allen in der Gemeinschaft zur Verfügung stehen
- These: Eigentum ist ein Segen Gottes und in der Fülle des Eigentums zeigt sich dieser Segen
- Folgerungen für biblisch- ethisch verantwortliches Handeln
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der ethischen Thematik von Eigentum und sozialer Verantwortung im Kontext des Christentums. Sie analysiert die biblischen und gesellschaftlichen Perspektiven auf das Thema, um die Frage nach dem verantwortungsvollen Umgang mit Eigentum zu beleuchten.
- Die biblische Sicht auf Eigentum und Besitz
- Die ethische Dimension von Eigentum im christlichen Glauben
- Die Rolle der sozialen Verantwortung im Kontext von Eigentum
- Die Bedeutung des persönlichen Engagements für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer persönlichen Erfahrung, die die Frage nach dem verantwortungsvollen Umgang mit Eigentum aufwirft. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der globalen Ungleichheit und der Situation in Deutschland beleuchtet. Anschließend wird der Begriff „Eigentum“ in der Bibel und in nachbiblischer Zeit geklärt. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Thesen zur Frage der sozialen Verantwortung im Umgang mit Eigentum und diskutiert konkrete Handlungsempfehlungen für ein biblisch-ethisch verantwortliches Handeln.
Die Arbeit zeigt auf, dass das Thema Eigentum in der Bibel eine wichtige Rolle spielt und sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ausführlich behandelt wird. Es werden verschiedene Perspektiven auf Eigentum, Besitz und Geld beleuchtet und die ethische Dimension des Umgangs mit Eigentum hervorgehoben. Die Arbeit diskutiert zudem die Frage nach der sozialen Verantwortung, die mit dem Besitz von Eigentum einhergeht. Es wird betont, dass das Thema Eigentum im Kontext der globalen Ungleichheit und der Situation in Deutschland von besonderer Relevanz ist.
Die Arbeit analysiert verschiedene Thesen zur Frage der sozialen Verantwortung im Umgang mit Eigentum. Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven auf die Rolle des Staates, der Wirtschaft und des Einzelnen in Bezug auf die Verteilung von Ressourcen und die Bekämpfung von Armut beleuchtet. Die Arbeit diskutiert auch die Frage nach der Verantwortung von Christen im Umgang mit Eigentum und dem persönlichen Engagement für eine gerechtere Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Eigentum, soziale Verantwortung, Christentum, Bibel, Ethik, Ungleichheit, Armut, Ressourcenverteilung, Nachhaltigkeit, Konsum, Gemeinschaftsbesitz, Persönliches Engagement.
- Quote paper
- T. Woodpecker (Author), 2016, Eigentum und soziale Verantwortung im Christentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372044