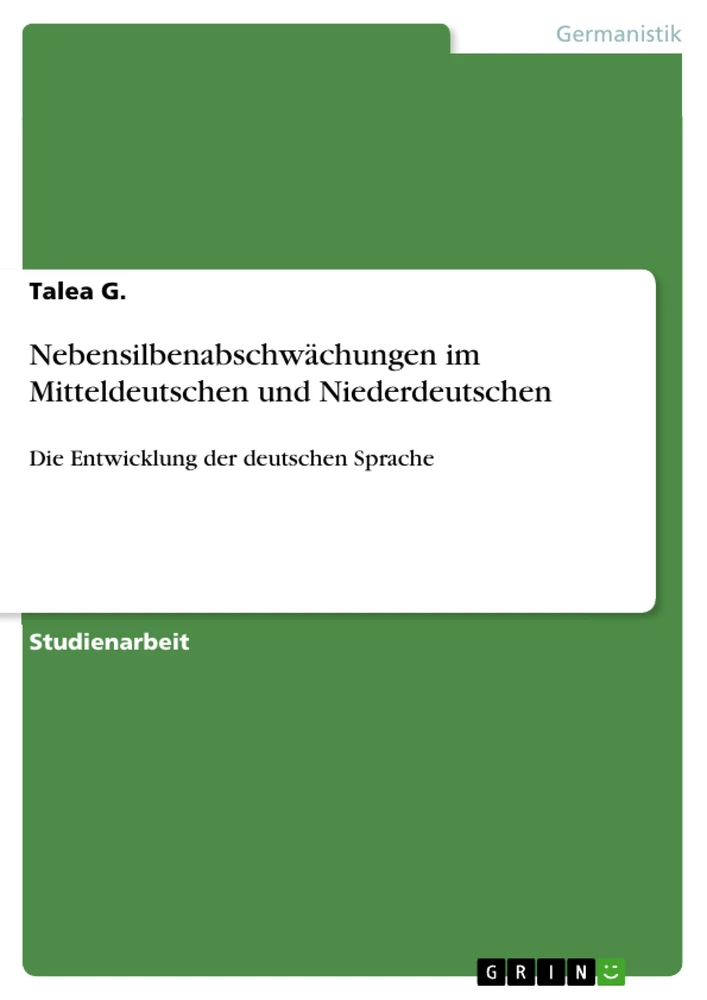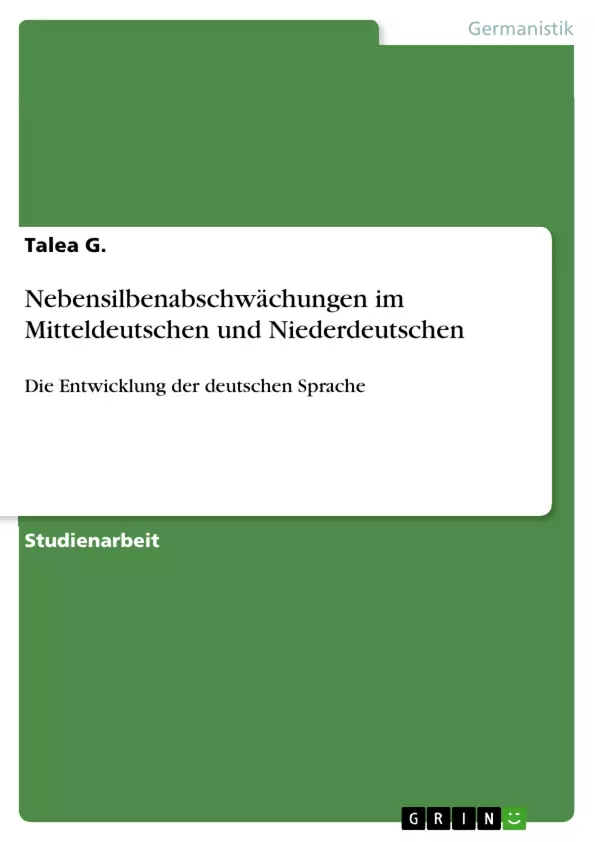Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den sprachlichen Unterschieden, insbesondere im Hinblick auf das Mittelhochdeutsche und das Niederdeutschen. Es werden hierbei Ausschnitte der Andreaslegende, in zwei übereinstimmenden mitteldeutsch und niederdeutschen Fassungen, auf Unterschiede in der sprachlichen Entwicklung untersucht. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf den Nebensilbenabschwächungen und den Lautverschiebungen.
Die These ist, dass das Niederdeutsche keine althochdeutschen Lautverschiebungen hat und weniger Nebensilbenabschwächungen als das Mittelhochdeutsche. Im Mittelhochdeutschen werden im Gegensatz dazu mehr althochdeutsche Lautverschiebungen erwartet als indogermanische Lautverschiebungen. Am Ende wird ein Fazit gezogen, in dem die Unterschiede als solche gegenübergestellt werden. Einen Vergleich des Mittelhochdeutschen mit dem Niederdeutschen gibt es bereits an vielen Beispielen, viele Vergleiche werden an Textstellen an der Bibel durchgeführt. Macia Riutort Riutort hat im Jahr 2013 den vorliegenden Text veröffentlicht und eine Analyse durchgeführt, ob die beiden Texte von einer gemeinsamen dritten Quelle übersetzt wurden. Am Schluss werden die beiden Thesen, mit Hinblick auf ihre Korrektheit, ausgewertet.
Die Andreaslegende wird auf Nebensilbenabschwächungen untersucht, da die Nebensilbenabschwächung als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Mittelhochdeutschen und dem Althochdeutschen gilt. Die Nebensilbenabschwächung ist ein besonderes Merkmal des Mittelhochdeutschen. Da die Nebensilbenabschwächung als Merkmal des Mittelhochdeutschen gilt, wird erwartet, dass das Mittelhochdeutsche mehr Nebensilbenabschwächungen aufweist, als das Niederdeutsche. Eine Nebensilbenabschwächung ist durch die Festlegung des Akzents auf den Wortanfang entstanden. Die Betonung der ersten Silben führte zu einer Abschwächung der anderen Silben, der sogenannten Nebensilben. Durch die wegfallende Betonung der Nebensilben werden die dort vorhandenen Vokale abgeschwächt. Ein Beispiel, für die Nebensilbenabschwächung, ist das althochdeutsche Wort ‚namun‘ und das mittelhochdeutsche Wort ‚name‘. Durch die Verschiebung der Betonung auf die erste Silbe im Mittelhochdeutschen, hat sich der Vokal von einem ‚u‘ zu einem ‚e‘ abgeschwächt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprachliche Veränderungen
- 2.1. Nebensilbenabschwächung
- 2.2. Lautverschiebung
- 3. Sprachen
- 3.1. Indogermanisch
- 3.2. Mittelhochdeutsch
- 3.3. Mittelniederdeutsch
- 3.3.1. Die Hanse
- 3.3.2. Doppelkonsonanten im Mittelniederdeutschen
- 3.3.3. Die Benrather Linie
- 4. Die Andreaslegende
- 4.1. Legenda Aurea
- 4.2. Buch von der heiligen lebine durch das jâr
- 4.3. Die Texte
- 4.4. Anomalien
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die sprachlichen Unterschiede zwischen Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch, insbesondere hinsichtlich Nebensilbenabschwächungen und Lautverschiebungen. Analysiert werden dazu Ausschnitte der Andreaslegende in mitteldeutscher und niederdeutscher Fassung. Die Arbeit prüft die These, dass Mittelniederdeutsch weniger Nebensilbenabschwächungen aufweist und keine althochdeutschen Lautverschiebungen zeigt, während im Mittelhochdeutschen mehr althochdeutsche als indogermanische Lautverschiebungen zu erwarten sind.
- Vergleich von Nebensilbenabschwächungen im Mittelhochdeutschen und Mittelniederdeutschen
- Untersuchung der Lautverschiebungen in beiden Sprachstufen
- Analyse der Andreaslegende als Fallbeispiel
- Erläuterung der historischen Entwicklung der beiden Sprachen
- Bewertung der Ausgangsthese
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Hausarbeit: den Vergleich sprachlicher Unterschiede, speziell Nebensilbenabschwächungen und Lautverschiebungen, zwischen Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch anhand der Andreaslegende. Die These, dass Mittelniederdeutsch weniger Abschwächungen und keine althochdeutschen Lautverschiebungen aufweist, wird formuliert. Die Methodik, die auf Fachliteratur und dem Vergleich der beiden Fassungen der Andreaslegende basiert, wird skizziert.
2. Sprachliche Veränderungen: Dieses Kapitel erläutert die Konzepte der Nebensilbenabschwächung und der Lautverschiebung. Die Nebensilbenabschwächung wird als wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch vorgestellt, wobei die Verschiebung der Wortakzentuierung auf die erste Silbe zu einer Schwächung der Vokale in den Nebensilben führt. Das Kapitel erklärt auch die erste und zweite Lautverschiebung im Germanischen, mit Betonung auf deren Einfluss auf die Entwicklung des Hochdeutschen und Niederdeutschen. Der Fokus liegt auf der unterschiedlichen Ausprägung dieser Phänomene in den beiden untersuchten Sprachstufen.
3. Sprachen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Indogermanisch, Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch. Es dient als linguistischer Kontext für die spätere Analyse der Andreaslegende. Die Ausführungen beleuchten die historischen Entwicklungen und geographischen Verbreitungsgebiete der Sprachen sowie relevante Merkmale, die für den späteren Vergleich wichtig sind, wie z.B. die Hanse im Kontext des Mittelniederdeutschen und die Benrather Linie als sprachgeographische Grenze. Die Darstellung der sprachlichen Entwicklung dient als Basis für das Verständnis der Unterschiede zwischen Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch.
4. Die Andreaslegende: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Vergleich der mitteldeutschen und niederdeutschen Fassungen der Andreaslegende. Es analysiert die Unterschiede in Bezug auf Nebensilbenabschwächung und Lautverschiebung, die im vorherigen Kapitel erläutert wurden. Der Vergleich der Textabschnitte soll die in der Einleitung formulierte These bestätigen oder widerlegen. Die Anomalien werden hier ebenfalls beleuchtet. Die Analyse soll die sprachlichen Entwicklungen anhand konkreter Beispiele illustrieren.
Schlüsselwörter
Mittelhochdeutsch, Mittelniederdeutsch, Nebensilbenabschwächung, Lautverschiebung, Andreaslegende, Indogermanisch, Sprachvergleich, Sprachgeschichte, Althochdeutsch, Dialektgeographie.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Sprachlicher Vergleich von Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch anhand der Andreaslegende
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die sprachlichen Unterschiede zwischen Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch, insbesondere hinsichtlich Nebensilbenabschwächung und Lautverschiebung. Als Fallbeispiel dient die Andreaslegende in mitteldeutscher und niederdeutscher Fassung. Die zentrale These lautet, dass Mittelniederdeutsch weniger Nebensilbenabschwächungen und keine althochdeutschen Lautverschiebungen aufweist, während im Mittelhochdeutschen mehr althochdeutsche als indogermanische Lautverschiebungen zu erwarten sind.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich von Nebensilbenabschwächungen und Lautverschiebungen in Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch, Analyse der Andreaslegende als Fallbeispiel, Erläuterung der historischen Entwicklung beider Sprachen (inkl. Indogermanisch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch mit Bezug auf die Hanse und die Benrather Linie) und eine abschließende Bewertung der eingangs formulierten These.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Zielsetzung und Methodik), Sprachliche Veränderungen (Nebensilbenabschwächung und Lautverschiebung), Sprachen (Indogermanisch, Mittelhochdeutsch, Mittelniederdeutsch), Die Andreaslegende (Vergleich der mitteldeutschen und niederdeutschen Fassungen mit Analyse von Anomalien) und Fazit.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Hausarbeit, die zu untersuchende These (weniger Nebensilbenabschwächungen und keine althochdeutschen Lautverschiebungen im Mittelniederdeutschen im Vergleich zum Mittelhochdeutschen) und die angewandte Methodik (basierend auf Fachliteratur und dem Vergleich der beiden Fassungen der Andreaslegende).
Wie werden Nebensilbenabschwächung und Lautverschiebung in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel "Sprachliche Veränderungen" erläutert die Konzepte der Nebensilbenabschwächung (als wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch) und der ersten und zweiten Lautverschiebung im Germanischen. Der Fokus liegt auf deren unterschiedlicher Ausprägung in Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch.
Welche Rolle spielt die Andreaslegende in der Analyse?
Die Andreaslegende dient als Fallbeispiel, um die These der Hausarbeit zu überprüfen. Im Kapitel "Die Andreaslegende" werden die mitteldeutsche und niederdeutsche Fassung der Legende verglichen, um die Unterschiede in Bezug auf Nebensilbenabschwächung und Lautverschiebung zu analysieren und die in der Einleitung formulierte These zu bestätigen oder zu widerlegen.
Welche Sprachen werden im Kontext der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Indogermanisch als Ursprache, Althochdeutsch als Vorläufer, Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch als die zu vergleichenden Sprachstufen. Der historische Kontext und die geographische Verbreitung dieser Sprachen werden beleuchtet, inklusive der Bedeutung der Hanse für das Mittelniederdeutsche und der Benrather Linie als sprachgeographische Grenze.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mittelhochdeutsch, Mittelniederdeutsch, Nebensilbenabschwächung, Lautverschiebung, Andreaslegende, Indogermanisch, Sprachvergleich, Sprachgeschichte, Althochdeutsch, Dialektgeographie.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse des Vergleichs von Mittelhochdeutsch und Mittelniederdeutsch zusammen und bewertet die eingangs formulierte These. (Der genaue Inhalt des Fazits ist in der vorliegenden Zusammenfassung nicht detailliert beschrieben.)
- Arbeit zitieren
- Talea G. (Autor:in), 2017, Nebensilbenabschwächungen im Mitteldeutschen und Niederdeutschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372117