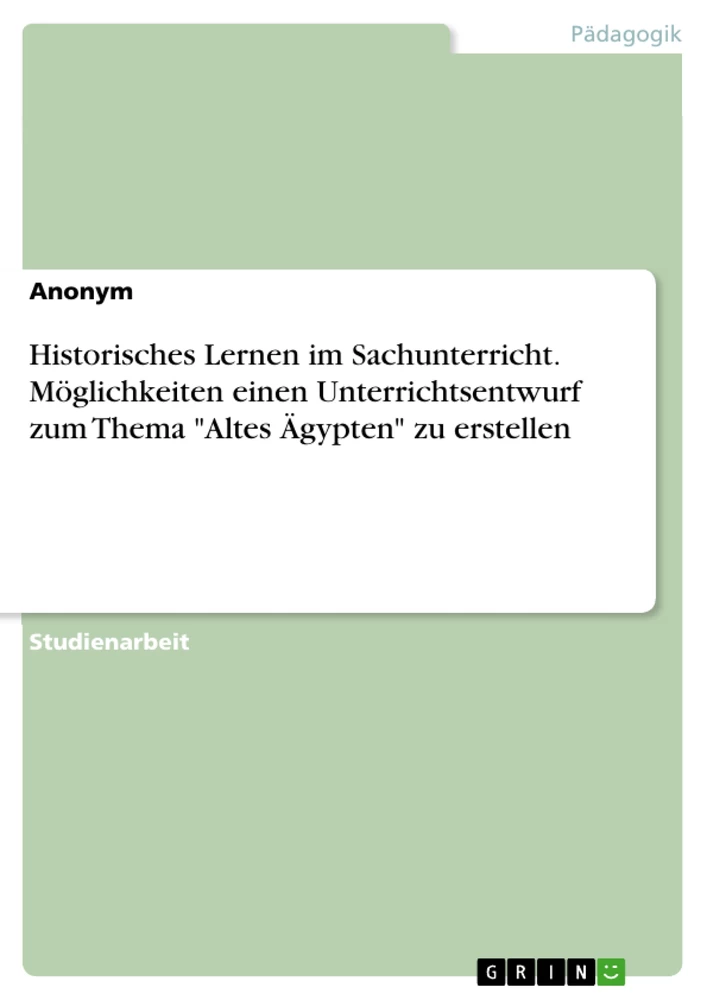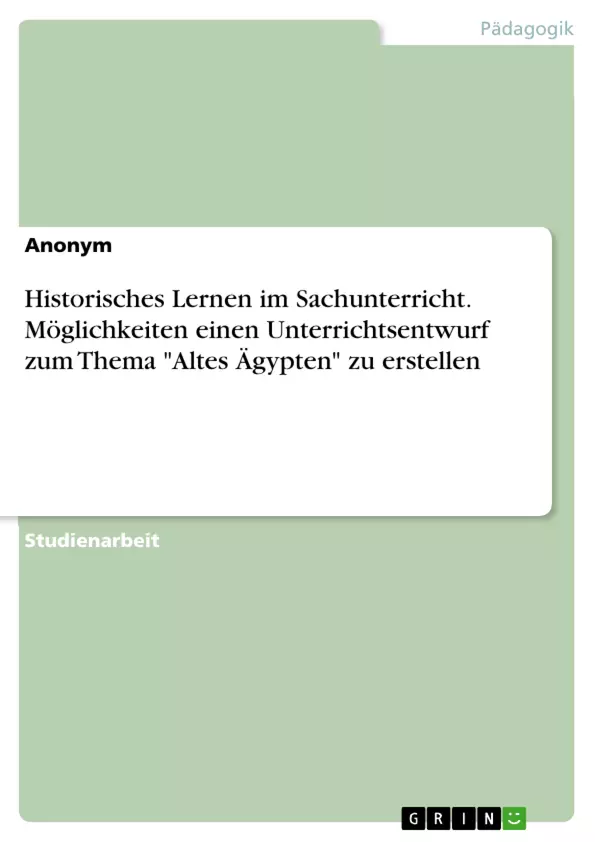Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Sachverhalt, inwiefern sich das Thema „Das alte Ägypten“ im Rahmen einer Projektarbeit in einer dritten Klasse auf theoretischer Basis realisieren lässt. Da dieser Bereich ein gängiger Unterrichtsinhalt des Sachunterrichts darstellt, ist es gerade für eine angehende Lehrkraft interessant, eine mögliche Gestaltung zu erfahren. Aufgrund der Vielzahl an Methoden kann es schwierig sein, hier eine Auswahl zu treffen, die dem Sachverhalt und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern gerecht wird. Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, den historischen Unterrichtsgegenstand „Altes Ägypten“ in Beziehung zu einer Projektarbeit zu setzten umso eine mögliche Gestaltungsvariante einer Unterrichtseinheit zu veranschaulichen.
Dazu werden zunächst die Grundlagen skizziert, die wichtig sind, um die Argumente und Methoden dieser Arbeit zu verstehen. Hier wird deshalb als erstes ein fachlicher Einstieg geboten, indem hauptsächlich etwas zu dem Inhalt des Themas erklärt wird. Dieser Inhalt soll im Groben den Erkenntnisgewinn darstellen, welcher auch die Schülerinnen und Schüler am Ende dieser Reihe im Optimalfall erfahren.
Bevor es dann zur Planung der Projektarbeit kommt, werden zunächst anhand der Begriffsklärung des „Geschichtsbewusstseins“ nach Pandel und das Konzept des Fuer-Modells die Ziele der Unterrichtsreihe im Detail definiert. Diese Erkenntnisse sollen weiterführend im nächsten Schritt auf die einzelnen Phasen des Projekts übertragen werden. Doch zunächst einmal kommt es zur Vorstellung der Rahmenbedingungen, welche auf die gesammelten Daten eines vergangenen Praktikums basieren. Im Anschluss werden dann die Projektphasen, die auf der Konzeption von Michael Sauer basieren, detailliert aufgezeigt. Diese Unterteilung der Unterrichtsreihe zum Thema „Altes Ägypten“ resultiert aus der Tatsache, dass die Kinder die Chance haben, möglichst eigenständig und frei zu arbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Fachlicher Einstieg
- Der Nil
- Pharaonen
- Das Leben nach dem Tod
- Pyramiden
- Die Kindheit und das Familienleben im alten Ägypten
- Was geschah nach der Zeit des alten Ägyptens?
- Fachlicher Einstieg
- Projektarbeit
- Ziele des Projekts
- Geschichtsbewusstsein
- Das FUER-Modell
- Beschreibung des Projektverlaufs
- Rahmenbedingungen
- Initiierungsphase
- Planungsphase
- Durchführungsphase
- Präsentationsphase
- Auswertungsphase
- Museum des alten Ägyptens
- Reflexion
- Differenzierungsmöglichkeiten
- Begründung der Projektarbeit zum alten Ägypten
- Perspektivrahmen
- Lehrplan
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Umsetzbarkeit einer Projektarbeit zum Thema "Das alte Ägypten" in einer dritten Klasse. Sie soll eine mögliche Gestaltungsvariante einer Unterrichtseinheit aufzeigen, die den historischen Unterrichtsgegenstand mit den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler in Einklang bringt.
- Die Vermittlung von historischem Wissen über das alte Ägypten.
- Die Entwicklung von Geschichtsbewusstsein bei den Schülerinnen und Schülern.
- Die Anwendung des FUER-Modells im Unterricht.
- Die Gestaltung eines projektorientierten Unterrichts.
- Die Berücksichtigung von Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor und erläutert das Ziel, eine mögliche Projektarbeit zum Thema "Das alte Ägypten" für eine dritte Klasse zu konzipieren.
- Grundlagen: Dieses Kapitel bietet einen fachlichen Einstieg in das Thema "Das alte Ägypten" und erläutert wichtige Aspekte der Hochkultur, darunter die Bedeutung des Nils, die Rolle der Pharaonen und das Verständnis des Lebens nach dem Tod.
- Projektarbeit: Dieses Kapitel definiert die Ziele des Projekts, darunter die Entwicklung von Geschichtsbewusstsein und die Anwendung des FUER-Modells. Es beschreibt anschließend die einzelnen Phasen des Projektverlaufs, von der Initiierungsphase bis zur Auswertungsphase, und beleuchtet die Bedeutung der Differenzierungsmöglichkeiten.
- Begründung der Projektarbeit zum alten Ägypten: Dieses Kapitel behandelt die Einordnung des Themas in den Lehrplan und den Perspektivrahmen des Sachunterrichts.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: "Das alte Ägypten", "Projektarbeit", "Geschichtsbewusstsein", "FUER-Modell", "Differenzierung", "Lehrplan", "Sachunterricht". Die Arbeit befasst sich mit der Gestaltung einer Unterrichtseinheit zum Thema "Das alte Ägypten" für eine dritte Klasse und untersucht dabei die Anwendung verschiedener didaktischer Methoden und Konzepte, insbesondere im Kontext der Projektarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Für welche Zielgruppe ist dieser Unterrichtsentwurf zum alten Ägypten gedacht?
Der Entwurf ist speziell für eine Projektarbeit in einer dritten Grundschulklasse im Fach Sachunterricht konzipiert.
Was ist das "FUER-Modell" im Kontext des Geschichtsunterrichts?
Das FUER-Modell dient der Förderung und Entwicklung von reflektiertem Geschichtsbewusstsein bei Schülern durch problemorientiertes historisches Denken.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden im Projekt behandelt?
Die Kinder lernen unter anderem die Bedeutung des Nils, die Rolle der Pharaonen, den Bau der Pyramiden und die Vorstellung vom Leben nach dem Tod kennen.
Wie ist der Ablauf der Projektarbeit strukturiert?
Das Projekt gliedert sich in eine Initiierungs-, Planungs-, Durchführungs-, Präsentations- und Auswertungsphase, die auf dem Konzept von Michael Sauer basieren.
Warum wurde die Methode der Projektarbeit gewählt?
Projektarbeit ermöglicht den Kindern ein besonders eigenständiges und freies Arbeiten, was dem historischen Gegenstand und dem Lehrplan des Sachunterrichts entspricht.
- Ziele des Projekts
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Historisches Lernen im Sachunterricht. Möglichkeiten einen Unterrichtsentwurf zum Thema "Altes Ägypten" zu erstellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372124