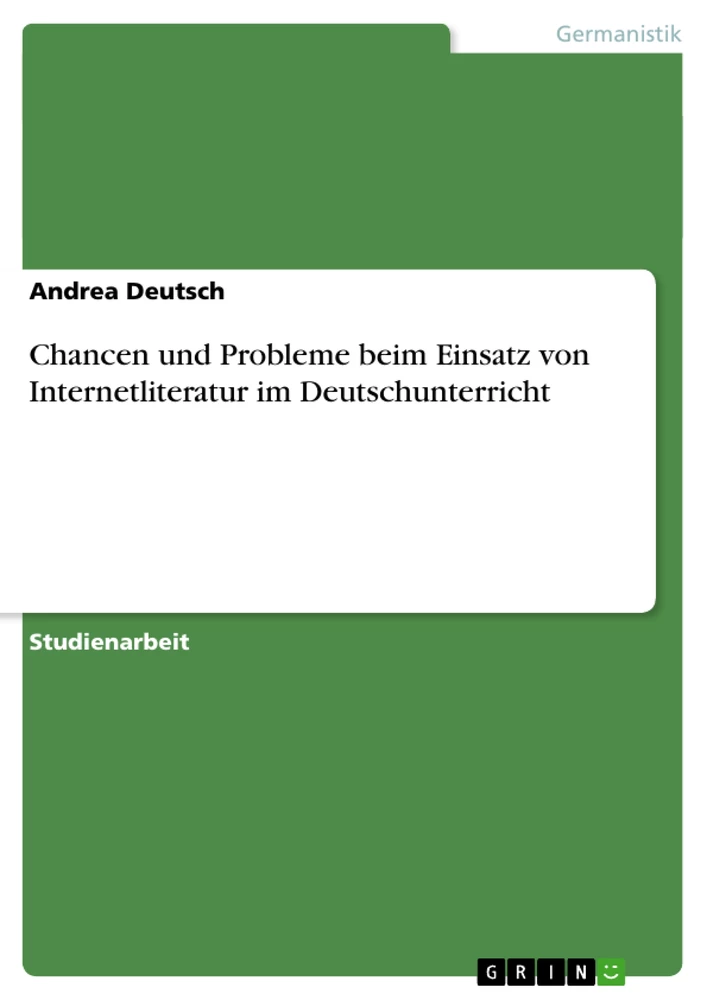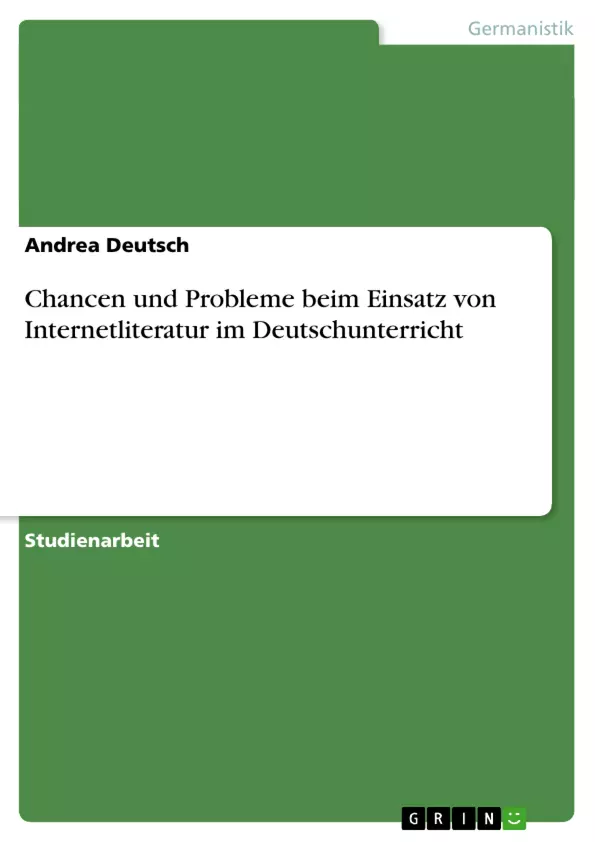Der Konsum von neuen Medien durch Schülerinnen und Schüler steigt gerade in den letzten Jahren rapide an. Einige verbringen mehrere Stunden täglich im Internet. Für den Deutschunterricht kann diese Entwicklung zweierlei bedeuten. Zum einen hat man die Möglichkeit die neuen Medien zu verteufeln und sich umfassend in Kritik zu üben. Vielfach stoßen diese Medien und deren übermäßiger Konsum auf starke Ablehnung, was unter anderem damit zu tun haben kann, dass viele Menschen älterer Generation sich im Umgang mit diesen überfordert und sich Kindern und Jugendlichen, welche es nicht besonders schwer haben, sich neue Techniken anzueignen, unterlegen fühlen.
Auf der anderen Seite existieren Computer, Internet und Co als immer selbstverständlicher werdender Teil unseres täglichen Lebens und nehmen immer mehr Raum in unserem sowie im Schülerinnenalltag ein. Die andere Möglichkeit mit der geschilderten Entwicklung umzugehen, ist der produktive Einbezug dieser Medien in den Unterricht, um mit der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler Schritt zu halten. Hierbei ist es von größter Wichtigkeit, dass Schülerinnen und Schüler von einer oberflächlichen Rezeptionshaltung, welche sie sich durch flüchtiges Überfliegen beim Surfen über die Internetseiten angewöhnt haben, wegkommen und in einen konzentrierten und aufmerksamen Leseprozess geraten. Es muss deutlich werden, dass der Deutschunterricht der sich immer weiter verkürzenden Aufmerksamkeitsspanne durch diese bedienende „kurze“ Netzliteratur zu begegnen versucht, sondern dass auch diese Form von Literaturkonsum zur Schärfung der Wahrnehmung dienen kann.
In der folgenden Hausarbeit soll zunächst darin eingeführt werden, was hinter Schlagworten wie Netzliteratur, Hypertext und Hyperfiction steckt und wie der Literaturbetrieb diesen neuen Formen von Literatur begegnet. Dabei sollen Prinzipen deutlich gemacht und neue Literaturformen vorgestellt werden. In einem zweiten Teil der Arbeit soll auf den sinnvollen und bereichernden Umgang mit Computer und Internet im Deutschunterricht eingegangen werden. Besonderes Gewicht wird hierbei auf den Umgang mit Texten, welche das Prinzip des Hypertextes verfolgen, gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Digitale Literatur - Grundlagen
- 2.1 Internetliteratur, Hyperfiction, Hypertext: Was ist das?
- 2.2 Die Anfänge der Netzliteratur
- 2.2.1 Hypertext und seine literarisch-ästhetischen Vorbilder
- 2.3 Strukturen von (Netz)literatur
- 2.3.1 Das Lesen von Hypertexten im Gegensatz zu Büchern
- 2.4 Zur Stellung digitaler Literatur
- 3. Digitale Literatur im Deutschunterricht
- 3.1 Erste Herangehensweisen und Fragestellungen zum Thema Netzliteratur
- 3.2 Möglichkeiten die das Thema „Hypertext“ für den Deutschunterricht bietet
- 3.2.1 Kritik an den Möglichkeiten von Internetliteratur
- 3.3 Beispiele für den Umgang mit digitaler Literatur im Unterricht
- 3.3.1 Teilnahme an kollaborativen Schreibprojekten
- 3.3.2 Umgestaltung literarischer Texte in hypertextuelle Texte
- 3.3.3 Eigenständige Produktion von Hyperfictions
- 3.3.4 Internetlyrik und konkrete Poesie
- 3.3.5 Rolle des Autors und des Lesers
- 4. Fazit
- Die Entwicklung und Akzeptanz neuer Formen der Literatur, die unabhängig von gedrucktem Papier existieren
- Die Charakteristika von Internetliteratur, Hypertext und Hyperfiction
- Der Einsatz von Internetliteratur im Deutschunterricht, einschließlich seiner Möglichkeiten und Herausforderungen
- Beispiele für den Umgang mit digitaler Literatur im Unterricht
- Die Rolle des Autors und des Lesers in der digitalen Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den Chancen und Problemen des Einsatzes von Internetliteratur im Deutschunterricht. Sie untersucht die Grundlagen der digitalen Literatur, insbesondere des Hypertextes und der Hyperfiction, sowie die verschiedenen Möglichkeiten, wie diese neuen Formen der Literatur im Unterricht eingesetzt werden können.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Themas dar und erläutert die steigende Bedeutung neuer Medien im Alltag von Schülerinnen und Schülern. Sie argumentiert für einen produktiven Einbezug dieser Medien in den Unterricht, um die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen.
Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der digitalen Literatur, insbesondere die Begriffe Internetliteratur, Hyperfiction und Hypertext. Es erklärt die Entstehung und die spezifischen Eigenschaften dieser Formen der Literatur sowie die Rolle des Lesers als Co-Autor.
Kapitel 3 beleuchtet die Chancen und Probleme des Einsatzes von Internetliteratur im Deutschunterricht. Es werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie Hypertext und digitale Literatur im Unterricht eingesetzt werden können, sowie die damit verbundenen Herausforderungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Internetliteratur, Hypertext, Hyperfiction, digitale Literatur, medienerziehung, Deutschunterricht, Co-Autorenschaft, Interaktivität, Intermedialität, Inszenierung, Netzliteratur, und die Rolle des Autors und des Lesers.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Netzliteratur oder Hyperfiction?
Das sind literarische Texte, die speziell für das Internet erstellt wurden und durch Hyperlinks eine nicht-lineare Erzählstruktur ermöglichen.
Welche Chancen bietet Internetliteratur für den Deutschunterricht?
Sie knüpft an die Lebenswirklichkeit der Schüler an, fördert die Medienkompetenz und ermöglicht interaktive, kollaborative Schreibprojekte.
Welche Probleme gibt es beim Lesen von Hypertexten?
Schüler neigen oft zu einer oberflächlichen Rezeptionshaltung („Überfliegen“); der Unterricht muss sie zurück zu einem konzentrierten Leseprozess führen.
Wie ändert sich die Rolle des Lesers bei digitaler Literatur?
Der Leser wird oft zum Co-Autor, da er durch die Auswahl von Links den Verlauf der Geschichte selbst mitbestimmt.
Was sind Beispiele für den Einsatz im Unterricht?
Möglich sind die Umgestaltung klassischer Texte in Hypertexte, die Produktion eigener Hyperfictions oder die Analyse von Internetlyrik.
- Quote paper
- Andrea Deutsch (Author), 2005, Chancen und Probleme beim Einsatz von Internetliteratur im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37216