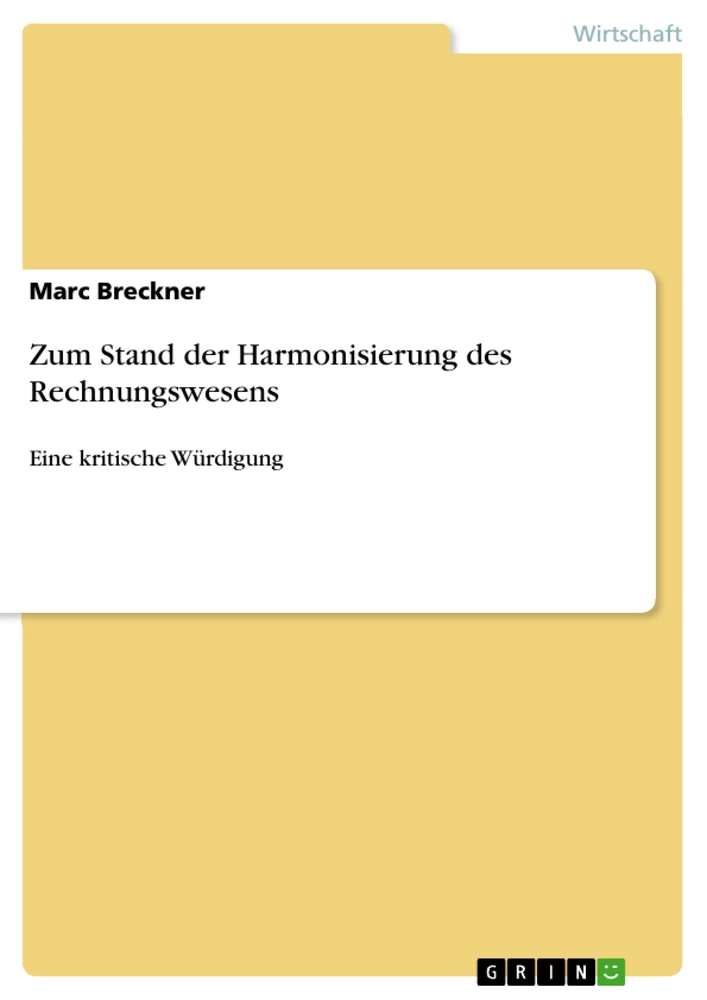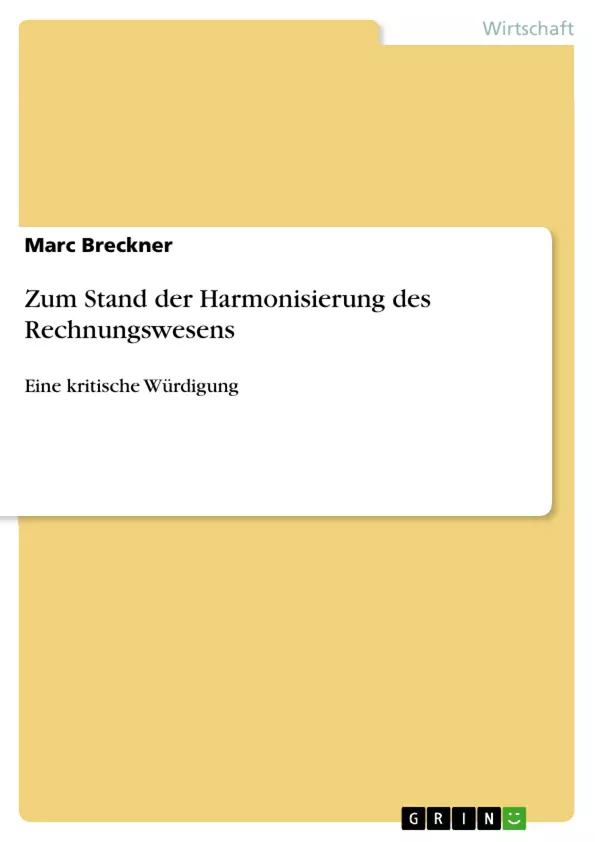Im Zuge der Verordnung EG 1606/2002 vom 19. Juli 2002 sind kapitalmarktorientierte Unternehmen seit dem 01. Januar 2005 dazu verpflichtet, ihren Konzernabschluss nach den vom IASB verabschiedeten full IFRS aufzustellen. Mit dem Bilanzrechtmodernisierungsgesetz hat der Gesetzgeber 2009 eine umfangreiche Reform des HGB umgesetzt, damit das deutsche Handelsrecht alternativ zu den IFRS angesehen wird. Dabei sollte das HGB eine den Unternehmen Kostenvorteile bringen sowie eine einfachere Anwendung. Noch im selben Jahr veröffentlichte der IASB den Standard IFRS for SME, welcher sich an nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen richtet. Diese erhalten dadurch ein deutlich vereinfachtes und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtetes Rechnungslegungssystem. Für die Ausschüttungsbemessung müssen indes alle deutschen Unternehmen weiterhin ihren Jahresabschluss nach HGB aufstellen. Es ist jedoch festzustellen, dass deutsche Unternehmen zunehmend auf internationalen Kapitalmärkten, an denen kostengünstigere Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsmöglichkeiten existieren, aktiv sind. Für internationale Adressaten ist ein Jahresabschluss nach HGB nur schwer interpretier- und vergleichbar, weshalb Unternehmen u. a. zunehmend motiviert sein können, einen an die IFRS for SME stark angenäherten Jahresabschluss nach HGB aufzustellen.
Der handelsrechtliche Jahresabschluss verfolgt neben der Dokumentation als seinem primären Buchführungszweck sowohl den Rechenschafts- als auch Kapitalerhaltungszweck , wohingegen der IFRS-Abschluss vordergründig Informationen für die wirtschaftlichen Entscheidungen seiner Adressaten bereitstellen soll. Diese unterschiedlich verfolgten Zwecke haben zur Folge, dass unterschiedliche Vorschriften, bspw. bei der Folgebewertung von Bilanzpositionen auf der Aktivseite, im HGB und in den IFRS gelten.
Aufgrund zahlreich bestehender Wahlrechte und Ermessensspielräume im HGB können Unternehmen indes einen handelsrechtlichen Abschluss aufstellen, der überwiegend mit denen des IFRS for SME eines Einzelabschlusses harmoniert. Welche Wahlrechte und Ermessenspielräume im HGB Unternehmen ausüben können, hängt davon ab, inwieweit die im HGB verankerten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung dies zulassen.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, zu untersuchen, ob es für Unternehmen möglich ist, einen Jahresabschluss nach HGB aufzustellen, der auf Konvergenz mit den IFRS-Vorschriften ausgerichtet ist, und welche Anreize an eine Annäherung die Unternehmen hierfür haben.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Die Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS for SME
- Das handelsrechtliche Zweck- und GoB-System
- Zweck und qualitative Anforderung der Rechnungslegung nach IFRS for SME
- Harmonisierungsstrategien De lege lata
- Überblick bisheriger Forschungsergebnisse zum Dualitätspotenzial der Rechnungslegung nach HGB und IFRS for SME
- Dualitätspotenzial bei langfristigen Fertigungsaufträgen in der Rechnungslegung
- Dualitätspotenzial beim Ansatz
- Dualitätspotenzial bei der Bewertung
- Dualitätspotenzial in den Anhangangaben
- Kritische Würdigung
- Vorteile der Nutzung des Dualitätspotenzials
- Nachteile der Nutzung des Dualitätspotenzials
- Veranschaulichung am Beispiel langfristigen Fertigungsaufträgen
- Harmonisierungsstrategien De lege ferenda
- Überblick bisheriger Forschungsergebnisse zum Dualitätspotenzial der Rechnungslegung HGB und IFRS for SME
- Konzept der erweiterten Ausschüttungssperre
- Konzept des erweiterten Solvenztests
- Kritische Würdigung
- Vorteile der Nutzung des Dualitätspotenzials
- Nachteile der Nutzung des Dualitätspotenzials
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Harmonisierung des Rechnungswesens im Kontext des HGB und IFRS for SME. Sie untersucht das Dualitätspotenzial, das sich aus den unterschiedlichen Regelungen ergibt, und erörtert mögliche Harmonisierungsstrategien. Dabei werden sowohl die Vorteile als auch die Nachteile einer stärkeren Harmonisierung beleuchtet.
- Dualitätspotenzial im Rechnungswesen
- Harmonisierungsstrategien De lege lata und De lege ferenda
- Kritische Würdigung der Harmonisierungsmöglichkeiten
- Vorteile und Nachteile der Harmonisierung
- Beispiele zur Veranschaulichung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 legt die Problemstellung dar, die sich aus der parallelen Anwendung des HGB und IFRS for SME ergibt.
- Kapitel 2 erläutert die Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS for SME, wobei insbesondere auf Zweck und qualitative Anforderungen eingegangen wird.
- Kapitel 3 gibt einen Überblick über die bisherigen Forschungsergebnisse zum Dualitätspotenzial im Kontext von HGB und IFRS for SME.
- Kapitel 4 untersucht das Dualitätspotenzial im Detail am Beispiel von langfristigen Fertigungsaufträgen, wobei sowohl die Vorteile als auch die Nachteile der Nutzung dieses Potenzials betrachtet werden.
- Kapitel 5 widmet sich verschiedenen Harmonisierungsstrategien De lege ferenda, darunter das Konzept der erweiterten Ausschüttungssperre und des erweiterten Solvenztests.
Schlüsselwörter
Harmonisierung, Rechnungswesen, HGB, IFRS for SME, Dualitätspotenzial, langfristige Fertigungsaufträge, Anhangangaben, Ausschüttungssperre, Solvenztest, De lege lata, De lege ferenda.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen HGB und IFRS?
Das HGB dient primär dem Gläubigerschutz und der Ausschüttungsbemessung, während IFRS auf die Informationsbereitstellung für Investoren (Kapitalmarkt) fokussiert ist.
Was bedeutet "IFRS for SME"?
Es handelt sich um einen vereinfachten IFRS-Standard für kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht kapitalmarktorientiert sind.
Können HGB-Abschlüsse mit IFRS harmonisiert werden?
Ja, durch die Nutzung von Wahlrechten und Ermessensspielräumen im HGB können Unternehmen ihren Abschluss stark an internationale Standards annähern.
Warum wollen deutsche Unternehmen ihre Rechnungslegung harmonisieren?
Um auf internationalen Kapitalmärkten vergleichbar zu sein und kostengünstigere Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen.
Was ist eine "Ausschüttungssperre"?
Es ist eine gesetzliche Regelung im HGB, die verhindert, dass unrealisierte Gewinne an Gesellschafter ausgezahlt werden, um das Kapital des Unternehmens zu erhalten.
- Quote paper
- Marc Breckner (Author), 2017, Zum Stand der Harmonisierung des Rechnungswesens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372181