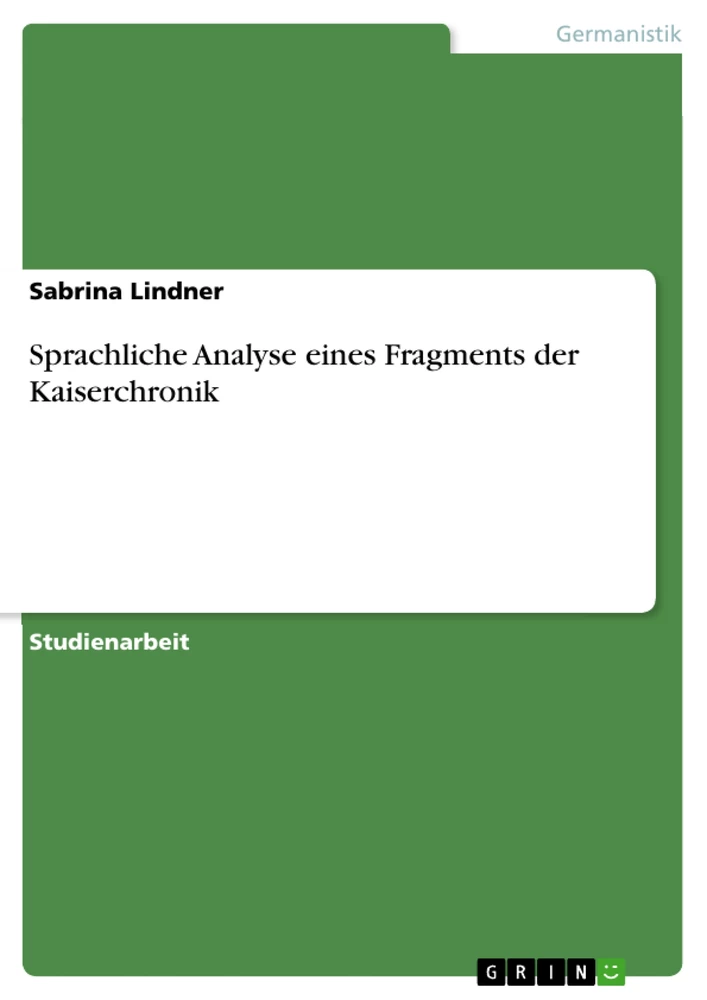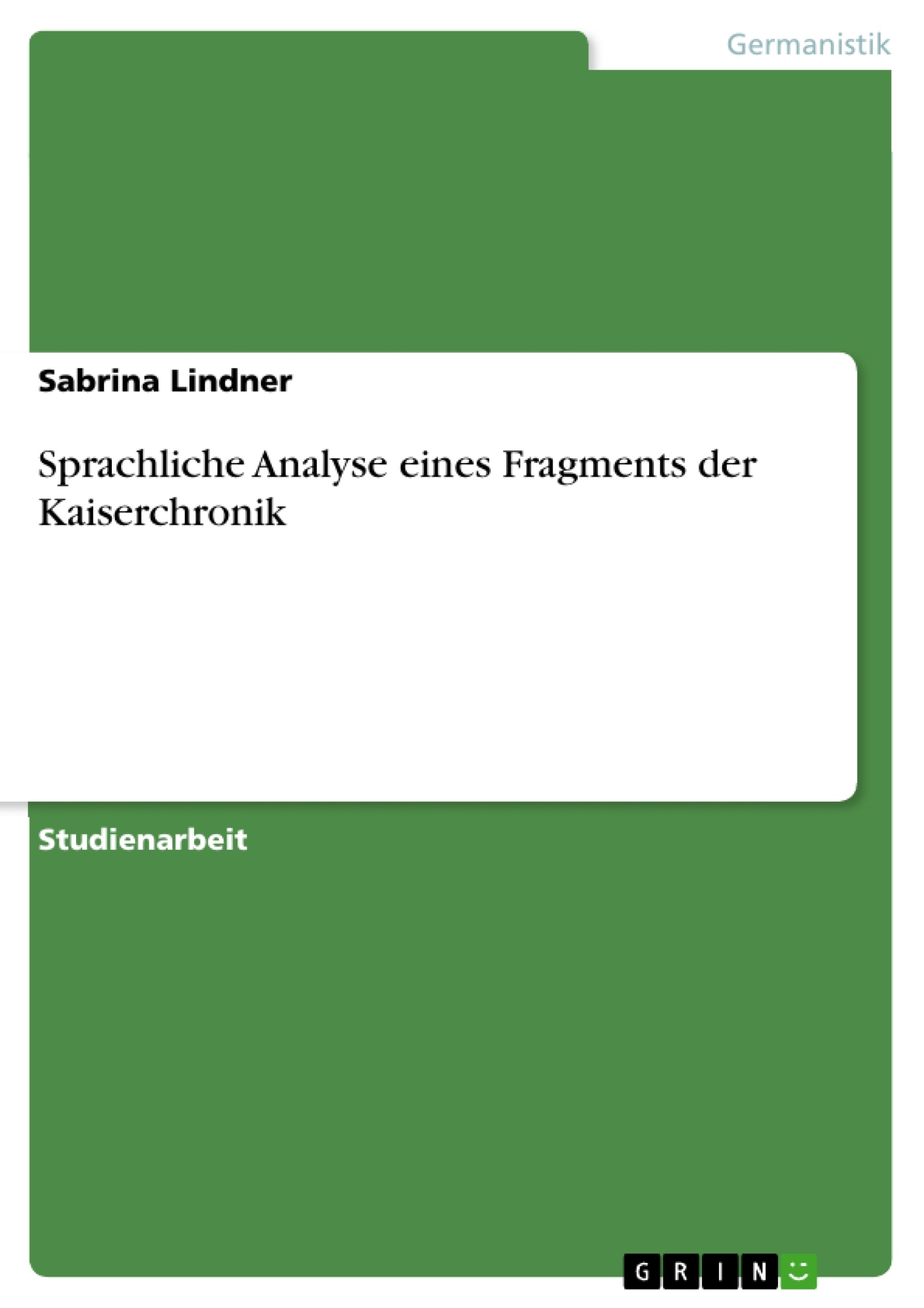Auf der Suche nach den Wurzeln der deutschen Sprachgeschichte trifft man auf höfische Epik, Heldenepik, wie beispielsweise das Nibelungenlied und natürlich auf die Minnelyrik. Vor allem der berühmte Codex Manesse, die umfassende Heidelberger Liederhandschrift, beinhaltet zahlreiche repräsentative Werke der mittelhochdeutschen Sprachepoche. Als das umfangreichste Werk dieser Zeit mit ca. 17.000 Reimpaarversen gilt in der historischen Sprachwissenschaft allerdings die faszinierende Weltchronik Kaiserchronik. Bisherige Forschungsergebnisse datieren das Werk um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Es existieren insgesamt 50 Zeugnisse der Chronik, die an unterschiedlichen Aufbewahrungsorten und Bibliotheken verwahrt werden.
Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Sprachanalyse eines der Fragmente dieser bedeutenden mittelhochdeutschen Reimchronik, das in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrt wird. Eine sprachliche Analyse hinsichtlich Alter und Dialekteinteilung des vorliegenden Schriftstücks soll detailliert Aufschluss über eine mögliche zeitliche sowie räumliche Verortung geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Mittelhochdeutsche
- Sprachfamilie und Ursprung
- Zeitliche Gliederung
- Die Kaiserchronik
- Überlieferung
- Das vorliegende Fragment (Wien, ÖNB, Cod. 12866)
- Sprachliche Analyse des Fragments
- Mhd. //, /iul, lûl
- Nicht der Fall einer fnhd. Diphthongierung
- Vollzogene fnhd. Diphthongierung
- Nhd. Diphthongwandel
- Germ. */k/
- Die Verben stân, stên und gân, gên
- Negation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Analyse eines Fragments der Kaiserchronik, das in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrt wird. Ziel der Arbeit ist es, anhand der sprachlichen Merkmale des Fragments eine möglichst genaue zeitliche und räumliche Einordnung zu ermöglichen. Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, in welcher Sprachepoche das Fragment entstanden ist und aus welcher Region es stammt.
- Diachronische Sprachbetrachtung des Mittelhochdeutschen
- Sprachliche Merkmale des Fragments
- Frühneuhochdeutsche Diphthongierung
- Neuhochdeutscher Diphthongwandel
- Germanisches */k/
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in das Mittelhochdeutsche. Kapitel 2 beleuchtet die Sprachfamilie und den Ursprung des Mittelhochdeutschen sowie die zeitliche Einteilung der Epoche. Kapitel 3 widmet sich der Überlieferung der Kaiserchronik und stellt das in Wien aufbewahrte Fragment näher vor. Der Hauptteil der Arbeit, Kapitel 4, umfasst die sprachliche Analyse des Fragments. Hier werden lautliche und grammatische Phänomene untersucht, die Rückschlüsse auf die zeitliche und räumliche Einordnung des Fragments zulassen. Die Analyse konzentriert sich dabei auf die frühneuhochdeutsche Diphthongierung, den neuhochdeutschen Diphthongwandel, das germanische */k/, die Verben stân/stên und gân/gên sowie die Negation.
Schlüsselwörter
Kaiserchronik, Mittelhochdeutsch, Sprachliche Analyse, Frühneuhochdeutsche Diphthongierung, Neuhochdeutscher Diphthongwandel, Germanisches */k/, Verben stân/stên und gân/gên, Negation, Dialekteinteilung, Zeitliche Einordnung.
- Arbeit zitieren
- Sabrina Lindner (Autor:in), 2017, Sprachliche Analyse eines Fragments der Kaiserchronik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372216