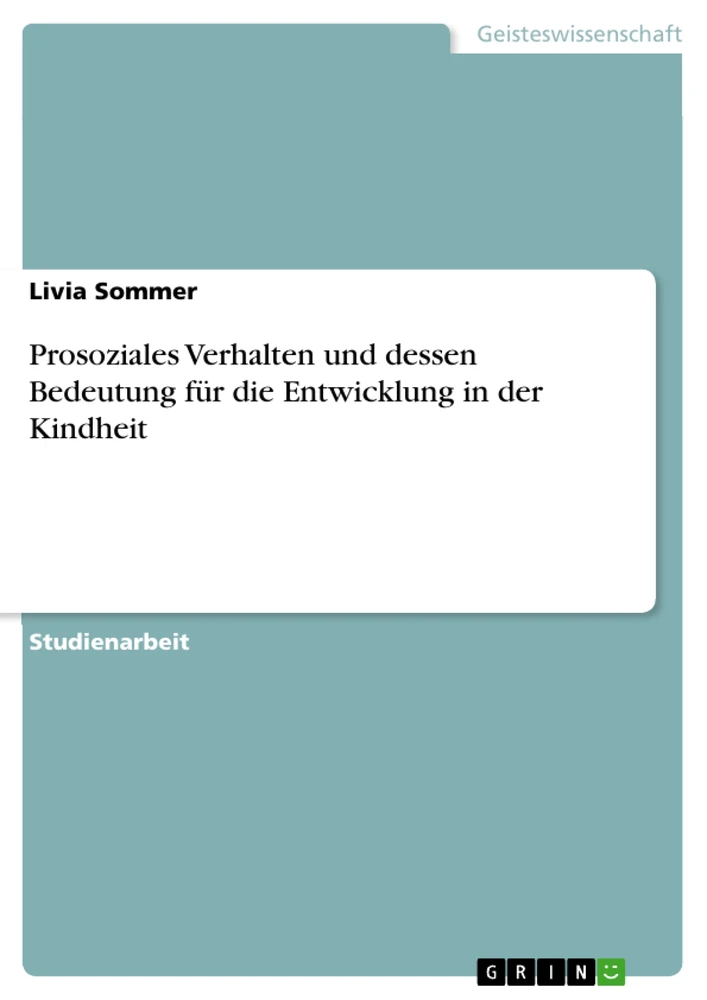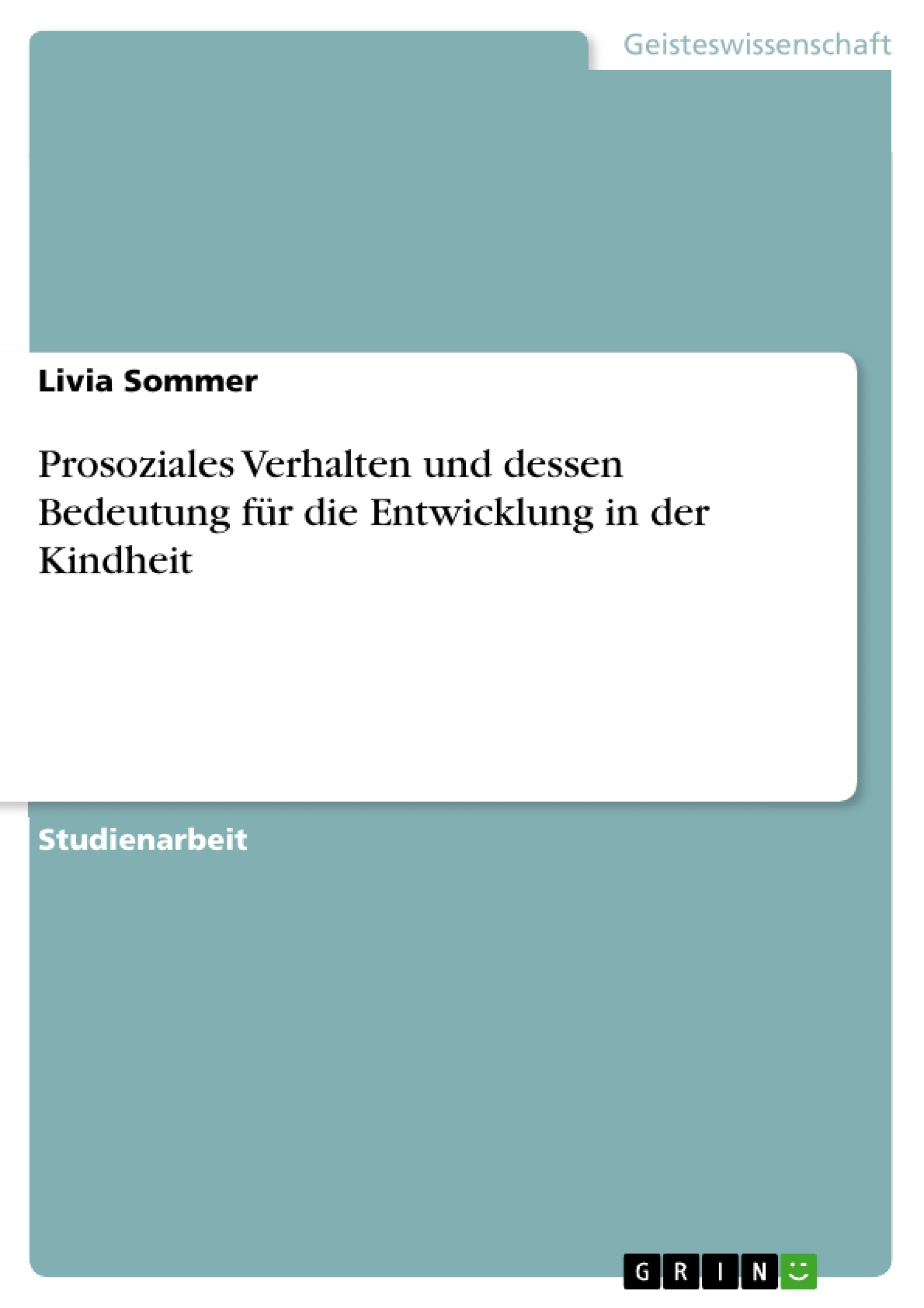Gegenwärtig liest man oft in Zeitungen, dass bei inszenierten Autounfällen durch die Polizei, Passanten entweder gar nicht eingreifen und vorbeifahren oder sich nicht zu helfen wissen. Doch warum ist das so und wo liegt der Ursprung des prosozialen Verhaltens? In meiner vorliegenden Hausarbeit möchte ich der Frage auf den Grund gehen, welche Bedeutung prosoziales Verhalten für die Entwicklung in der Kindheit hat und welche Entwicklungsprozesse ein Kind durchläuft, um prosoziales Verhalten entstehen zu lassen.
Als erstes werde ich dabei wiederholt auf den Begriff des prosozialen Verhaltens eingehen und dabei die oben genannten Begriffe noch einmal aufgreifen. Als zweites möchte ich mich mit der Entwicklung und dem Erlernen von Hilfsbereitschaft im Kindesalter befassen. Als drittes beschäftige ich mich mit der Bedeutung von prososzialen Verhalten in der Kindheit. Zum Schluss werde ich eine Studie miteinbeziehen, die mütterliche Feinfühligkeit und die Entwicklung von prosozialem Verhalten bei Vorschulkindern thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Prosoziales Verhalten, Hilfeverhalten und Altruismus
- 3. Entwicklung von prosozialen Verhalten
- 3.1 durch Emotion
- 3.2 durch das Gewissen
- 3.3 Befragung von Müttern über das prosoziale Verhalten der vierjährigen Kinder.
- 4. Eine Beobachtungsstudie: Mütterliche Feinfühligkeit und die Entwicklung von mitfühlend prosozialem Verhalten bei Vorschulkindern
- 5. Schlussfolgerung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung von prosozialem Verhalten für die Entwicklung in der Kindheit. Sie beleuchtet den Ursprung und die Entstehung von prosozialem Verhalten und untersucht die Faktoren, die zu seiner Entwicklung beitragen. Die Arbeit analysiert zudem die Entwicklung von prosozialem Verhalten in den ersten Jahren des Lebens, insbesondere im Kindergartenalter.
- Definition und Abgrenzung von prosozialem Verhalten, Hilfeverhalten und Altruismus
- Die Rolle von Emotionen und Empathie in der Entwicklung von prosozialem Verhalten
- Der Einfluss des Gewissens auf prosoziales Handeln
- Bedeutung elterlicher Feinfühligkeit für die Entwicklung von Mitgefühl und prosozialem Verhalten
- Beobachtungsstudie zur Beziehung zwischen mütterlicher Feinfühligkeit und dem prosozialen Verhalten von Vorschulkindern
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von prosozialem Verhalten in der kindlichen Entwicklung vor und gibt einen Überblick über die Themen und die Struktur der Hausarbeit.
- Kapitel 2: Prosoziales Verhalten, Hilfeverhalten und Altruismus: In diesem Kapitel werden die Begriffe prosoziales Verhalten, Hilfeverhalten und Altruismus definiert und voneinander abgegrenzt. Es werden die Unterschiede in der Motivation und dem Umfang des jeweiligen Verhaltens beleuchtet.
- Kapitel 3: Entwicklung von prosozialen Verhalten: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Aspekten der Entwicklung von prosozialem Verhalten in der Kindheit. Es werden die Rolle von Emotionen, insbesondere Mitgefühl, sowie die Bedeutung des Gewissens für die Entstehung von prosozialem Verhalten untersucht.
- Kapitel 4: Eine Beobachtungsstudie: Mütterliche Feinfühligkeit und die Entwicklung von mitfühlend prosozialem Verhalten bei Vorschulkindern: In diesem Kapitel wird eine Beobachtungsstudie vorgestellt, die die Beziehung zwischen mütterlicher Feinfühligkeit und der Entwicklung von prosozialem Verhalten bei Vorschulkindern untersucht. Die Ergebnisse der Studie werden diskutiert und in den Kontext der vorherigen Kapitel eingeordnet.
Schlüsselwörter
Prosoziales Verhalten, Hilfeverhalten, Altruismus, Entwicklung, Kindheit, Emotion, Empathie, Gewissen, Feinfühligkeit, Eltern, Vorschulkindern, Beobachtungsstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist prosoziales Verhalten bei Kindern?
Es umfasst freiwilliges Verhalten, das darauf abzielt, anderen zu nützen, wie z.B. Helfen, Teilen oder Trösten.
Wie unterscheidet sich prosoziales Verhalten von Altruismus?
Altruismus ist eine Form prosozialen Verhaltens, bei der die Hilfe ohne Eigennutz und oft unter Opfern erfolgt, während prosoziales Verhalten der Oberbegriff ist.
Welchen Einfluss hat mütterliche Feinfühligkeit?
Studien zeigen, dass eine feinfühlige Reaktion der Mutter auf die Bedürfnisse des Kindes die Entwicklung von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft fördert.
Welche Rolle spielt das Gewissen?
Das Gewissen wirkt als innerer Regulator, der Kindern hilft, soziale Normen zu verinnerlichen und prosozial zu handeln, auch wenn niemand zuschaut.
Wie beeinflussen Emotionen das Helfen?
Empathie und Mitgefühl sind zentrale emotionale Antriebe, die es Kindern ermöglichen, die Notlage anderer zu erkennen und darauf zu reagieren.
- Quote paper
- Livia Sommer (Author), 2015, Prosoziales Verhalten und dessen Bedeutung für die Entwicklung in der Kindheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372303